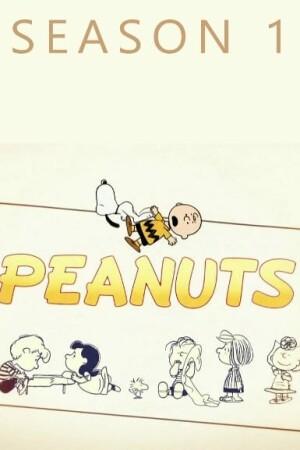Herrschaft stellt man sich martialisch vor, mit bellendem Befehlston und handfestem Zwang. Vielleicht scheint es deshalb vielen so, als lebten wir heute nach eigenem Willen in einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Dass es sich nicht so verhält, dass effektive Herrschaft leise ist und die Welt „in Ordnung“ erscheinen lässt, ist ein großes Thema des Soziologen Pierre Bourdieu – den Stephan Moebius nicht nur, aber auch hinsichtlich der jüngeren „Klassismus-Debatte“ empfiehlt.
der Freitag: Herr Moebius, in der Corona-Pandemie drohen Kinder aus unterklassigen Familien noch weiter „zurückzubleiben“. Doch schon normalerweise „vererbt“ sich sogenannte Bildungsarmut. Das ist ein Gemeinplatz. Aber wie genau vollzieht sich das eigentlich?
Stephan Moebius: Das ist eine soziale Weitergabe. Man muss das betonen, wenn fortgesetzt von „natürlicher Begabung“ fabuliert wird und von genetischer Vererbung. Doch zunächst ist die Frage, was wir unter „Bildung“ verstehen. Zumal in Deutschland ist dieser Begriff seit dem 18. Jahrhundert semantisch extrem geladen. Entstanden im aufsteigenden Bürgertum, hat er sich als ein unhinterfragtes Konzept über die Gesellschaft gelegt. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat das „legitime Kultur“ genannt.
Bildungsarmut ist ein Mangel an „legitimer Kultur“? Wie drückt sich das aus?
In den entsprechenden Debatten ist neben den Inhalten bestimmter Bücher, Filme und so weiter der Erwerb von Lern- und Sprachkompetenzen sowie Bildungsabschlüssen zentral. Es geht hier um das inzwischen umgangssprachliche „kulturelle Kapital“. Bourdieu kennt da drei Formen: „institutionalisiert“ ist es auf Abschlusszeugnissen, „objektiviert“ in einem imponierenden Bücherregal. Bildungsarmut aber beginnt meist beim „inkorporierten“ Kulturkapital, das man von klein auf in sich aufsaugt. Das reicht von Spracherwerb über bestimmte Weisen des Denkens, Wahrnehmens und Urteilens – den „Geschmack“ – bis hin zu Gesten, Mimik oder der Lautstärke der Stimme. All das verrät die Schichtenherkunft. „Bildungsarm“ ist, salopp gesagt, wer zu Hause nicht die richtige „Chemie“ abbekommt, um in der „legitimen Kultur“ mitzureden.
Diese „Chemie“ sorgt ja auch dafür, dass schichtenübergreifende Lebenspartnerschaften kaum häufiger sind als ethnisch „gemischte“. Aber wie wirkt sie bei der sozialen Vererbung?
Sie entsteht im Herkunftsmilieu, dessen soziale Position durch den Zugriff auf ökonomische, kulturelle, soziale und symbolische Ressourcen bestimmt ist. Wichtig sind aber auch Identifikationsprozesse mit diesem Milieu und seinem Habitus. Bildungsarmut entsteht nicht nur, wenn die Eltern zu wenig kulturelles Kapital „vererben“, sondern auch in dem, was sie stattdessen weitergeben. Nämlich bestimmte „Komplexe“, etwa eine starke Unsicherheit gegenüber Bildung. Man fühlt sich minderwertig, traut sich nichts zu und versucht es dann kaum. Selbst bei manchen Studierenden sehe ich das, obwohl die es ja alle immerhin an die Universität geschafft haben. Wer etwa Dialekt spricht, was ja zumeist nicht als „legitime Kultur“ gilt, traut sich oft nicht, im Seminar etwas zu sagen.
An diesem Punkt würden nun viele mit Hintergrund in der „legitimen Kultur“ einwenden: Na ja, versuchen müssen sie es schon selbst. Lehrjahre sind keine Herrenjahre!
Wer das so sagt, muss seine Herkunft komplett vergessen haben. Aber tatsächlich treten „ererbte“ Unsicherheiten auch offensiv auf, als Trotz, als scheinbare Selbstsicherheit. Etwa in der Abwertung von „Studierten“, die „keinen Nagel einschlagen“ können. Aus der Not wird eine Tugend, man tröstet sich im Vorhinein über versagte Chancen: „So ein Schreibtischjob wäre wirklich nichts für mich.“ Das wirkt wie sich selbst erfüllende Prophetie, wie ein Teufelskreis, dem schwer zu entkommen ist. Schon Kinder entsprechen oft unwillkürlich den schlechten Meinungen, die Lehrkräfte von ihnen haben, was diese Zuschreibungen wiederum bestärkt.
Zur Person
Stephan Moebius ist Professor für Soziologische Theorie und Ideengeschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz. 2011 gab er zum Thema Symbolische Gewalt mit Angelika Wetterer ein Schwerpunktheft der Österreichischen Zeitschrift für Soziologie heraus
Wenn sich diese Kinder und Jugendlichen auf diese Weise auch selbst eliminieren, dann hatten sie aber doch eine Chance?
Man kann einfach nicht über die Verteilung von Chancen auf einer so individuellen Ebene diskutieren, denn das ist ein gesellschaftlicher Prozess mit einer Struktur. Empirisch ist Chancengleichheit eine Illusion. So heißt übrigens schon die bildungssoziologische Studie Bourdieus aus den 1970ern. Bis heute sind für „akademische“ Kinder die Chancen zigfach höher, an eine Uni zu kommen und dort Erfolg zu haben. Es sind nicht alle „ihres Glückes Schmied“. Das ist Ideologie, denn wir leben nicht in einer herrschaftsfreien Gesellschaft, in der es egal wäre, woher man kommt.
Diese unwillkürliche Mitwirkung an der eigenen Unterordnung, die sich auch gegen das eigene „Interesse“ richten kann, das ist doch frappierend. Die Menschen wollen dann sozusagen, was sie sollen. Wo kommt das her?

Bourdieu nennt den Effekt, der bewirkt, dass die Beherrschten an ihrer Beherrschung mitwirken, „symbolische Herrschaft“ oder „Amor Fati“, also „Liebe zum Schicksal“. Wir wachsen so selbstverständlich mit bestimmten Sinnzusammenhängen sowie Denk- und Wahrnehmungsweisen auf, dass wir mit den uns darin zugewiesenen Rollen und Identitäten oft leidenschaftlich verhaftet sind. Und gar nicht mehr merken, welche sozialen Hierarchien da mitschwingen. Die Begabungsideologie ist eine solche Naturalisierung, oder auch das vorherrschende Geschlechterverhältnis. Symbolische Herrschaft beruht darauf, dass Herrschende und Beherrschte sich selbst, ihre Umwelt und so weiter nach den gleichen Kriterien wahrnehmen und beurteilen. Wie eben bei den erwähnten Jugendlichen und ihren Vorbehalten gegen „Schreibtischjobs“. Und solange es da keine Reibungen gibt, fühlt sich die Welt „in Ordnung“ an. So wird Herrschaft fast unbemerkbar und lässt sich kaum anzweifeln.
Aber wenn das alles so tief sitzt, wie kann uns das überhaupt bewusst werden?
Manchmal lüftet sich der Schleier ein wenig. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein Chef ganz offenbar willkürlich seine Macht ausnutzt oder, was das Geschlechterverhältnis angeht, etwa durch offene Akte von Sexismus.
Also wenn dieses geteilte Gefühl der „geordneten Welt“ gröblich verletzt wird ...
... Soziologisch muss man hier Herrschaft, Macht und Gewalt unterscheiden. Bourdieu hat das nicht systematisch getan, aber mein Bremer Kollege und Freund Lothar Peter. Er sagt: Herrschaft ist ein „gesellschaftlich institutionalisiertes Über- und Unterordnungsverhältnis“, das auf ungleichem Ressourcenzugang beruht. Macht ist das Vermögen, Ressourcen für sich einzusetzen, und Gewalt ist der Modus, „durch den und in dem sich Macht konkret realisiert“. Während Herrschaft immer mit Macht verbunden ist, kann Macht auch gegen Herrschaft eingesetzt werden. Der sexistische Akt ist also symbolische Gewalt, offener Ausdruck von symbolischer Herrschaft. Wenn nun ein solcher Fall in der Gesellschaft tatsächlich als eben sexistisch erkannt wird – und nicht etwa nur als Ausfluss eines „kranken Hirns“ –, dann wird klar, dass es Sexismus gibt, als ein gesellschaftliches Verhältnis und nicht als individuelle Pathologie. Das wäre dann schon ein Aufklärungsschritt. Wird ein solcher Akt hingegen nicht als sexistisch erkannt, dann „trägt“ hier die symbolische Herrschaft.
Konservative – auch Frauen – würden nun einwenden: Unser traditionelles Familienleben steht weder auf demselben Blatt wie sexistische Übergriffe, noch hat es etwas mit Beherrschung zu tun. Wir haben uns dafür entschieden, respektiert das bitte! Sprechen Sie solchen Leuten nicht ihre Entscheidungen ab? Wo bleibt der freie Wille?
Einen völlig freien Willen gibt es nicht. Das ist die Analyse Bourdieus, die ich auch teile. Es gibt gewisse Spielräume in der habituellen Disposition und durch den nie endenden Sozialisationsprozess. Das festzustellen heißt nicht, jemandem Entscheidungen abzusprechen. Aber es gibt keine Entscheidungen in einem völlig luftleeren Raum – und nur dann wären sie ja absolut frei. Der freie Wille ist eine Ideologie.
Sprechen wir noch einmal über Klassen, Bildung und „Vererbung“: Die einen erben sehr oft den Komplex, sich diese nicht zuzutrauen, die anderen eine spielerische Vertrautheit mit „legitimer Kultur“ und deren Inhalten. Was aber soll man dagegen tun? Goethe und Schiller aus dem Lehrplan streichen?
Das will ich damit nicht sagen. Es lassen sich weiter gute und schlechte Kulturgüter unterscheiden. Die Schulen müssten sich aber soziologisch bilden und die Lehrkörper für Macht- und Herrschaftseffekte sensibler werden. Pierre Bourdieu nannte das eine mit soziologischem Wissen fundierte „rationale Pädagogik“.
Aber überfordert diese Erwartung, für sozialen Ausgleich zu sorgen, die Bildungseinrichtungen nicht? Der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth sagte erst jüngst in einem Interview mit der „Zeit“, man solle diesbezüglich bloß „die Schulen in Ruhe“ lassen.
Ich gebe Herrn Tenorth da auch vollkommen recht. Die Schule kann nicht auffangen, was gesamtgesellschaftlich schiefläuft. Die Lehrkräfte sind jetzt schon am Limit. Rationale Pädagogik ist nur ein Mosaikstein in einem größeren gesellschaftlichen Ganzen. Wie Tenorth sagt, löst Bildung allein kein gesellschaftliches Problem, auch und gerade nicht „den Umbau der Sozialstruktur“. Dafür müssten sich, wie er ganz richtig feststellt, „Macht- und Vermögensverhältnisse ändern“.
Vielleicht stehen die Schulen dabei deshalb immer so sehr im Fokus, weil sich an ihnen das kollektive Klassenschicksal in den individuellen Biografien realisiert. Auch die Debatte über „Klassismus“, die jüngst aufkam, macht sich stark an Benachteiligungen in Bildungsinstitutionen fest. Steigt in Zusammenhang mit diesen Debatten eigentlich die Theorie-Nachfrage nach Bourdieu?
In den Feuilleton-Debatten, die ich verfolge, spielt er kaum eine Rolle. Leider. Denn Bourdieu wäre ein wichtiger Stichwortgeber. Er macht ja sehr detailliert klar, wie sehr unsere Art und Weise, uns in der Welt zu orientieren, Klassencharakter hat und vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Strukturen zu sehen ist. Gerade deswegen wäre er aber skeptisch gegenüber einer Richtung, die dieser Diskurs nimmt oder nehmen kann.
Was meinen Sie, womit hätte Bourdieu hier ein Problem?
Ich sehe eine individualisierende und identitätspolitische Tendenz, in der persönliche Einstellungen und Kämpfe um Anerkennung im Vordergrund stehen, in der Positionen festgeschrieben werden, ohne dass die gesellschaftlichen Strukturen als wirkliche Bedingung zur Sprache kommen. Wenn aber Politik zu stark zur „Arbeit an sich selbst“ wird, läuft man quasi Gefahr, den herrschenden Zwang zur Selbstoptimierung auf einer Ebene von Politik und Moral fortzuschreiben. Man kann sich und andere auf diese Art schnell erschöpfen. Sich individuell nicht rassistisch oder sexistisch verhalten zu wollen oder einen klimaneutralen Lebensstil anzustreben, das ist natürlich richtig. Aber das „Anfangen bei sich selbst“ darf nicht den Blick auf die dahinterliegenden strukturellen Bedingungen von Herrschaft verdecken. Die Individualisierung gesellschaftlicher Herrschaft grenzt auch an den Diskurs der „Selbstverantwortung“, der seinerseits Ausdruck symbolischer Herrschaft ist. Und diese ist ja ein kollektiver Prozess. Analytisch ist man hiermit schon wieder bei Bourdieu.