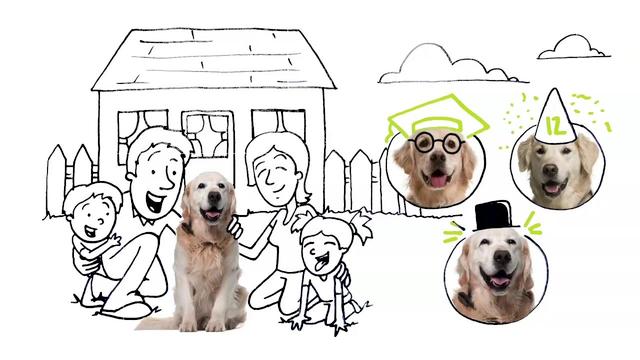Jetzt schlafen! Sechs Stunden Zeit, bis der Kleine aufwacht. Wenn’s gut läuft. Wenn er nicht nachts schreit. Dann sind es nur vier Stunden. Aber nur, wenn ich jetzt auch endlich schlafe. Sonst wird die Arbeit morgen wieder so anstrengend. Ich brauche Schlaf. Fünf Stunden und fünfzig Minuten noch.
So oder so ähnlich lag Hannah* im Bett, eines Abends im Dezember, nach neun Monaten Pandemie. Seit Wochen arbeitete die 30-Jährige täglich an einem Projekt für ein Architekturbüro, in der Zeit, die ihr der einjährige Sohn ließ – und sie umsorgte ihren Sohn, in der Zeit, die das Projekt ließ. Übrig blieben von 24 dann noch sechs Stunden. Der Pandemie-Takt: Aufstehen, Kind versorgen, arbeiten, Kind versorgen, arbeiten, und vom Computer direkt ins Bett. Es war an jenem Abend im Dezember, als Hannahs Körper entschied, dass damit jetzt Schluss war. „Als ob sich jemand auf meine Brust setzte“, sagt sie. „Ich konnte nicht mehr atmen. Keine Luft mehr. Mir war schwindelig. Ich war panisch.“
Am Anfang: Luxusprobleme
Stress, Angst, Überforderung: Diese Gefühle sind vielen Menschen in der Krise nicht fremd. Nach einem Jahr Pandemie zeigt sich, welche psychischen Spuren sie hinterlässt. „Corona kommt in Praxen an“, vermeldete im Februar die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung. Einer Umfrage unter Psychotherapeut*innen zufolge sind die Anfragen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Bei Jugendtherapeut*innen sind es sogar 60 Prozent. Parallel zur Auslastung der Corona-Stationen füllen sich die psychotherapeutischen Praxen und Psychiatrien. Nur rollt diese Welle still.
Am Anfang ging es Hannah und ihrem Partner Simon* noch ganz gut. Okay, sie wollten eigentlich reisen in ihrer Elternzeit, Levin* war acht Monate alt, als es mit der Pandemie losging, und das ging nicht mehr – „Luxusprobleme“, zuckt Hannah mit den Schultern. Dann kam der Arbeitseinstieg nach der Elternzeit, die Architektin bekam ihr eigenes Projekt, 30 Stunden plus Kleinkind, das war schon anstrengender – und nach zwei Wochen direkt in die Kurzarbeit, weniger Gehalt. Simon erging es nicht besser, er ist Musiker. „Da fiel einiges an Gehalt weg, wir mussten mit viel weniger Geld klarkommen plötzlich.“ Das stresste, „aber okay“.
Dann kam es zu einem Trauerfall. Ein Freund brachte sich um. „Und keine Umarmungen“, sagt Hannah, „ich konnte kaum Freundinnen sehen.“ Für Trauer war aber ohnehin nicht viel Zeit, Arbeit, Kind, Pandemie. „Und ab Dezember ist die Kita weggefallen.“
Ihr Sohn Levin guckt seine Mutter mit großen Augen an, wenn Hannah das sagt, sie sitzt auf einer Bank auf einem Spielplatz in Berlin-Neukölln, und Simon wollte mit Levin spazieren, aber der wollte lieber auf Hannahs Schoß, und da sitzt er jetzt und guckt seine Mutter an. „Bälle!“, sagt er. Drei Monate ist Levin zur Kita gegangen, dann nicht mehr, „er weinte tagelang und verstand nicht, warum er da nicht mehr hindurfte“. Und das Arbeitsprojekt forderte mehr ein. Hannah machte Fehler, „die vielen Schusseligkeitsfehler“, sie schüttelt den Kopf, „die haben mir noch mehr Überstunden beschert, im Stress wurden es immer mehr“. Hannah hatte das Gefühl, keinen Erwartungen mehr gerecht zu werden: Bei der Arbeit war sie zu langsam, Levin war unzufrieden, und wie es Simon ging, wusste sie nicht, „ich habe ja überlegt, ihn zu fragen, wie es ihm geht, aber dann hätte ich wieder eine halbe Stunde Zeit für meine Arbeit verloren, also fragte ich lieber nicht“. Levin, Computer, Levin, Computer, Bett. Dort holte sie die Trauer ein, über den verstorbenen Freund. Und dann ging nichts mehr.
Nicht jede Belastungssituation führt zu einer psychischen Erkrankung. Über den Begriff der „Resilienz“, der individuellen Widerstandsfähigkeit, wird in der Pandemie viel diskutiert. Der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli weist darauf hin, dass diese bei jedem Menschen anders bemessen ist und unter anderem vom Charakter und vom sozialen Umfeld abhängt. Aber „jetzt wird ziemlich klar: Sowohl die psychischen als auch die wirtschaftlichen Ressourcen der Menschen brauchen sich auf“. Auch grundsätzlich resiliente Menschen ertragen nicht alles ewig. Das mache den Unterschied zu den ersten Monaten der Pandemie aus, mahnt Adli.
Die aufgebrauchten Ressourcen spiegeln sich direkt im Praxisalltag vieler behandelnder Psychotherapeut*innen wider. Ariadne Sartorius ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Frankfurt am Main. Eigentlich gehörte sie nicht zu denen, die der Meinung waren, es gäbe zu wenig Psychotherapeuten. „In Frankfurt waren wir bislang immer ganz gut aufgestellt. Aber durch Corona ist der Bedarf stark gestiegen.“ Üblicherweise kann sie zwei bis drei Wochen nach einem Anruf ein Erstgespräch vereinbaren, nach weiteren vier bis fünf Wochen sei dann die Diagnostik abgeschlossen und die Therapie könne beginnen. Aktuell ist sie für Monate ausgebucht, verweist Menschen an Kolleg*innen – und trifft Härtefall-Entscheidungen.
Die Therapeuten leiden selbst
„Ich triagiere, ganz massiv“, sagt sie. „Bislang wollte ich immer allen Patienten, bei denen ich eine psychische Störung sehe, zeitnah ein Behandlungsangebot machen. Im Augenblick muss ich mir die heraussuchen, bei denen ich weiß: Wenn ich die jetzt nicht als Nächste nehme, landen sie in der Klinik.“ Sie hält sich Notfalltermine frei und reduziert dafür regelmäßig geplante Behandlungen. Wer dieser Tage nach psychotherapeutischer Hilfe sucht, muss Glück haben – oder warten. Im Schnitt erhält eine psychotherapeutische Praxis aktuell fast sieben Anfragen pro Woche, im Vorjahr waren es noch knapp fünf. Mehr als ein Drittel der Anfragenden muss länger als ein halbes Jahr auf eine Therapie warten.

Hannah hatte Glück. „Simon lag neben mir, als ich meine erste Panikattacke bekam, und verstand sofort, was los war.“ Er ermutigte sie, einen Therapeuten zu kontaktieren – aber: Die winkten ab. „Keine Kapazitäten, hieß es immer, nicht einmal Zeit für ein Erstgespräch. Sie schickten mir nur Seiten mit neuen Adressen, und die hatten auch keine Zeit.“ Schließlich fand sie privat einen Therapeuten, einen Bekannten, über einen Freund. „Er hat seine Praxis in Brandenburg, aber er ließ sich auf drei Anfangsgespräche ein, und dann konnte er mir doch einen Platz einräumen, per Video.“ Hannahs Augen leuchten noch immer, wenn sie das erzählt. „Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gefreut habe wie nach dieser Nachricht: Da nimmt sich jemand einmal die Woche Zeit, um mit mir über meine Probleme zu sprechen!“
Doch nicht jeder hat einen Therapeuten in seinem sozialen Umfeld, geschweige denn Freundinnen oder Familie, die die Suche nach psychologischer Hilfe selbstverständlich finden oder unterstützen. Eine Suche, die derzeit nicht Wochen, sondern Monate dauern kann. Die Situation sei so angespannt, dass auch die Therapeuten selbst darunter leiden, sagt Gebhard Hentschel von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung: „Die Praxen unserer Mitglieder werden förmlich überrannt. Für Psychotherapeut*innen ist es bedrückend, dass sie nicht jedem eine Therapie anbieten können.“
Der ungedeckte Bedarf an Psychotherapie werde die Gesellschaft noch lange beschäftigen, da ist sich die Psychotherapeutin Ariadne Sartorius sicher. Viele Krankheitsbilder wie Depressionen oder Angststörungen seien nicht schnell austherapiert, sondern könnten, sofern sie rezidiv, also wiederkehrend sind, erneut behandlungsbedürftig werden. „Ich spreche da nicht von Monaten, ich spreche von Jahren.“
Und dann auch noch Corona
Und dann gibt es ja auch noch das Virus selbst. Es war im März, als Hannah sich so erschöpft fühlte, dass sie sich krankschreiben ließ. „Ich dachte, es wäre nun endgültig Burn-out, aber der Arzt machte zur Sicherheit einen Test – und es war tatsächlich Corona.“ Sie litt unter starken Gedächtnisstörungen, Schwindel, Gliederschmerzen. Nun musste die Familie in Quarantäne, gleichzeitig waren Simons Knie kaputt, und Levin durfte gar nicht mehr raus. Sechs Wochen war Hannah krankgeschrieben. „Ich habe aber schon früher wieder gearbeitet“, sagt sie. „Mein Projekt stand ja in der ganzen Zeit still. Ich habe dem Druck nicht standgehalten, ich habe zu schnell wieder gearbeitet. Nach außen war nicht sichtbar, dass es mir schlecht ging, ich kam mir bescheuert vor, die ganze Zeit nicht zu arbeiten.“
Insbesondere bei Kindern sehen Psychologinnen noch eine andere Gefahr. „Ein Großteil der psychischen Erkrankungen entsteht im Kindes- und Jugendalter“, mahnt Sartorius, und diese Probleme fielen im Augenblick kaum auf, „weil die sich sowieso alle zurückziehen und sich in ihrem Zimmer einsperren. Was machen Sie, wenn Sie ein 16-Jähriger sind, der genervt von seinen Eltern ist? Sie machen die Nacht zum Tag. Nachts zocken, wenn Sie Ihre Ruhe haben, und tagsüber schlafen, damit Sie in Ruhe gelassen werden.“
Der Umfrage zufolge erhält zudem nur eines von drei Kindern nach einer Anfrage für eine Therapie ein Erstgespräch. Wenn Störungen im Jugendalter aber nicht behandelt werden, laufen sie Gefahr, sich zu „chronifizieren“, also schlimmstenfalls zum lebenslangen Begleiter zu werden. „Die, die sich solidarisch zu Hause einschließen, die wir letztes Jahr ohne Masken in die Schule geschickt haben, die als Letzte ihren Impfstoff kriegen“, seien dabei von ähnlichen Sorgen geplagt wie Erwachsene: Angst, jemanden anzustecken; Angst, selbst zu erkranken; Angst vor der Zukunft. „Die werden die nächsten 70 bis 80 Jahre mit den Folgen von Corona leben müssen, auch mit den wirtschaftlichen.“
So kann eine Sorge zum Dauerzustand werden, oder eine Angst zur Panik, insbesondere wenn sozialer Ausgleich fehlt – ein Sportverein, Freunde, Familie. Die Therapeutin meint: „Nicht nur im Bereich der Psychotherapie müssen wir unbedingt was tun, da muss auch gesellschaftlich etwas passieren.“
Hannahs Panikattacken sind zwar noch da, doch seltener. Ein Aufatmen gab es trotzdem nicht – denn dann ging es bei Simon los. „Ich habe plötzlich selbst Panik bekommen, ich konnte nur noch schlafen oder hatte Angst, tagelang, dann konnte ich nicht mehr, ich wusste einfach nicht mehr weiter, ich rief bei der Notaufnahme an und weinte und entschuldigte mich für mein Weinen und weinte weiter, nichts ging mehr.“ Simon ging ins Krankenhaus, bekam ein leichtes Beruhigungsmedikament und ein Notgespräch bei einem Psychologen. In zwei Wochen hat Simon dann einen Termin bei einem Therapeuten. „Es beruhigt, dass sich jemand um mich kümmert. Und dass es einen Ort gibt, an den man gehen kann, wenn nichts mehr geht.“
Während ihr Partner spricht, nickt Hannah leise. Sie will ihm Raum geben. „Wir waren nur noch mit unserem eigenen Kram beschäftigt“, sagen beide. „Wir konnten uns nicht mehr darum kümmern, wie es dem anderen geht, es gab fast keine Beziehung mehr.“ Immerhin konnten sie jetzt einen Platz in der Kita-Notbetreuung für Levin bekommen, wegen ihrer psychischen Probleme. „Und immerhin mache ich jetzt endlich mal eine Therapie“, sagt Simon. „Das hatte ich schon lange vor. Meine Probleme sind ja nicht durch die Pandemie entstanden, die hatte ich schon vorher.“ Hannah hält Levin davon ab, ein Stück Popcorn vom Boden zu essen. „Die Pandemie ist ein Katalysator“, sagt sie und steckt das Popcorn in die Jackentasche, „alles, was im Argen liegt, wird beschleunigt.“ Simon steckt Levin in den Kinderwagen. „Bälle“, sagt der. „Komm, wir müssen erst Masken kaufen“, sagt Hannah. „Und dann gehen wir auf den Markt, und dann wieder auf den Spielplatz.“
Info
* Namen geändert