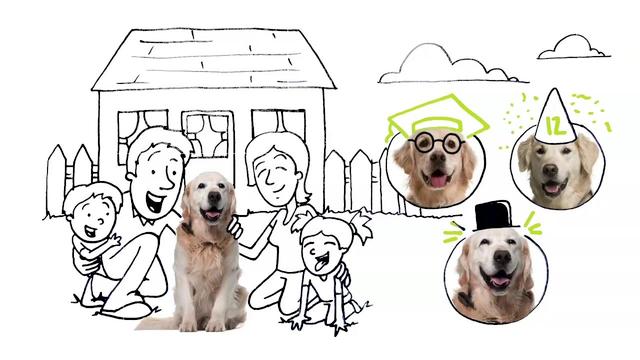Frau Diekmann, vor einem Jahr haben wir noch im direkten Kontakt mit anderen das neue Jahr eingeläutet. Heute sitzen wir vor einem Bildschirm, wenn wir uns zuprosten. Wie kommt es, dass wir uns so schnell an die neue virtuelle Normalität gewöhnt haben?Umsetzungsdruck, würde ich sagen. An der Universität war es so: Der Lockdown Mitte März kam knapp vier Wochen vor dem festgesetzten Semesterbeginn. Und die erste, nachvollziehbare Panikreaktion der Universitätsleitungen bestand darin, den Semesterbeginn um ein bis drei Wochen zu verschieben. Der Imperativ, der jedoch nie infrage gestellt wurde, war, dass das Semester beginnen muss. Dann eben digital.
Ich fand es sehr interessant und teilweise befremdlich zu beobachten, dass diese Entscheidung einen selbstverständlichen und stark eigendynamischen Umsetzungs- und Anpassungsdruck erzeugt hat. Das hat dazu geführt, dass sich alle in relativ kurzer Zeit mit der Nutzung verschiedener Plattformen und Streaming-Angebote vertraut gemacht haben, um dann mit relativ geringer Verspätung in das Semester zu starten. Diese Idee, dass es so schnell wie möglich weiter gehen muss, die hat sicher auch in anderen Arbeitsfeldern eine Rolle gespielt.
Digitalpolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz: Das Briefing zu Digitalisierung & KI. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO.
Jetzt kostenlos testen!
Der Treiber hinter dieser Entwicklung war also eher Zwang als Lust am Neuen.Ich glaube schon, dass in vielen Feldern sehr entschieden geschubst worden ist, damit sich die Nutzer mit den Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien vertraut machen. Die Lust kam bei vielen erst dann, als klar war, dass es zumindest grundlegend funktioniert: Es ist möglich, sich das anzueignen, und es geht mehr als gedacht.
Danach gab es auch eine Phase, in der die Technologien sehr enthusiastisch genutzt wurden, gerade in den Monaten April, Mai und Juni. Da hatten sich viele Nutzer mit der Technologie besser vertraut gemacht und suchten nach einem, wenn nicht kreativen, so doch zumindest erweiterten Umgang. Das ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Diese Entwicklung ist jedoch im Spätsommer von einer gewissen Ermüdung abgelöst worden. Diese drei Phasen lassen sich auf jeden Fall unterscheiden: eine gewisse Panik, eine interessierte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, und dann die derzeit sehr sicht- und hörbare Ermüdung.
Viele Menschen haben sich eigene virtuelle Meeting-Hintergründe gestaltet. Ist das ein Zeichen dafür, dass man die neuen Umstände annimmt und die eigene digitale Arbeitsumgebung so schön wie möglich gestalten will?Ich würde es auf der einen Seite aus der Sicht des Try-Outs sehen: Da wird ausprobiert und geschaut, welche Funktionen es gibt. Und ein Grundbestreben nach Originalität gibt es in Büroumgebungen ja fast immer. Es wird dann eben normalerweise über Postkarten mit Sprüchen, über Kaffeetassen oder Dinge auf dem Schreibtisch ausgedrückt. In diesem Fall waren es eben Hintergründe, deren echt eingeschränkte Originalität den Nutzer dann aber auch sehr früh aufgefallen ist.
Danach sind diese Hintergründe ja auch zu einem guten Stück wieder verschwunden. Wenn ich jetzt in Konferenzen gehe, sind die Hintergründe oft einfach monochrom. Oder die Personen haben sich in ihrer Wohnung die weiße Wand mit den guten Lichtverhältnissen gesucht, vor der sie sich jetzt platzieren, wenn sie online gehen.
Stefanie Diekmann, Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Universität Hildesheim
privat
Indem wir bei Videokonferenzen stundenlang für eine Teilöffentlichkeit live aus unseren Arbeitszimmern oder Küchen streamen, geben wir auch etwas sehr Privates von uns preis. Wie konnte es passieren, dass wir so schnell dazu bereit waren – obwohl Datenschutz in Deutschland sonst so ein großes Thema ist?Eine sehr gängige Theorie ist, dass Social Media das ein Stück weit vorbereitet hat: Es gibt schon relativ lange eine Kultur der bildförmigen Selbstveröffentlichung. Allerdings erfolgen Social-Media-Aktivitäten weitaus dosierter und auch kontrollierter. Wenn man sich selbst auf der Kachel einer Videokonferenz zeigt und mit Interagieren beschäftigt ist, dann kann erst einmal alles Mögliche im Hintergrund erscheinen und ablaufen. Das gehört dann eher zu der Kategorie der unfreiwilligen Selbstveröffentlichung.
Gab es eine Phase, in der wir uns der neuen Rolle als Streamende gar nicht bewusst waren?Ich habe mich selbst mit der Reaktionsbildung auf diese neue Situation beschäftigt: Also die vielen Bücherregale, die zwischenzeitlich im Hintergrund zu sehen waren, als wären die Nutzer davor sicher geparkt. Auch die Versuche, Arbeitsumgebungen abzuschirmen, um unkontrollierbares Hintergrundgeschehen zu verhindern. Aber mein Eindruck war schon, dass es eine gewisse Latenzphase gab, bis den Personen klar geworden ist, dass dies eine Form der Selbstveröffentlichung ist, die deutlich weniger kontrollierbar ist als Social Media, gerade weil sie sich über so lange Zeiträume erstreckt. Wir saßen ja zum Teil stundenlang in diesen Videokonferenzen, auf die man doch mehr aufpassen muss, und die doch einen stärkeren Entblößungscharakter hatten als Formen, die bereits erprobt waren.
Hat es damit zu tun, dass Videokonferenzen eine scheinbar flüchtige Form der Selbstveröffentlichung sind? Anders als auf Facebook oder Instagram gibt es ja nicht immer eine Aufzeichnung, die wir später betrachten können.Es wäre schön, wenn es flüchtig wäre. Als Unidozentin sitze ich sehr regelmäßig mit denselben Personen zu den gleichen Terminen in denselben Gruppen. Auch wenn das kein Endlosschema ist, stellt sich die gleiche Konstellation wieder und wieder her. Das bedeutet einerseits Druck, ist aber auf der anderen Seite auch eine Chance, weil man Korrekturen vornehmen kann. Will ich das nächste Mal wieder vor der gleichen Kulisse sitzen? Oder ändere ich den Ort? Spannend ist auch: Die sehr jungen Studierenden, mit denen ich zu tun habe, weigern sich fast durchweg, ihre Webcams bei digitalen Seminaren einzuschalten.
Und dann ist da noch der Datenschutz. Zoom ist ja mittlerweile zu einer Chiffre für Videokonferenzen geworden, so wie Tempo für Papiertaschentücher. Die Uni Hildesheim hat sehr schnell eine Anwendung weiterentwickelt, um eine eigene Konferenzumgebung anbieten zu können, die dann auch datensicher ist. Obwohl es damit noch technische Probleme gibt – die Verbindung ist nicht so stabil, es können nur eine begrenzte Zahl von Cams zugeschaltet werden – hat eine große Mehrheit der Studierenden dafür gestimmt, diese datensichere Umgebung zu nutzen statt Zoom.
[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]
Der jungen Generation wird ja oft unterstellt, dass sie nicht so viel Wert auf Datenschutz lege und sich in den sozialen Netzwerken entblößen würde. Woher kommt der sehr bewusste Umgang mit Videokonferenzen?Über die Social-Media-Nutzung, in der diese Generation tatsächlich viel versierter ist als die älteren Jahrgänge, ist eine gewisse Kompetenz aufgebaut worden. Das macht sie reservierter. Und ich glaube schon, dass gerade Studierende, die sich mit einer gewissen Vorsicht innerhalb ihrer Peergroups bewegen, dann doch noch einmal überlegt haben, wie viel sie überhaupt aus ihrem Alltagsleben zeigen wollten. Hinzu kommt auch, dass jüngere Menschen in deutlich beengteren Verhältnissen leben als Berufstätige, die sich auch mal überlegen können, wo sie sich in ihrer Wohnung hinsetzen wollen.
Viele fragen sich, welche digitalen Neuerungen nach der Pandemie noch bleiben werden. Sind Videokonferenzen eine Übergangstechnologie, um die Zeit der Pandemie zu überbrücken, oder ist das etwas, was unser Arbeitsleben so nachhaltig verändert hat, dass die Menschen darauf nicht mehr verzichten wollen?Das Idealszenario wäre aus meiner Sicht eine weniger umfassende Nutzung, die aber nicht komplett beendet wird, weil sie in vielen Fällen ja auch Sinn macht. Denken wir nur an die vielen Flugreisen, die dadurch entfallen, und die wir uns ja wirklich sparen können. Ich wäre durchaus zu haben für eine Fortsetzung von Videokonferenzen, wenn es um punktuelle Sitzungen geht und nicht um regelmäßig wiederkehrende Termine. Da wäre es ein echter Gewinn.
Was lässt sich online nicht darstellen, was live darstellbar gewesen wäre?Es gibt ja im Zuge der Gespräche über Onlinekonferenzen ein solides Halbwissen, das wir uns alle über Kommunikation aufgebaut haben: zum Beispiel, dass das ganze körpersprachliche, nonverbale Register entfallen würde, und dass dies zu einer besonderen Stresssituation in der Kachelkommunikation einer Videokonferenz führt. Das kann ich schon nachvollziehen, ich merke auch, dass ich anders aus einem digital abgehaltenen Seminar herausgehe als aus einem, das live stattgefunden hat. Da ist eine gewisse Überfokussierung und damit einhergehend auch eine spezifische Anstrengung. Und auch das Gespür für das Atmosphärische fehlt.
Etwas Positives lässt sich aber auch über Videokonferenzen sagen: Sie sind ziemlich effektiv und ziemlich schnell, weil sich niemand mehr zu lange in diesen Konstellationen aufhalten will. Die weitschweifigen Auftritte, die endlosen Wortbeiträge und die blöden Späßchen, die alles aufhalten – die entfallen weitgehend. Und das ist gar nicht so schlecht.
Streit um Steuerpauschale für das Homeoffice
„Ich kann dem Verkäufer nicht erklären, warum er leer ausgeht“
Stefanie Diekmann ist Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Universität Hildesheim. Dort leitet sie das Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur.