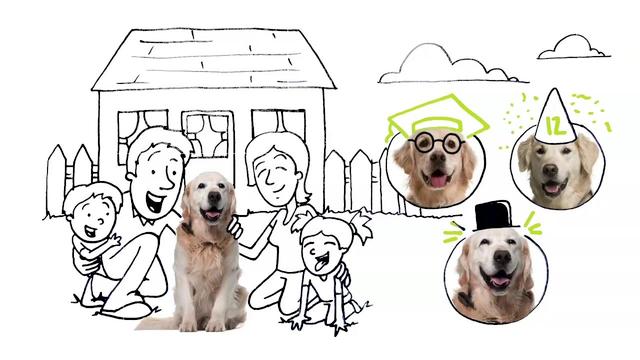Die Katze Luzie – „gleich macht sie wieder Musik, Rock’n Rollig“ (Photo: Katrin Eissing)
1. In Aristophanes Komödie „Die Vögel“ ( 414 v. Chr.) fliehen zwei Athener vor Gläubigern und Demagogen aus ihrer korrupten Heimatstadt. ‚Geführt von einer Krähe und einer Dohle gelangen sie ins Reich der Vögel, wo sie zunächst als Menschen, d.h. Vogelfänger und -töter, von der gesamten Vogelschar angegriffen werden. Aber dann gelingt es ihnen in Verhandlungen, dass man sie akzeptiert und schließlich, dass sie Führer einer gemeinsame Zukunft werden, was in einem Fiasko endet. „Die Komödie ‚Die Vögel‘ ist einem angesichts der herrschenden Verhältnisse tief empfundenen Ekel geschuldet. Und gleichzeitig gelingt diesem großartigen Dichter etwas unerhört Neues: die Utopie eines herrschaftsfreien Raums; die Fantasie einer Gesellschaft der Freien und Gleichen,“ findet die „Theater-AG“ des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bergzabern. „Aristophanes geht es in seiner Komödie ‚Die Vögel‘ im Wesentlichen um die negative Beeinflussung stupider, verbohrter und/oder unbedarfter Massen,“ heißt es dagegen auf „allgemeinwissen.de“. Die Vögel sind also hier die Dummen.
.
Ganz anders in der Kurzgeschichte „Die Vögel“ (1952) von Daphne du Maurier: Ein englischer Landarbeiter bemerkt, dass sich die See- und Landvögel immer aggressiver verhalten. Er vermutet bald, dass hinter ihrer scheinbar zufälligen Schwarmbildung eine Art kollektive Intelligenz steckt.
.
Während die Frankfurter Kulturwissenschaftlerin Eva Horn der „Schwarmintelligenz“ (2009) nur Positives abgewinnt, sieht der englische Landarbeiter darin eine zunehmende Gefahr und fängt an, seine Hütte zu befestigen. Aus dem Radio erfährt er von ähnlichen Vorgängen im ganzen Land. Nachdem alle Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen und die benachbarten Bauern durch Attacken der Vögel umgekommen sind, entwirft der Landarbeiter für sich und seine Familie einen Überlebensplan.
.
Die Katze Luzie im Gegenlicht. Photo: Katrin Eissing
.
Die Erzählung „Die Vögel“ endet ebenso offen wie der Film „Die Vögel“, den Alfred Hitchcock 1963 daraus machte. Er verwendete daneben noch zwei Realereignisse – eine aus dem kalifornischen „La Jolla“: Dort war ein ganzer Schwarm Spatzen durch den Kamin in ein Haus eingedrungen. Während der Vorbereitungen für den Film kam es in der nahen Küstenstadt Capitola zu einem weiteren Vorfall: Hunderte „Dunkler Sturmtaucher“ (aus der Familie der „Sturmvögel“) flogen gegen Hausdächer, zerbrachen Fenster und durchtrennten Stromleitungen. Im Film wurde darauf bezug genommen – mit einem Dialog zwischen einer Ornithologin und einem Handelsvertreter in einem Restaurant.
.
Jahrzehnte später stellte sich laut Wikipedia heraus, dass die Tiere von Domoinsäure, einem von Kieselalgen der Gattung Pseudo-nitzschia produzierten Nervengift, befallen waren. 1991 wurde in Monterey Bay ein ähnliches Massensterben von Braunpelikanen beobachtet, was auf die Toxine einer seltenen Algenblüte zurückgeführt werden konnte. Ein Zusammenhang zwischen den beiden „natürlichen“ Massenvergiftungen in derselben Gegend wurde aber erst im Dezember 2011 im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung nachgewiesen.“
.
Dem Regisseur Francois Truffaut erzählte Hitchcock später, Raben hätten Lämmer angegriffen und einem Farmer die Augen ausgehackt. Tatsächlich können Rabenvögel aber keine Leichen „aufbrechen“. Wenn kein Wolf oder Fuchs kommt, der dies übernimmt, müssen sie sich mit Augen und Zunge zufrieden geben. Das taten sie auch bei den im Mittelalter Gehenkten, weswegen man sie „Galgenvögel“ nannte, die allerhand Unglück bringen sollten. Auch auf den Schlachtfeldern machten sie sich nützlich. In seinem Gedicht „Die Raben“ (1920) läßt Karl Kraus sie sagen: „Immer waren unsre Nahrung/ die hier, die um Ehre starben.“ Der Nazi-Bestsellerautor Erich Edwin Dwinger erwähnt in seinem Roman „Zwischen Weiß und Rot“ (1930), wie die schwarzen Vögel in Sibirien über seine zusammengebrochenen Kameraden herfielen. Er befand sich in der sich auflösenden Armee des Weißen Generals Koltschak auf der Flucht nach Wladiwostok, als die Roten Partisanen ihn auf dem zugefrorenen Baikalsee gefangen nahmen. Seine Bücher wurden unlängst in Österreich neu aufgelegt und in der FAZ unter dem Titel „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft“ ganzseitig rezensiert.
.
In vielen Filmen wird inzwischen nahendes Grauen mit Rabengekrächze untermalt. In E.A.Poes Gedicht „Das Rabe“ ist es bereits sein Name: „Nimmermehr“, den der Vogel so lange wiederholt, bis die Seele des Icherzählers sich nimmermehr erhebt. Wie man aus vielen Berichten von Rabenbesitzern inzwischen weiß, können sie nicht nur Worte nachsprechen, sondern sie auch situationsgerecht einsetzen. Im übrigen ist ihre tricksterhafte Bosheit uralt: Im alten Testament galt der Rabe als unreines Wesen, als Inkarnation des Bösen und des Teufels. Einst entsandte Noah den Raben, um nach trockenem Land zu suchen, doch der Rabe fand einen Tierkadaver und ergötzte sich an diesem. Er kam nicht zurück und Noah verfluchte ihn und entsandte die Taube, die mit dem Ölzweig wiederkehrte. Im jüdischen Glauben sind Raben aufgrund dessen schwarz geworden. Auch war es Gott gewesen, der den Rabenvögeln die Singstimme nahm und sie somit kreischen und krächzen mussten, als Strafe für ihre Untugend, wie der Ornithologe Josef Reichholf in seinem Buch „Rabenschwarze Intelligenz“ (2009) schreibt. Hitchcocks Hauptdarstellerin in „Die Vögel“, Tippi Hedre, ließ und läßt sich von diesen ganzen Geschichten anscheinend nicht beeindrucken. „Die Welt“ berichtete Ende 2015: „‚Die Vögel‘-Star Tippi Hedren lebt mit vielen Raben“ – auf ihrer Ranch in Kalifornien. Der Anblick der Vogelschar erinnere sie ein wenig an die Dreharbeiten 1963. „Der Unterschied ist: Sie greifen nicht an.“
.
Raben und Krähen sind „Kulturfolger“ und nicht nur Aasvertilger, sondern „Allesfresser“. „Das Film-Team verbrachte damals drei Tage an einer Mülldeponie in San Francisco und drehte dort über 6000 Meter Film,“ heißt es auf Wikipedia. Ray Berwick, Hollywoods berühmtester Tiertrainer, übernahm die Arbeit mit den Vögeln am Filmset (unter der Aufsicht von Vertretern der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Er arbeitete überwiegend mit Raben und Krähen, die sich wegen ihrer Intelligenz besonders gut dressieren lassen, wie er meinte. Inzwischen haben tausende von Intelligenz-Tests und -Experimente bewiesen, dass Raben und Krähen mindestens so intelligent wie Primaten sind. Auch neigen unverpaarte Vögel dazu, beim Auffinden eines aufgebrochenen Kadavers ihren Schwarm zu Hilfe zu rufen. Aber noch nie haben sie sich kollektiv gegen den gefürchteten Menschen verschworen, im Gegenteil, bei den Indianern, Eskimos und anderen Jägervölkern kooperierten sie sogar.
.
So wie die Ornithologin in dem Film davon überzeugt war, dass den Vögeln das geistige Potential fehlt, Angriffe mit destruktiven Beweggründen zu führen, ist sich auch heute noch der Harvard-Neurologe Marc Hauser sicher, Tiere sind generell nicht in der Lage, sich zu einem (Sklaven-) Aufstand gegen die Menschen zusammenzurotten. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, schreibt er in seinem Buch „Wild Minds“.
.
Fakt ist aber, „je länger der Film andauert, desto größere, schwärzere und desto mehr Vögel kommen ins Bild,“ wie ein Hitchcock-Verehrer bemerkte. Der Dramatiker Heiner Müller rätselte: Die Bedrohung durch die Vögel könnte ein Symbol für die „Rebellion der Natur“ sein, die der Mensch „ohne Rücksicht auf seine Zukunft als Gattungswesen verwüstet... Vielleicht geht es letztlich nur noch darum, wer zuerst mit wem fertig wird, die Natur mit der Menschheit oder die Menschheit mit der Natur...“ In seiner „Bildbeschreibung“ (1985) notierte Heiner Müller – zur klammheimlichen Freude der militanten Naturschützer: „Sturzflug des Vogels, Landung auf dem Schädeldach des Mannes, zwei Schnabelhiebe rechts und links, Taumel und Gebrüll des Blinden.“ Zwar arbeiten so ziemlich alle Ornithologen und Bird-Watcher dieser Mär aufklärerisch entgegen, aber nach wie vor sind viele Bauern fest davon überzeugt, dass Rabenvögel gelegentlich Schafe und Kälber auf diese Weise töten, und die netten kleinen Singvögel sowie Eichhörnchen und Ziesel sowieso. Die in die Städte gezogenen Rabenvögel haben es dagegen angeblich vor allem auf das Symbol des Friedens – die Tauben – abgesehen, deren langsames Weniger-Werden jedoch keinen betrübt.
.
„Komisch, in letzter Zeit gibt es nicht nur immer mehr Bücher mit Tiernamen im Titel oder mit einem Tierbild auf dem Umschlag,mindestens in Berlin häufen sich auch die Plakate mit Tieren für Musikveranstaltungen,“ so Peter Berz, der dieses und die folgenden Poster abphotographierte.
.
2.
Raben haben viele Verächter unter den Menschen, und sei es nur wegen ihres Geschreis. Es gibt aber auch mehr Leute als man denkt im singvogelvernarrten Berlin, die den Rabenvögeln helfen und sie gegebenenfalls großziehen. Einige haben daraus fast einen Beruf gemacht, u.a. Tierärztinnen. Daneben wirken hier mehrere Wissenschaftler, aber auch engagierte Amateurornithologen, die freilebende Rabenvögel erforschen. Mehrere habe ich besucht. Mein Eindruck ist, dass es mehr Rabenmütter als Rabenväter in Berlin gibt, meist leben sie am Stadtrand und haben einen großen Garten.
.
Gelegentlich bleibt eine Nebelkrähe oder ein Eichelhäher in ihren Volieren zurück, weil die Flügelfedern nicht richtig gewachsen oder sie anderweitig versehrt sind – ihren Lebensmut aber behalten haben. Der Eichelhäher der Lichterfelder Tierärztin Renate Lorenz lebt in ihren Praxisräumen. Er besaß überhaupt keine Federn, als er vor 15 Jahren zu ihr gebracht wurde. Er bekam dann eine Hormonkur – und daraufhin irgendwann ein schönes Federkleid. Mit dem schwang er sich nach draußen in die Luft. Aber die Hormonwirkung ließ irgendwann nach; heute lebt er wieder im Haus und geht zu Fuß. Schön und selbstbewußt ist er immer noch.
.
In den Praxisräumen leben vorübergehend auch noch etliche andere Tiere, sowie – auf Dauer – einige Hühner und ein Papagei. Oben in der Küche hält sich noch ein Spatz auf. Ebensolange wie er lebte im Haus noch eine Nebelkrähe namens „Hacki“. Sie hieß so, weil sie Renate Lorenz morgens vorsichtig ins Bein hackte, um sie zum Aufstehen zu bewegen. Die Tierärztin ist immer noch ein bißchen empört, dass Hacki beim endgültigen Wegfliegen nicht einmal Tschüß sagte. Draußen leben in zwei Volieren noch etliche Sittiche, kleine Singvögel und Tauben. Letztere fliegen tagsüber aus. Aber wegen des Fuchses schließt Renate Lorenz sie nachts ein. „Wenn eine zu spät kommt, muß sie draußen übernachten. Ich weiß nicht, wieviel ich habe.“
.
Die in Charlottenburg lebende Tiermedizinerin Almut Malone hat zwei Volieren für ihre Tauben, die sie zu gegebener Zeit im Schwarm in betreute Taubenschläge frei läßt. Sie können sich so den größeren Schwärmen, die es in der Stadt gibt, leichter anschließen, als wenn sie es alleine versuchen müßten. Almut Malone hilft in verschiedenen Bezirken Taubenschläge einzurichten, wenn dort über die „Taubenplage“ geklagt wird, wie zuletzt am Bahnhof Zoo. In den Schlägen läßt sich die Vermehrung regulieren – u.a. indem man den brütenden Tauben Gipseier unterschiebt. Lange Zeit wurden auf den Bahnhöfen „Spikes“ angebracht, um die Vögel fern zu halten, doch schon bald bauten sie ihr Nest darauf. Daneben nimmt Almut Malone zu Hause kranke oder junge Tauben an; sobald sie halbwegs gesund oder flügge sind, kommen sie in ihre Volieren. Tauben ziehen ihre Jungen nicht mit Insekten oder Fleisch auf, sondern mit ihrer „Kropfmilch“ und Getreide. Um verwaiste Taubenküken zu ernähren, mußte die Veterinärin künstliche Kropfmilch entwickeln, was ihr auch gelang. In ihrer dritten Voliere, die nach oben offen ist, befanden sich Schnepfen. Sie sind längst ausgeflogen. In der vierten Voliere, der größten, leben zehn junge Nebelkrähen und zwei ältere, die flugunfähig sind – es wohl auch bleiben; Almut Malone vermutet aufgrund einer Mangelernährung als Nestlinge.
.
Sie hat beobachtet: Die Nebelkrähen, die im Winter in Berlin leben, kommen aus dem Osten und sind deutlich größer, während die hier lebenden nach Süden abwandern, es sind Strichvögel, im Frühjahr fliegen beide Populationen wieder zurück. Ich kenne zwei Nebelkrähenpaare, in Kreuzberg und in Pankow, die in der Nähe ihres Reviers, in dem sie brüten, auch über Winter bleiben – jedenfalls in diesem.
.
Almut Malone, die sich bereits als Studentin um eine junge Rabenkrähe kümmerte, die sie zunächst stündlich füttern mußte, zieht heute auch noch alle anderen verwaisten oder verletzten Vögel auf. Manchmal gelingt es ihr, ein Vogeljunges einfach einem anderen Brutpaar ins Nest zu legen. „Wenn der Altersunterschied zu deren Jungen nicht allzu groß ist, füttern sie es mit. Bei Tauben ist das ganz einfach. Ein Grünfinken-Nestling läßt sich z.B. in einem Spatzen-Nest unterbringen, ein kleiner Spatz jedoch nicht im Nest von Grünfinken, weil deren Junge (wie auch die von Rabenvögeln) alle rote Rachen haben, Spatzen-Nestlinge haben gelbe Rachen, weswegen sie von Finken nicht mitgefüttert werden.“
.
Die Tierärztin Renate Lorenz hat zwei Praxishelferinnen und arbeitet mit einem Chirurgen zusammen; die Tierärztin Almut Malone kooperiert mit der „Vogelpraxis“ von Sonja Kling in Charlottenburg, außerdem nimmt die in Spandau lebende Renate Sypitzki Elstern und Eichelhäher auf. Sie hat in ihrer Voliere zur Zeit aber nur noch einen Kolkraben, der kaputte Füße hat. Die Nachbarn haben ihr Ärger gemacht, weil ihnen das Gekrächze der Vögel zu viel wurde. Bis vor kurzem besaß sie auch noch zwei beige-weiße Nebelkrähen. Es waren keine Albinos, sie konnten mithin gut sehen, aber dennoch nicht in die Freiheit entlassen werden, weil sie mit ihrem auffälligen Federkleid sofort zur Beute von Greifvögeln geworden wären. Dann starb jedoch die eine und die andere flog weg und kam nicht wieder.
.
Über Renate Lorenz und ihre vielen Tiere hat die Journalistin Rosa Bunt ein Buch geschrieben: „Tierisch drauf!“ Ein zweites ist in Vorbereitung; vom Tagesspiegel wurde sie „Dr.Dolittle“ genannt. Almut Malone hat selbst eine Broschüre herausgegeben: „Grundlagen für den Umgang mit hilfsbedürftigen Wildvögeln“ sowie auf Englisch eine Biographie, fokussiert auf ihre Hinwendung zu Vögeln: „Free Like A Bird“. Mit ihrem gemeinnützigen „Avian Vogelschutz-Verein“ hat sie eine „Vogelklappe“ eingerichtet – für Leute, die mit ihrem „Findevogel“ nicht mehr weiter wissen. Dabei handelt es sich oft um Meisen, sie kommen bei ihr in eine extra Voliere, werden aber meist schon im Sommer wieder freigelassen.
.
Hinter der Berliner „Raben in Not“ Telefonnummer steht ebenfalls ein gemeinnütziger Verein. Er wurde 2009 von Jens Gruhle gegründet, der am Rande von Tempelhof mehrere Volieren hat. Der ehemalige Tierpfleger bekommt die Vögel von der Kleintierklinik der FU in Düppel, wo eine auf Wildvögel spezialisierte Ärztin arbeitet, sowie auch von der Station des Naturschutzbundes (NABU) in der Wuhlheide, wo die Volieren im Herbst geschlossen werden. Den Sinn seines Einsatzes für die Rabenvögel sieht Jens Gruhle darin, sie „auszuwildern“. Wenn er meint, dass sie so weit sind, öffnet er das Drahtdach der Volieren. Dann können sie notfalls zurückkommen – an die gefüllten Freßnäpfe z.B.. Einige seiner Ehemaligen fliegen gelegentlich auf die – jetzt geschlossenen – Volierendächer, wo er sie ebenfalls füttert. Derzeit hat er darin noch 5 Nebelkrähen, eine Elster und eine zahme, schwarz glänzende Rabenkrähe. Man hatte sie in Spandau eingefangen, weil sie sich an Kitas und Schulen aufhielt, wo sie den Kindern ohne Scheu ihr Pausenbrot klaute. Jens Gruhle wartet, dass der NABU-Hamburg ihm eine männliche Rabenkrähe überläßt, sobald eine reinkommt. Damit hofft er, dass „seine“ Krähe „ihre Menschenprägung langsam verliert“. In der Voliere ist „die Prinzessin“ jetzt unterfordert und mit einer der jungen Nebelkrähen will sie sich nicht verpaaren. Obwohl das möglich wäre: Rabenkrähen leben westlich der Elbe, Nebelkrähen östlich. In einer schmalen Zone dazwischen verpaaren sie sich auch, allerdings nur dort. Ihre Jungen nennt man Rakelkrähen.
.
Jens Gruhle schätzt insbesondere Raben und Krähen – wegen ihrer Intelligenz („Wenn sie verletzt sind und man kümmert sich um sie, dann verstehen die das sofort“) und ihrer Artikulationsfähigkeit („Jedes Jahr ist ein Vogel dabei, das einen neuen Ton drauf hat“), er kümmert sich aber auch um alle anderen Vögel. 2015 waren das neben 49 Rabenvögeln 22 Ringeltauben, 3 Wachteln und 2 Spatzen. Etwa 10 Prozent der Rabenvögel sterben bei ihm. Bei der Herstellung der Kropfmilch für die jungen Tauben tauschte er sich mit Almut Malone aus.
.
Um seine Amsel, Drossel, Fink und Meise liebenden Nachbarn nicht zu verärgern, hat Jens Gruhle sich mit ihnen zusammengesetzt, bevor er sein „Raben-Projekt“ begann. Er hat auch noch zwei Hunde und einige Zwerghühner sowie Legehühner. Von den letzteren holt sich gelegentlich der Fuchs eins. Während meines Besuchs auf seiner Station kreiste ein Krähenschwarm über der Siedlung: er ist derzeit noch groß, wurde mir erklärt, aber ab März nehmen die Paare wieder ihre Reviere ein, die sie dann verteidigen, und junge Paare ohne Revier machen sich auf die Suche nach einem anderen. Anders bei den meist aus Polen und Russland stammenden Saatkrähen, die hier nur überwintern: sie bleiben zusammen und brüten daheim auch in Kolonien, ebenso die Dohlen, die es jedoch in Berlin mangels Nistmöglichkeiten in Gemäuern so gut wie gar nicht mehr gibt. Wenn Jens Gruhle eine in Pflege bekommt, dann stammt sie meist auch aus Polen. Stettin z.B. sei eine richtige Dohlenstadt. Manchmal bekommt Jens Gruhle auch einen Eichelhäher; einer, der beringt war, wurde, fünf Jahre nachdem er ihn ausgewildert hatte, von Vogelschützern in Norwegen registriert, die ihn darüber informierten. Überhaupt hat sich sein Einsatz für Raben und Krähen herumgesprochen. So bekam er z.B. einen Brief aus Kanada – von „Krähen-Indianern“ (Crows – Apsarokee in ihrer Sprache): Sie bedankten sich bei ihm dafür, dass er sich so um ihr Totemtier kümmert.
.
Der Tierpark Friedrichsfelde hält zwei Kolkraben in einer Großvoliere, die auf dem höchsten Punkt des Geländes stand, nun leben die beiden jedoch in einer etwas weiter unten. Als ich die für sie zuständige Tierpflegerin interviewen wollte, wurde ich erst mit dem Kurator und dann mit der Pressesprecherin des Charlottenburger Zoos verbunden. Sie schrieb mir: „Da unsere Tierpfleger primär mit ihren Tieren zu tun haben, würde ich Sie bitten, uns Ihre Fragen per Mail zu schicken.“ Ähnlich reagierte auch die auf Rabenvögel quasi spezialisierte Tierärztin Dr. Müller in der Tierklinik in Düppel.
.
Die beiden Kolkraben im Tierpark waren mir gegenüber offener: als ich endlich ihre Voliere gefunden hatte, begannen sie sofort, einen Teil ihres Repertoires vorzuführen, so schien es jedenfalls: Während der eine Rabe auf einen nahen Ast flog und laute „wrru“-Rufe ausstieß, fischte der oder die andere erst einen Zweig aus dem Wasserbecken und hebelte dann auf einem Baumstamm ein Stück Rinde ab. Sodann flog er oder sie auf einen Ast und stieß kehlige „koark“-Laute aus, was ziemlich anstrengend aussah. Der erste Vogel flog währenddessen auf die Erde, schaufelte mit halbgeöffnetem Schnabel den Sand an einer Stelle weg und zog ein angefaultes Stück Holz heraus. Das sah der „singende“ Rabe, landete hinter dem anderen und schaufelte ebenfalls den Sand an einer Stelle weg, jedoch ohne Eifer, auch schienen ihm die Sandkörner im Schnabel unangenehm zu sein. – Das fand alles innerhalb der durchschnittlichen Verweildauer eines Tierparkbesuchers vor einer Voliere statt, ich war beeindruckt.
.
Um so mehr, da sich die meisten Tiere im Tierpark an dem kalten Frühlingstag verkrochen hatten, ein paar verharrten nahezu regungslos in der Sonne, einige Raubtiere liefen allerdings noch wie stets ruhelos in ihren Gehegen hin und her, z.B. die Asiatischen Rothunde, mitten in ihrem Rudel hielt sich interessanterweise ein Dutzend Nebelkrähen auf. Die beiden Tierarten schienen gut miteinander auszukommen, einige der Krähen nisteten wohl auch im Tierpark. Ich sah etliche Krähennester in den hohen Bäumen, überhaupt wimmelte es im Park geradezu von dort frei lebenden Vögeln. Auch im Westberliner Zoologischen Garten gäbe es viele Nebelkrähen, sie seien Mitesser bei den gefangenen Tieren, wurde mir gesagt, ebenso wilde Enten, Spatzen und Fischreiher.
.
Wildtiere zu privatisieren ist gesetzlich verboten, desungeachtet gibt es eher mehr als weniger Menschen, die vor allem verletzte oder verwaiste Vögel mitleidig aufnehmen und versuchen, sie groß zu ziehen. Es gibt Dutzende Ratgeber, was dieser oder jener Vogel braucht, um in Gefangenschaft zu überleben. Aus Unkenntnis oder weil sie schon halbtot waren, als man sie fand, sterben trotzdem noch viele – und sei es, weil sie durch die Aufzucht ihre Scheu vor Menschen verloren haben und nach dem Auswildern prompt dem ersten Schlechtesten zum Opfer fielen.
.
Der frühpensionierte Innenausbauer Peter Schädlich, hat in seiner Kreuzberger Wohnung schon drei Nebelkrähen groß gezogen. Die erste war in einem Zaun hängen geblieben, die zweite hatten Ruderer vor dem Ertrinken gerettet und die dritte, die immer noch flugunfähig ist und bei ihm lebt, brachte jemand bei ihm vorbei. So wie auch seinen großen Hund und seine kleine Katze: „Notaufnahmen“. Die drei Tiere vertragen sich untereinander. Nur die ersten Wochen hielt er die damals etwa vier Monate alte und vermutlich weibliche Krähe in einer Voliere in seiner Wohnung, inzwischen hat sie ihren Platz auf einem alten Sofa gefunden, daneben geht sie gerne nach draußen auf eine umzäunte Veranda. Wenn in der Nähe Nebelkrähen krächzen, wird sie hellhörig und sucht den Himmel nach ihnen ab. Peter Schädlich füttert sie mit Körnern, Nüssen, Vogelschmalz, Grillen und gelegentlich einem Eintagsküken – „eine Delikatesse für die Krähe, aber teuer“. Einen Teil der Tiernahrung und auch medizinische Hilfe bekommt er von der „Tiertafel“ Mörikestrasse. Er meint, Krähen werden in Gefangenschaft älter als in Freiheit – 30 – 40 Jahre und würden als Paar fast monogam leben.
.
Von Josef Reichholf stammt die Beobachtung, dass fast die Hälfte aller Rabenkrähenweibchen sich inzwischen die Aufzucht mit zwei Männchen teilt, wobei das zweite mutmaßlich aus einer früheren Brut stammt. Krähen verpaaren sich frühestens im 3. Lebensjahr, bis dahin lernen sie in sogenannten „Junggesellen-Banden“ – und werden mitunter zu „Problemvögeln“. Am Grunewaldsee hatten ein kleiner Trupp sich nach wiederholtem Füttern an bestimmte Menschen gewöhnt. Als sie aber immer mehr und dreister wurden und auch ihnen fremde Spaziergänger bedrängten, wurden sie abgeschossen. Im Görlitzer Park taucht gelegentlich ein Radfahrer auf, der von einer freifliegenden Krähe begleitet wird. Sie akzeptiert nur ihn als „Mitmensch“: Man kann nicht vorsichtig genug sein als Krähe.
.
Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz zog 14 Dohlen groß, gleich nachdem sie ausgeschlüpft waren. Weil sie dadurch auf ihn „geprägt“ wurden, konnte er sie später frei fliegen lassen. Sie kamen immer wieder zu ihm zurück – und ließen vieles mit sich machen. Er durfte sie jedoch nicht packen, um sie etwa zu beringen – damit war er sofort ein „Dohlenfresser“ und wurde angegriffen.
.
Der Tierfreund Peter Schädlich
geht davon aus, dass seine Nebelkrähe, Fetel genannt, sich sobald sie flugfähig ist einer Jungkrähen-Gruppe anschließen wird und sich dabei entzähmt. „Aber bei ihr kann das Auswildern auch zu einem Problem werden, denn sie leidet eventuell unter einer frühen Mangelernährung – und bekommt deswegen gelegentlich Vitamin- und Mineralien-Präparate. Ihr Gefieder ist jedoch besser geworden, seitdem sie in der Wohnung und auf der Veranda herumläuft. Auch den Katzenbaum hat sie schon zur Hälfte erobert. Sie ist sehr selbstbewußt, will aber nicht angefaßt werden – keine Hände, nur die Nase ist erlaubt. Krähen sind ja sehr kommunikativ und erzählen einem gerne was, sie singt mir gelegentlich sogar was vor. Wenn man das Singen nennen will.“
.
.
Der Leiter der Wildvogelstation des NABU in Marzahn, André Hallau, erzählte mir am Telefon, sie bekämen die meisten Vögel von der Kleintierklinik der FU, aber auch Privatleute würden ihnen welche bringen. „2015 hatten wir 40 Rabenvögel, darunter zwei Kolkraben. Von denen gibt es in Berlin immer mehr Brutpaare, nicht nur in den Stadtwäldern. Das gilt auch für Eichelhäher, die sich selbst hochverdichtete Siedlungsgebiete erschließen. Sie werden dementsprechend auch immer häufiger gefunden und nach Düppel bzw. zu uns gebracht.“ Sie brauchen wahrscheinlich noch eine Weile, um ’street-wise‘ zu werden. Um ihren Prädatoren auszuweichen, rücken sie den Stadtmenschen immer näher. Das gilt laut Hallau auch für Mehlschwalben, Ringeltauben und Enten z.B. die immer häufiger auf Balkonen brüten.
.„
Die Rabenvögel sind eine aufwändige Art. Wir haben 4 Volieren hier, 80 Quadratmeter, zwei erst seit 2014. Zwar machen darin die Rabenvögel nur 5,5 Prozent aus, aber wegen ihrer langen Verweildauer sind es übers Jahr doch 41%. Um sie wieder auswildern zu können, müssen sie zuvor gewissermaßen entzähmt werden. Wir leeren die Volieren im September, wenn sie bis dahin nicht ‚fit for flight‘ sind, weil ihre Verletzung noch nicht ausgeheilt ist oder weil ihre Flugfedern noch nicht wiederhergestellt sind z.B. aufgrund einer Mangelernährung – sei es bei den Menschen, die sie gefunden und gefüttert haben oder auch schon im Nest ihrer Eltern, geben wir sie z.B. in die Volieren von Gruhle. In der Vergangenheit bekamen wir mehr Rabenvögel, aber man kann noch nicht sagen, ob es diesbezüglich irgendeinen Trend gibt. Vielleicht kommen die meisten Landflüchtigen ja wirklich im Laufe der Zeit besser mit dem Stadtleben klar.“ Learning by doing.
.
Die Volieren der Wildvogelstation haben Sichtblenden, damit die Vögel sich nicht an die Menschen gewöhnen. Frau Dr. Malone kritisiert daran, dass sie sich auf diese Weise, während einer wichtigen Lernphase ihres Lebens abgeschirmt, nicht mit der übrigen Umwelt vertraut machen können. Ein Extremfall bei ihr war eine Elster, die morgens mit dem Briefträger auf dem Fahrrad die Straße hoch mitfuhr, und ihn dann auf dem Rückweg, an ihrem Haus, wo der Vogel frei lebte, wieder verließ.
.
Vom NABU-Mitarbeiter Jens Scharon, Sekretär der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA) in deren Berliner ornithologischen Berichten (BOB) er gelegentlich veröffentlicht, bekam ich einige Zahlen: „Nach einer Zunahme von Elstern und Nebelkrähen in Berlin hat es eine Stabilisierung der Populationen gegeben. Derzeit gibt es 3900 bis 4700 Elstern-Brutpaare und 4100 bis 4900 Nebelkrähen-Brutpaare. Bei Saatkrähen und Dohlen stellten wir einen starken Rückgang fest – beide sind in Berlin vom Aussterben bedroht. Derzeit gibt es bei diesen Koloniebrütern noch 41 Dohlen-Brutpaare und 30 bis 70 Saatkrähen-Brutpaare. Bei den Kolkraben nehmen die Brutpaare zu, sie brüten z.B. gelegentlich sogar schon auf oder an Kirchtürmen. An sich hat sich die Nahrungssituation für alle Rabenvögel jedoch negativ entwickelt, insofern die Müllkippen seit der Mülltrennung für sie nicht mehr interessant sind und die Freiflächen hier immer weniger werden.“
.
Zudem sind seit der Übernahme des Kapitalismus auch in Osteuropa jede Menge Müllplätze entstanden, auf denen einstweilen noch Abfälle mit hohen organischen Anteilen deponiert werden, so dass die Rabenvögel dort jetzt über das ganze Jahr genügend Nahrung finden, wie der ehemalige Vorsitzende des NABU Berlin, Dr. Hans-Jürgen Stork, von einem Ornithologen in Lodz erfuhr.
.
Der FU-Biologe, der einmal eine Nebelkrähe aufzog, hat mit Studenten und Diplomanden von 1973 bis 2006 die Rabenvögel-Populationen in der Stadt erforscht und sich als Naturschützer, wenn es um den Erhalt ihre Brutreviere ging, auch politisch engagiert – so z.B. am Flughafen Tegel, als dort eine der letzten in Berlin brütenden Saatkrähen-Kolonien mit der geplanten Umnutzung der Landebahnen zu einem Gewerbe- und Hochschul-Park ihre Brutbäume verlieren sollte. Es gäbe dort 75 Brutpaare, dazu kämen sieben weitere auf dem Gelände des Tegeler Gefängnisses, erzählte er mir, „im Winter halten sich bis zu 2000 Krähen auf dem Flughafen auf, in den letzten Jahren haben sie sich angewöhnt, auf dem Flughafengebäude zu übernachten“. Dr. Stork meint, die Saatkrähen, aber auch die Nebelkrähen und Dohlen, seien vor etwa 50 Jahren – zur Wirtschaftswunderzeit – aus Russland hierher gekommen. Es gab auch einmal Kolonien auf den Flughäfen Schönefeld und Tempelhof, aber man habe sie dort mit verschiedenen Mitteln vergrämt. Bei verletzten Jungvögeln ist er eher dafür, dass man sie in Ruhe läßt, so dass Füchse, Eulen oder Katzen sie finden: „Solche Nahrungsketten-Beziehungen sind uns Ökologen näher als einem Vogelfreund. Wir müssen immer auch ein bißchen gegen die berühmte Tierliebe der Berliner halten.“
.
Dem entgegen steht der Gedanke, dass „ökologisches Bewußtsein“ die sinnliche Erfahrung und ein Einfühlungsvermögen mit einzelnen Pflanzen und Tieren voraussetzt. Der Münchner Ökologe und Rabenforscher Josef Reichholf hebt dies immer wieder hervor.
.
Auf dem Tegeler Flughafen sah man zunächst in den Krähen eine Gefahr für den Flugverkehr, so dass auch dort mehrmals versucht wurde, sie von ihren 2001 eingenommenen Bäumen zu vergrämen, u.a. von der Feuerwehr mit Wasser. Im Zusammenhang der Krähenforschung fang dort ein Bewußtseinswandel statt: „Heute werden sie sogar gefüttert“.
.
Dem „Deutschen Ausschuß zur Verhütung von Vogelschlägen im Flugverkehr,“ in dem u.a. Bundesluftwaffenoffiziere sitzen, war jedoch an gesicherten Erkenntnissen gelegen, so dass die Feldbiologen das Brut- und Flugverhalten der Krähen von allen Seiten, auch vom „Tower“ aus, beobachten konnten, dazu gab man ihnen Radaraufnahmen von den Vogelschwärmen zur Auswertung. Mit der „radarornithologischen Untersuchung von 1977 bis 1982“ ließen sich die Krähenflüge über die Stadt hinaus ebenso verfolgen wie deren Störungen etwa durch Silversterfeuerwerk. Als die Krähen im Winter 1979/80 ihren Schlafplatz in das Wasserwerk Jungfernheide in Siemensstadt verlegten, belegten die Radaraufnahmen, dass sich das „gesamte Schlafplatzflugsystem verlagerte“.
.
Hans-Jürgen Stork faßte das Forschungsergebnis 2012 in den „Berliner ornithologischen Berichten“ zusammen. Im Winter flogen bis zu 80.000 Saatkrähen hier ein, wobei sich nur ein Teil am Flugfeld versammelte, um von dort zu den „zentralen Sammelplätzen“ auf dem Tanklager am Salzhof und in Siemensstadt zu fliegen – und dann gemeinsam zu den „Schlafplätzen am Tegeler See“. In den Achtzigerjahren ergaben Ringzählungen und Bestandserfassungen „direkt an den Schlafplätzen allmähliche Rückgänge der Winterbestände im Stadtgebiet...Darüber hinaus erfolgten neue Schlafplatzverlagerungen in den Tiergarten und nach der politischen Wende bis nach Berlin-Mitte.“ Für die Kolonie am Flughafen Tegel sorgte die starke künstliche Beleuchtung dafür, dass sich ihr Aufbruch zum Schlafplatz „weit über die Zeit der Bürgerlichen Dämmerung hinaus verzögerte“. Inzwischen schlafen sie auf dem Flughafengebäude.
.
Anhand eines Diagramms zeigte Hans-Jürgen Stork, wie nach Einführung des Naturschutz-Gesetzes 1975 der damals gegen Null gehende Bestand an nistenden Saatkrähen in Berlin sprunghaft anstieg – bis er 1990 mit 350 Brutpaaren wieder einen vorläufigen Höchststand erreichte. Ein anderes Diagramm zeigt, dass die Vergrämungsmaßnahmen auf dem Flughafen Tegel und an der JVA Tegel die „Anzahl der besetzten Nester“ 2007/2008 gegenüber 2004 fast halbierten. In ganz Berlin gab es damals kaum noch 80 Brutpaare bei den Saatkrähen.
.
Während der FU-Biologe Hans-Jürgen Stork im Norden, in Tegel, Krähen erforschte, hat sich der Biologe der Humboldt-Universität Dr. Rolf Schneider seit der Wende im Süden, in Köpenick, u.a. auf Dohlen konzentriert. Er sprach mit mir über die Probleme der Rabenvögel als „Kulturfolger“. Es gibt unter ihnen anscheinend ein Kommen und Gehen: Die Elstern und die Eichelhäher sind im Kommen (ich sah selbst einen Eichelhäher auf dem Biologie-Campus der Humboldt-Universität), während die Dohlen verschwinden; ihre größte Kolonie befand sich in Köpenick, dort gab es ab 2003 dann auch eine Kooperation der HUB-Biologen mit dem NABU, der dort Nistkästen für sie aufhängte.
.„
Die Dohlen bekommen in der Stadt weniger Nachwuchs als auf dem Land. Das Futterangebot ist problematisch: Zwar gibt es genug Kohlehydrate (Brot z.B.), aber sie brauchen für die Aufzucht Eiweiß (Insekten, Würmer etc.). Die Sterberate der in der Stadt geborenen Jungen beläuft sich auf 70 bis 100 Prozent, auf dem Land betrifft es nur 25 Prozent. Die Köpenicker Jungvögel wurden z.T. gemessen und gewogen: Viele erreichten nicht das Ausfliegegewicht, wir fanden Anzeichen von Pilz- und Nierenerkrankungen.“
.
Neben den Dohlen stehen auch die Saatkrähen inzwischen auf der Berliner „Roten Liste der gefährdeten Arten“. Erstere sind Höhlenbrüter, gerne in (Kirch)türmen (sofern nicht vergittert), letztere sind Freibrüter (auf hohen Bäumen). „Ab 2004 wurden hier fünf Saatkrähen-Kolonien mit insgesamt 111 Nestern untersucht, u.a. an der Jannowitzbrücke und einige am S-Bahnhof Adlershof. Die größte Kolonie befindet sich derzeit in Wittenberg – bestehend aus mehreren hundert Brutpaaren. Dort hat man einige ihrer Nistbäume gefällt, woraufhin sie in die Parkbäume eines Altersheims umzogen, wo sie nun wegen ihres Kots zum Problem geworden sind.“ Das ist mitunter auch am Flughafen Tegel ein Problem.
.„
Die Rabenvögel wurden, weil sie ebenso wenig beliebt waren wie Spatzen, lange Zeit nur wenig beforscht. Eine Ausnahme ist der Eichelhäher, der im Forst beliebt ist, weil er mit seiner Winterbevorratung durch Vergraben von Eicheln zur Waldverjüngung beiträgt.“
.
Zu den „gefährdeten Arten“ nicht nur in Berlin gehört auch die „organismische Biologie“: Generell läßt sich laut Rolf Schneider sagen, dass die Verhaltensforschung, die Feld-Biologie, fast überall auf dem Rückzug ist, weil die Fördermittel vor allem den genetisch- und molekular forschenden Wissenschaftlern zugute kommen. „Für die angehenden Erforscher der organismischen Biologie gibt es deswegen immer weniger Arbeitsmöglichkeiten – höchstens noch in Behörden, Zoos, Jagdverbänden, in der Forstwirtschaft und im Pflanzenschutz. Schon werden ganze Institute abgewickelt an den Universitäten, die sich zudem von ihren Botanischen Gärten trennen wollen. Fast kann man bereits davon ausgehen, dass die Tier- und Pflanzenforschung langsam von der Naturwissenschaft zur Kulturwissenschaft und zu den Künstlern wandert. Ohnehin war es die Romantik, die den Naturschutzgedanken einst angestoßen hat.“
.
Im „Rabenforum“ des Internets wird berichtet, dass von den in Berlin fast ausgestorbenen Kolkraben seit den Achtzigerjahren wieder etliche Paare in den Wäldern nisten – etwa 350, davon rund 20 im Spandauer Forst. Über diese erzählte Renate Lorenz mir, dass die Bauern drumherum eine Sondergenehmigung für ihren Abschuß beantragt hätten. Jens Gruhle wußte dann, „dass die Obere Naturschutzbehörde das natürlich ablehnte“.
.
Rings um die große Westberliner Müllkippe in Wannsee nisteten auf den hohen Bäumen drumherum immer besonders viele Kolkraben. Sie lebten von den Abfällen, und das so gut, dass sie, die normalerweise riesige Reviere als Brutpaare beanspruchen, dort sozusagen auf engstem Raum siedelten. – Bis die Müllkippe 2005 zugeschüttet wurde. Bis dahin erforschte der Feldbiologe Carsten Hinnerichs die Population. Engagierte Rabenforscher, wie Bernd Heinrich z.B., kamen extra wegen dieser Besonderheit im Brutgeschehen aus den USA angeflogen. Zuletzt versuchte Carsten Hinnerichs am Hohen Fläming herauszubekommen, wo die nicht-verpaarten und revierlosen Kolkraben, die sich zu umherschweifenden Gruppen zusammentun, abbleiben. Sein „Untersuchungsgebiet ist 550 Quadratkilometer groß – „zu groß“, aber er kartiert weiter – neben seiner Arbeit in einem Planungsbüro. Das biologische Institut der Potsdamer Universität, wo er forschte, wurde mit der Emiritierung seines Leiters, Hans-Dieter Wallschläger, faktisch geschlossen.
.
Der Ökoethologe hatte zuletzt die bäuerliche Mär empirisch widerlegt, dass Kolkraben junge Kälber, Lämmer und Ferkel töten und anfressen: Weil diese Vögel nicht die Kraft im Schnabel haben, brauchen sie Wallschläger zufolge Wölfe, Füchse oder Hunde, um einen Kadaver „aufzubrechen“, sie sind deren „Nachnutzer“. Da die Kolkraben,zu den Singvögeln gehörend, ganzjährig geschützt sind, wollten die Bauern eine finanzielle Kompensation vom Staat für ihren „Schaden“, ähnlich wie das bei den „neueingebürgerten“ Wölfen in Sachsen und Brandenburg und den Ringelgänsen in Nordfriesland bereits gehandhabt wurde und wird.
.
Zu den Rabenfreunden zählt auch die Schriftstellerin Monika Maron.
Wenn man ihrem Bericht „Krähengekrächz“ (2016)
folgt
, hat sie sich dazu etwas ethologisch Neues ausgedacht, das dem schnellen Ortswechsel dieser Vögel eher Rechnung trägt als das traditionelle – ranschleicherische – „Bird-Watching“ mit Zeiss-Fernglas, Joseph-Beuys-Jacke und männiglichem Hightechgerät. Zuerst lockte sie eine Nebelkrähe mit Futter auf ihren Balkon, dabei tunte sie sich schon mal akustisch auf diesen „Allesfresser“ ein. Sie gelangte währenddessen zu der Einsicht: „Nicht ich kann mich mit einer Krähe befreunden, sondern nur eine Krähe mit mir.“ Und da sie viel besser sehen können als wir, können sie uns individuell unterscheiden, aber wir sie so gut wie gar nicht. Eingedenk dessen kam Maron auf die Idee, dem blöden Glotzen der Passanten zum Trotz täglich mit einem um sie herum fliegenden Trupp Krähen in der Stadt spazieren zu gehen, wobei sie stets genügend Futter dabei hatte.
.
Die österreichische Psychologin Susanne Studeny, die auf ihrer Internetseite „
tiamat.at/Rabenvogel“ laufend neues
Rabenwissen
zur Kenntnis
bringt
,
schrieb mir: „
Die
Ostb
erliner Raben sprechen
wahrscheinlich
einen anderen Dialekt als die Wiener Raben! Das ist zumindest die Vermutung in der aktuellen Forschung.“
.
Je mehr ich den in Berlin lebenden Rabenvögeln nachspürte, desto mehr ve
rstärkte
sich mein Eindruck, dass es ein ganzes,
wenn auch nie ausreichendes
Netzwerk von Leuten und Einrichtungen in der Stadt gibt, die diese
n
„
Kulturfolgern“
helfen – von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus
.
Dabei habe ich bestimmt noch etliche übersehen. Einer z.B., der in Rangsdorf bei der „Natur+Text GmbH“ arbeitet, Roland Lehmann, soll sich mit Elstern befassen und weiß Näheres über die Müllkippen in Ketzin und Schöneiche. Einmal stieß ich hinter Frohnau auf eine ganze Elster-Kolonie in einigen Bäumen – dachte ich, man klärte mich aber auf: Es waren bloß wenige Paare, sie bauen oft mehrere Nester – sogenannte „Täuschnester“; nur auf ihren Schlafbäumen bilden sie bei Dunkelheit größere Kolonien. In eigener Sache füge ich abschließend noch hinzu: Der Name „La Gazzetta“ für Zeitung leitet sich vom
italienischen
Namen der Elster Gazza negra. – die „Schwatzhafte“ – her.
.
.
3.
Die englische Musikerin und Hobbyornithologin Clare Kipps veröffentlichte 1953 ein Buch über die Aufzucht eines Sperlings, der – auf sie „geprägt“ – zwölf Jahre bei ihr lebte. Die Autorin, die allein in London wohnte, entwickelte ein besonderes Verhältnis zu „Clarence“ – ihrem Spatz, der in den Kriegsjahren, da Clare Kipps im Luftschutz eingesetzt war, in ganz England berühmt wurde, weil er die im Bunker sich Versammelnden unterhielt, so dass sie vorübergehend ihre Sorgen und Ängste vergaßen. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag über „Clarence“: „Neben einigen anderen Tricks war die Luftschutzkellernummer sehr beliebt: Clarence rannte auf den Ruf ‚Fliegeralarm!‘ hin in einen Bunker, den Mrs. Kipps mit ihren Händen bildete, und verharrte dort reglos, bis man ‚Entwarnung!‘ rief. Noch beliebter waren indes seine Hitlerreden: Der Spatz stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten, durch ein Jugendunglück leicht lädierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu tschilpen. Er steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezeter, verlor dann scheinbar den Halt, ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht.
.
Clarence wurde auf diese überraschende Weise zu einer Symbolfigur der von Hitlers Luftangriffen geplagten Londoner und ihres Durchhaltewillens. Er wurde in Presseberichten gefeiert, und sein Bild zierte Postkarten, die zu Gunsten des Britischen Rotes Kreuzes verkauft wurden.“
.
Clare Kipps Buch über ihn, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, wurde vom Biologen Julian Huxley mit einem Vorwort versehen. Für die deutsche Ausgabe – „Clarence der Wunderspatz“ betitelt – schrieb der Basler Biologe Adolf Portmann ein Nachwort: „Vom Wunderspatzen zum Spatzenwunder“. Darin versuchte er vorsichtig einige Verallgemeinerungen aus Clare Kipps Langzeitbeobachtung eines Individuum zu ziehen, die von einer gegenseitigen Zuneigung getragen wurde.
.
Clarence konnte singen, wobei er von der Autorin am Klavier begleitet wurde; Portmann schreibt: „Es mag im Spatzen ein sehr vages allgemeines Erbschema eines Liedes vorhanden sein, das in der Spatzenwelt normal gar nicht ausreift, das aber in neuer Umwelt sich entwickelt. Solche Erscheinungen kennt die Erbforschung da und dort. Das würde uns zeigen, wie wenig ‚frei‘ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt...Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.“
.
Ansonsten begrüßte es Portmann, dass der knapp 100seitige Bericht sich auf die Individualität eines Vogels konzentrierte: „Wir wissen durch nüchterne Beobachtung, dass bei manchen Vogelarten gerade im Gesang starke Individualitäten sich äußern.“ Außerdem konnte sich Portmann in den Fünfzigerjahren noch darüber freuen, dass sich auch in der biologischen Forschung langsam Begriffe wie „Stimmungen“ oder „Gemütsleben“ (Jakob von Uexküll) durchsetzen: „Das Tiergemüt kommt zu Ehren,“ schrieb er.
.
In dem Buch von Clare Kipps hört sich das so an: „...Er nahm mir nie etwas übel und betrachtete mich von klein auf als seine Erretterin aus jeder Schwierigkeit und Klemme.“ Clarence schlief im Bett der Autorin, an ihren Hals geschmiegt. Einmal wollte eine Freundin von Clare Kipps im Bett übernachten: „Er lief das Kissen auf und ab, schalt und drohte und griff schließlich meine Freundin so wütend an, dass sie als Eindringling gezwungen war, aufzustehen...“ (Um auf der Wohnzimmercouch zu schlafen).
.
Der erste Teil oder die Einleitung des Gesangs von Clarence „war ein Ausdruck des Vergnügens, der guten Laune und alltäglichen Lebensfreude, während der zweite Teil, das eigentliche Lied, ein Verströmen reinen Entzückens war. Beide Teile waren gewöhnlich in F-Dur, aber der zweite Teil variierte an Tonhöhe um soviel wie eine kleine Terz, je nach der Tonstärke.“
.
Wenn Clarence es satt hatte [das Publikum im Luftschutzbunker mit Tricks zu unterhalten], „nahm er eine Patiencekarte in den Schnabel und dreht sie darin zehn- oder zwölfmal herum. Das war glaube ich sein Lieblingstrick, denn er hatte ihn selbst erfunden und vergnügte sich noch jahrelang damit...Leider begann er im Frühjahr 1941 des Lebens in der Öffentlichkeit mit all seinem Glanze überdrüssig zu werden...Ich glaube nicht, dass er Sinn für Humor hatte. Es war eine sehr wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens, dass wir viele Stunden friedlicher Betrachtung in Stille zusammen genießen konnten. Ich liebe weder Geräusche noch zuviel Musik.“
.
Es gab aber auch Probleme: Clarence war z.B. „sehr heftig dagegen, daß ich in einem neuen Kleid erschien, und selbst ein neuer Hut oder neue Handschuhe riefen scharfen Protest hervor.“ Clare Kipps meint, erst nach seiner „verspäteten Reife bildete sich sein Charakter, und weil sein Dasein verhältnismäßig frei von Ereignissen war, blieben sein Verhalten und Gewohnheiten ziemlich gleich...Sein Charakter war – abgesehen von seinem wilden Temperament und der Eifersucht – ohne Makel. Es lag nichts Zerstörerisches in seinem Wesen, und nie war er gierig...“
.
In dem Kapitel über sein letztes Lebensjahr heißt es: „Das stolze Gebaren, das wählerische Verhalten und der tyrannische Eigensinn waren verschwunden...“ Er erwies sich als sehr weise – „es fiel mir immer schwerer, ihn als einen gewöhnlichen Vogel zu betrachten.“ Abschließend schreibt Clare Kipps: „Wenn meine Vermutung richtig ist, dann ist die Psyche eines kleinen Vogels von größerem Interesse, als es die Ornithologen bisher angenommen haben...Dass seine Intelligenz überragend war, glaube ich nicht. Ich bin klügeren Vögeln begegnet. Was ihn so interessant und reizend machte, war die Fähigkeit, durch das Medium der ungewöhnlichen Umgebung seine Vogelnatur in einer Sprache auszudrücken, die ein menschlicher Verstand begreifen und an der er teilhaben konnte. Und darin war er vielleicht einzigartig.“
.
Das läßt sich auch von meinem Spatz sagen, den ich in den frühen Sechzigern großzog. Er war aus dem Nest gefallen. Zwar hatte ich damals keine Ahnung vom Füttern eines solchen Jungvogels, aber meine Eltern halfen mir – wir probierten einfach alles aus. Und er entwickelte sich gut. Im Sommer kam er mit aufs Land. Und dort mauserte er sich zu unserem interessantesten Haustier. Bei Spaziergängen im Wald flog er voraus, landete aber immer wieder auf der einen oder anderen Schulter und erzählte uns von da aus alles mögliche. Er unterhielt sich gerne mit uns. Im Haus stürzte er sich auf den Frühstückstisch, landete dabei auch mal im Honig oder in der Marmelade – und mußte jedesmal mühsam gewaschen werden. Auch stürzte er sich gerne auf den in der Sonne liegenden Dackel und zupfte ihm graue Haare aus dem Fell. Mittags schlief er bei meinem Vater zwischen Schulter und Wange. Einmal schlüpfte er nachts unter den Bauch des Meerschweinchens, das ihm daraufhin gedankenverloren die Flugfedern anknabberte. Der Spatz, der Benjamin hieß, konnte danach eine ganze Weile nur noch schlecht fliegen, er blieb aber fröhlich und unternehmungslustig und begleitete uns einfach zu Fuß auf unseren Spaziergängen. Am Liebsten fuhr er im Auto mit, wobei er sich auf die Rückenlehne des Fahrers setzte und sich auf den Verkehr konzentrierte. Monatelang erzählten wir anderen Leuten nur noch Geschichten, in denen er die Hauptrolle spielte. Und er dachte sich auch fast täglich neue Aktivitäten aus, die uns begeisterten, auch wenn sie aus seiner Sicht vielleicht schief gegangen waren. Schon bald war er unser beliebtestes Familienmitglied. Wenn einer von uns nach Hause kam, war seine erste Frage: „Wo ist Benjamin?“ „Was macht er?“ Wir kamen zu der Überzeugung, dass er sich als Mensch begriff, Vögel, auch Spatzen interessierten ihn nicht, und der Größenunterschied zwischen sich und uns schien ihm nichts aus zu machen. Als er starb, der Hund hatte im Halbschlaf um sich geschnappt, als er stürmisch auf ihn zuflog – und ihn aus Versehen dabei mit den Zähnen erwischt, trauerten wir wochenlang um den Spatz, auch der Hund. Er wurde im Familiengrab auf unserem Grundstück beerdigt.
.
Ich will mit diesen „Anekdoten“, wie die quantifizierende Verhaltensforschung ( die eigentlich Physiologie betreibt), diese Spatzen-Geschichten nennt, darauf hinaus, dass die darin enthaltene „Annäherung“ nicht im Sinne einer immer größeren „Genauigkeit“ fungiert, sondern als genau der Ort des Durchgangs zu dem, was geschieht. Das ist doch witzig.
.
.
4.
Wenn Menschenaffen nicht reden können, sie aber viel zu sagen haben, dann kann man ihnen vielleicht beibringen, ihre Finger zu benutzen, ungefähr so wie ein Taubstummer, schlug der amerikanische Tierpsychologe Robert Yerkes 1925 vor. Zu den ersten, denen man die „American Sign Language“ (ASL) beibrachte, zählte die Schimpansin Lucy, die im Haus des Psychotherapeuten-Ehepaars Temerlin aufwuchs. Sie hatte einen Sprachlehrer, Roger Fouts, und der hatte eine Assistentin, Sue Savage-Rumbaugh. Kaum hatte Lucy die ersten von schließlich 90 Zeichen gelernt, versuchte sie schon Fouts mit Hilfe der Gebärdensprache zu belügen: Sie hatte auf den Teppich im Wohnzimmer gekackt, als er sie zur Rede stellte, behauptete Lucy, nicht sie, sondern Sue Savage-Rumbaugh wäre es gewesen.
.
Die NZZ berichtete über sie: „Wer zu dieser Zeit das Haus der Temerlins betrat, wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Familienlebens. Hatte Lucy Durst, ging sie in die Küche, öffnete den Schrank, nahm einen Teebeutel heraus, kochte Wasser und füllte die Tasse. Dann setzte sie sich aufs Sofa und blätterte in Zeitschriften, am liebsten hatte sie die National Geographic. Bald entdeckte sie auch härteren Stoff wie Bourbon und Gin.“ Wenig später kam eine neue Vorliebe hinzu. „Eines Nachmittags saßen Jane und ich im Wohnzimmer und beobachteten, wie Lucy die Stube verließ“, berichtete Temerlin. „Sie ging in die Küche, öffnete einen Schrank, nahm ein Glas heraus, holte eine Flasche Gin hervor und schenkte sich drei Finger hoch ein. Damit kam sie zurück in die Stube, setzte sich auf die Couch und nippte. Doch mit einem Mal schien ihr ein Gedanke zu kommen. Sie erhob sich wieder, ging zum Besenschrank, holte den Staubsauger hervor, steckte ihn in die Steckdose, schaltete ihn ein und begann, sich mit dem Saugrohr zu befriedigen.“ Ihre beiden Betreuer fanden das nicht nur lustig. Lucy war eigentlich gar kein Affe mehr: „Sie war gestrandet, befand sich irgendwo zwischen den Arten.“ Das zeigte sich, als man schließlich versuchte, sie in Gambia in einem „Chimpanzee Rehabilitation Trust Camp“ auszuwildern, aber sie ängstigte sich zu sehr vor den anderen dort bereits ausgewilderten Schimpansen und das Nahrungsangebot in der neuen Freiheit ekelte sie an. Ihre Babysitterin, die angehende Biologin Janis Carter, die sie auf der Insel im Gambia-River an die Freiheit gewöhnen sollte und dafür einige Monate veranschlagt hatte, brauchte acht Jahre, bis sie es geschafft hatte. Am Ende hatte Lucy sich dort mit der Horde von „Problemaffen“, wie sie selbst einer war, abgefunden. Sie ging noch einmal zu Carter und umarmte sie, woraufhin diese in Tränen ausbrach. Lucy klopfte ihr sanft auf den Rücken, als wollte sie sagen, jetzt ist alles okay. Die übrigen Affen machten kehrt und verschwanden wieder im Wald. Lucy stand auf und folgte ihnen. Ein Jahr später fand man Lucys Leiche. Wahrscheinlich wurde sie von Wilderern getötet, denen sie sich arglos genähert hatte. Die Gründerin des „Chimpanzee Rehabilitation Trust Camps“ meinte rückblickend: „Das ganze Projekt war eine einzige Katastrophe.“ Schimpansen, die in einer normalen US-akademischen Mittelschichts-Familie aufwuchsen, könnten nicht an die Freiheit gewöhnt werden. Sie empfänden sich als Menschen, könnten vielleicht rechnen, ein bißchen Gebärdensprache und mit Messer und Gabel umgehen, aber einem Leben in der Wildnis – und wohlmöglich noch unter Affen – seien sie nicht gewachsen.
.
Ähnlich äußerten sich später auch die Schimpansenforscherin Jane Goodall gegenüber Roger Fouts, als der sie fragte, ob er seine nächste Schimpansin, Washoe, der er die Gebärdensprache beigebracht hatte, auswildern solle, weil er keine anständige Unterbringung für sie in den USA fand. Jane Goodall schrieb ihm: sein Vorschlag sei dasselbe, „als würde man ein zehnjähriges amerikanisches Mädchen nackt und hungrig in der Wildnis aussetzen und ihm verkünden, es werde jetzt zu seinen natürlichen Wurzeln zurückkehren“.
.
Fouts arbeitete weiter mit Washoe. Mit fünf Jahren „benutzte sie 132 Zeichen verläßlich und war in der Lage, hunderte weitere zu verstehen“, zudem setzte sie ihre Wörter „zu neuen Kombinationen zusammen“. Z.B. wollte sie einen Zug aus seiner Zigarette, die Fouts gerade rauchte: „Gib mir Rauch, Rauch Washoe, Schnell gib Rauch,“ sagte sie. „Frag höflich“, erwiderte er. „Bitte gib mir diesen heißen Rauch“, antwortete sie. „Es war ein wunderschöner Satz“, dennoch schlug er ihr die Bitte aus. Sie war noch zu jung dafür. Als die das Zeichen für „Blume“ gelernt hatte, benutzte sie es auch für Pfeifentabak und andere interessante Gerüche. Fouts liebte Washoe, er plante ein großes Freigehege für sie und vier weitere Schimpansen, die Washoe inzwischen adoptiert hatte. Ihre internationale Fangemeinschaft „Friends of Washoe“ organisierte eine Spendensammlung, auch die Gemeinde Ellensburg bei Seattle, die stolz darauf war, dass in ihrem Ort jetzt „der klügste Affe der Welt“ lebte, zeigte sich großzügig. 1993 war es so weit: Als Washoe morgens aufwachte, sah sie durch eine Glastür auf eine Graslandschaft mit Klettergerüsten – und mit leuchtenden Augen verlangte sie: „Hinaus, Hinaus!“ Moja und Tatu weigerten sich wochenlang, zurück ins Haus zu gehen. Ihr Lebensraum hieß nun: „Institut für die Kommunikation von Schimpansen und Menschen“ und war ein „Modell, an dem junge Menschen eine nichtinvasive, einfühlsame Form von wissenschaftlicher Forschung kennenlernen können“.
.
Lange hörte man nichts von Washoe, aber dann meldete der „Spiegel“ 2007, dass die 1965 in Westafrika geborene Washoe „in Ellensburg eines natürlichen Todes“ gestorben sei. Auf der Webseite der „Friends of Washoe“ fand ich den Hinweis, dass sie „nach langer Krankheit starb“ (Zigarettenraucherin?). In einem Nachruf schreibt das Gehörlosenforum „my-deaf-com“: „Der einzige lebende Affe zur Zeit, der noch die Gebärdensprache beherrscht, ist die Gorilladame Koko‘. Sie lernte an der Stanford University angeblich mit über 1.000 Zeichen der ASL zu kommunizieren und später annähernd 2.000 englische Wörter zu verstehen.“
.
.
5. Die amerikanische Pavianforscherin Barbara Smuts schrieb über „ihre“ Tiere (in „Sex and Friendship in Baboons“ 1985), die sie jahrelang in der Savanne beobachtete: „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie mußte zuvörderst die Paviankommunikation wenigstens annähernd beherrschen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen.“ Dabei interessierte Barbara Smuts jedoch nicht mehr die Frage ihres Doktorvaters: „Sind Paviane soziale Wesen?“, sondern sie fragte sich selbst: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ Als sie das schließlich im Hinblick auf „ihre“ 123köpfige Affenhorde einigermaßen positiv beantworten konnte – und ihre Forschung dementsprechend voranschritt, kam sie zu dem Schluß, dass die nicht-sprachliche Kommunikation, bei der sich die Körper über Blicke und Grüßen „eng austauschen“, der sprachlichen Verständigung in puncto Ehrlichkeit und Wahrheit überlegen ist.
.
Demnach scheint in der Kommunikation/beim Kontakt eine auf die Beteiligten unmittelbar bezogene Reziprozität der Gesten und Laute gegenüber dem Austausch von Äquivalenten, auf die unsere Warensprache abhebt, stabilere Kollektive/Gemeinschaften zu schaffen. Kann man sagen: der Affe favorisiert soziale Erfindungen, der moderne Mensch technische? Schon der Kieler Meeresbiologe Adolf Remane begann sein 1960 veröffentlichtes Buch über den Stand der Soziobiologie mit dem Eingeständnis, dass „das soziale Zusammenleben den Menschen große Schwierigkeiten bereitet“. Dies war bereits dem „ersten Naturwissenschaftler“ Aristoteles aufgefallen. Als Beweis hatte er u. a. die vielen „Reisegruppen“ erwähnt, in der man sich wegen jeder Kleinigkeit streitet.
.
Dem gegenüber kam die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum bei ihrer 42 Jahre langen Beobachtung von Pavianen in Kenia zu dem Ergebnis, dass in ihren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen sind sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das „wirklich nett“ – nicht zuletzt deswegen, „weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der Nettigkeit‘. OE Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.“
.
Der Anarchist und Ethnopsychoanalytiker Paul Parin hat ebenfalls etwas in einer Pavian-Gesellschaft entdeckt: Er besuchte einmal den Schweizer Pavianforscher Hans Kummer im Hochland von Äthiopien. Gemeinsam schauten sie Abends dem Treiben auf dem Affenfelsen zu. In seiner Geschichte „Kurzer Besuch bei nahen Verwandten“ schrieb Parin: „Es war uns vergönnt, dabei zu sein, wie sich eine Vermutung der Forscher erstmals bestätigte. Zwei ältliche Junggesellen – ihre Namen müßte ich verschweigen, wenn ich sie nicht vergessen hätte – lebten seit langem zusammen und schliefen eng aneinander in einer Felsspalte. An jenem Abend jedoch, in der Stunde der Geselligkeit, näherte sich ein schlanker Jüngling dem einen der gesetzten Herrn, kraulte ihm verstohlen das Fell und bot ihm, wenn der Freund des Alten nicht hinsah, sein hellrotes Hinterteil. Der Strichjunge, wie wir ihn nannten, hatte Erfolg. Dem Freund des Verführten waren die Zärtlichkeiten der beiden nicht entgangen. Jetzt war es zu spät. Aus den Augenwinkeln schielte er hinüber, wie sich sein Freund mit dem Gespielen einließ. Verlegen blickte er zu Boden. Traurig – das sah man seinen müden Bewegungen an – turnte er schließlich den Felsen hinauf und fand einen Platz für seine einsame Nacht. Als es dunkelte, hatte auch das ungleiche Paar genug vom sinnlichen Spiel. Die beiden setzten elastisch hinauf zum gewohnten Schlafplatz der Freunde.“
.
Mir hat an dieser Geschichte besonders der Satz gefallen: „Zwei ältliche Junggesellen – ihre Namen müßte ich verschweigen, wenn ich sie nicht vergessen hätte“: So weit sind wir schon, dass wir die Affen nicht nur benamen, sondern ihnen ihr „Coming-Out“ als Schwule auch selbst überlassen, wenn sie nicht gerade Personen von öffentlichem Interesse sind, was bei diesen drei Pavianen anscheinend nicht der Fall war.
.
Der Wissenssoziologe Bruno Latour ist der Meinung: „Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“ Wie das zu verstehen ist, dazu hat sich der Delphinsprachforscher John C.Lilly geäußert, als er seiner Assistentin, der zukünftigen Walforscherin Alexandra Morton riet, die Tiere bloß nicht zu „zoologisieren“. Sie hat sich dann auch daran gehalten, wie überhaupt die Verhaltensforscherinnen weitaus weniger dazu neigen als die männiglichen Verhaltensforscher.
.
.
6.
Der pensionierte Berliner Pädagoge Wilhelm von Osten bemerkte 1901, dass sein Pferd Hans noch viel mehr konnte als nur seine Droschke zu ziehen – und er begann dessen „Intelligenz“ zu fördern. Als Hans 1895 starb, schaffte er sich einen zweiten Hans an. Nach einem mehrjährigen Unterricht stellte er das Pferd der Öffentlichkeit vor. Zunächst interessierten sich nur einige Kavalleristen und Pferdeschriftsteller für das Tier, das „zählen, rechnen, lesen, Personen und Gegenstände erkennen und auf seine Art bezeichnen“ konnte. Aber als auch der Kaiser Näheres darüber wissen wollte, wurde in der Akademie der Wissenschaften schnell eine prominente Untersuchungs-Kommission gebildet. Sie sollten klären, ob es sich bei Hans um eine echte Begabung oder nur um einen Schaustellertrick handelte. Das war genaugenommen der Anfang eines neuen Faches: „Tierpsychologie“. Zwischen der Wahrnehmungsfähigkeit von Tieren und dem, was man „Telepathie“ nennt, gibt es ein gemeinsames Problemfeld.
.
Beim „Klugen Hans“ kam die Kommission unter der Leitung des Psychologieprofessors Carl Stumpf zu dem Ergebnis: „Das Pferd versagt, wenn die Lösung der gestellten Aufgabe keinem der Anwesenden bekannt ist... Es kann also nicht zählen, lesen und rechnen...Es bedarf also optischer Hilfen,“ die „nicht absichtlich gegeben zu werden“ brauchen. Man müßte das mal genauer erforschen. Der Assistent von Stumpf, Oskar Pfungst, der sich während der Vorführung auf den Trainer von Hans, Herrn von Osten, konzentriert und dann selbst mit dem Pferd experimentiert hatte, u.a. indem er ihm Scheuklappen anlegte, ging in seinem 1907 veröffentlichten Gutachten noch weiter: Er wollte bemerkt haben, dass von Osten „verschiedene Bewegungsarten“ erkennen ließ, „die den einzelnen Leistungen des Pferdes zugrunde liegen, darauf sein eigenes, bis dahin unbewußtes Verhalten zu dem Pferd zu kontrollieren und endlich diese seine unabsichtlichen in absichtliche Bewegungen zu verwandeln.“ Von Osten war demnach doch ein Schwindler. Obwohl strittig blieb, „ob die minimalen Kopfbewegungen des Versuchsleiters in der Größenordnung von 0,5 mm bis 1 mm von dem Hengst überhaupt wahrgenommen werden könnten,“ wie die Tierethikerin Heike Baranzke in ihrem Aufsatz über den Klugen Hans: „Ein Pferd macht Wissenschaftsgeschichte“ schreibt.
.
Einer der Zeugen, der Naturforscher Theodor Zell, veröffentlichte hernach einen eigenen Bericht, in dem er zwar anerkannte, „daß es Herrn von Ostens unbestreitbares Verdienst bleibt, durch jahrelange Übung die im Pferde schlummernde Fähigkeit als Erster auf Gegenstände gelenkt zu haben, die dem Tiere an sich sehr fern liegen, obwohl das Wunder lediglich in der Neuheit der Sache besteht, indem er der Dressur die Methode des Volksschulunterrichtes zugrunde legte...Besonders interessant war dabei, daß der Hengst manchmal trotz der abweichenden Ansicht des Herrn Schillings bei seinem Kopf beharrte und die Stellung des Buchstabens richtig angab. Dagegen halte ich es durchaus für richtig, daß sich kein Tier die Vorstellung von einem abstrakten Begriff, wie es eine Zahl ist, bilden kann...Hiernach sind alle Angaben, daß Tiere in Wahrheit mit Zahlen addieren und subtrahieren können, einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Als einzige Erklärung der richtigen Antwort auf rechnerische Aufgaben bleibt das Gedächtnis übrig.“
.
Die Debatte war damit nicht beendet. Ein reicher Elberfelder Hobbyphysiker, Karl Krall, begann nun Intelligenztests mit Hans anzustellen, wobei er ebenfalls verschiedene Versuche anstellte, um das Übermitteln von Zeichen, bewußten und unbewußten, zu verhindern. In seinem Gegengutachten hieß es dann, dass man bei dem Pferd eine „selbständige Denktätigkeit“ annehmen müsse. Als der Besitzer von Hans 1909 starb, erbte Krall das Tier, das er zusammen mit drei weiteren Pferden, darunter ein blindes namens Berto, in Elberfeld weiter schulte. Laut Heike Baranzke mehrten sich bald „überall in Europa...die Nachrichten von klopfsprechenden Pferden, Hunden und Schweinen“ – geschult nach der „Krallschen Methode“. Noch heute kommt alljährlich im Sommerloch der Presse mindestens ein sprechendes Tier in die Nachrichten. Zuletzt, 2012, war es ein Elefant in Korea. Im Jahr davor ein sibirischer Schlittenhund namens Mishka, der „I Love you“ jaulen konnte. Als klopfsprechender „Wunderhund“ galt lange Zeit der Border-Collie „Rico“, der 1999 „Wettkönig“ in einer „Wetten dass...“-Sendung wurde und mehr als 200 Plüschtiere auf Kommando herbeiholen konnte, wenn man ihm dazu den Befehl gab. Das Leipziger Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung fand zuletzt in mehreren Tests heraus, dass und wie Rico neue Begriffe lernte, was man dort „fast mapping“ nannte. Rico starb 2008.
.
Krall veröffentlichte 1912 ein 500 Seiten umfassendes Werk: „Denkende Tiere. Beiträge zur Tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche: Der kluge Hans, und meine Pferde Muhamed und Zarif“, 1913 gründete er eine Zeitschrift: „Die Tierseele“ und eine „Gesellschaft für Tierpsychologie“. Gleichzeitig wurde jedoch – auf dem 9. internationalen Zoologenkongreß – eine Protesterklärung gegen die „Elberfelder Pferde“ und die „durch keine exakte Methodik gestützten Lehren Kralls“ verlesen, die von etlichen Wissenschaftlern, u.a. vom Kinderpsychologen Karl Bühler, unterschrieben wurde.
.
Der „Kluge-Hans-Fehler“ hatte bis heute anhaltende negative Folgen: Man hat „daraus lediglich eine Konsequenz gezogen, nämlich die, in wissenschaftlich anerkannten Experimenten den Einfluß des Menschen mit allen Mitteln auszuschalten,“ schrieb der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger 1954. Die „positive Folgerung“, die man aus dem „Kluge Hans Fehler“ hätte ziehen sollen, „wäre die genaue Analyse jener störend wirkenden persönlichen Zeichen und die Abklärung ihrer Wirkung gewesen...Die experimentelle, d.h. die ans Laboratorium und dessen übliche Versuchstiere gebundene Tierpsychologie seziert und analysiert immerfort nur die eine Hälfte der tierlichen Psyche, während sie die andere ebenso wichtige Hälfte, die Gefühlssphäre nicht nur unterdrückt, sondern sie sehr oft vollkommen übergeht.“ Bereits 1954 hatte Heini Hediger darauf hingewiesen: „Bei Säugetieren besteht eine weitverbreitete und überraschend hoch entwickelte Fähigkeit, menschliche Ausdrucksweisen ganz allgemein aufs feinste zu interpretieren. Das Tier, und besonders vielleicht das Haustier, ist oft der bessere Beobachter und der präzisere Ausdrucksinterpret als der Mensch...“
.
Dem war man beim „Klugen Hans“ jedoch nicht weiter nachgegangen: „Alle positive Erklärung lag außerhalb unserer Absicht,“ wie es in einem Rundschreiben von Professor Stumpf an die Kommissionsmitglieder hieß. Karl Krall arbeitete derweil in Elberfeld unbeirrt weiter mit dem „Klugen Hans“ und einigen anderen Pferden – bis „Hans“ 1915 starb, danach vertiefte Krall sich in Suggestions- und Telepathie-Forschung. 1925 zog er nach München, wo er das „Krallsche Institut für Tierseelenkunde und Parapsychologische Forschungen“ gründete, und dabei mit dem „Okkult-Professors“ Albert von Schrenck-Notzing zusammenarbeitete. „Um die Gedankenübertragung zwischen Mensch und Tier nachzuweisen“, wie sie sich ihm laut Daniel Gethmann „speziell bei Hunden in deren stillschweigendem Einverständnis mit ihren menschlichen Bezugspersonen zu manifestieren schien, führte er komplizierte Laboruntersuchungen durch, um eventuelle Gedankenwellen zwischen Mensch und Hund aufzufangen.“ Die Tierpsychologin Elisabeth Beck schreibt in einem Beratungs-blog: „Natürlich hatte der Kluge Hans nicht ‚Schuld‘ an der in reinen Verhaltensbeobachtungen und -messungen stagnierenden Tierforschung. Die Ereignisse um dieses geniale Tier scheinen mir jedoch recht deutlich zu zeigen, welche Macht zur Ideologie erstarrte Theorien haben können. Hans hatte mit seiner überragenden Wahrnehmungsfähigkeit den Menschen eine Chance geboten, wirklich Neues über Tiere zu erfahren, alte Theorien zu überprüfen, neue zu entwickeln. Einen Augenblick lang sah es so aus, als würden die Wissenschaftler die Gelegenheit dazu beim Schopf packen. Die Episode endete jedoch in dem, was man das ‚Kluge-Hans-Trauma‘ nennt.“
.
Für einige Künstler stellte dies jedoch gerade eine Herausforderung dar – u.a. für Franz Kafka: Die Forschung spricht von seinem „Elberfeldheft“: Diese Skizze aus dem Jahr 1915, „gibt den familiären und beruflichen Kontext von Kafkas Schreiben verschlüsselt wieder und kleidet die Arbeitsweise des Schriftstellers in die Geschichte eines Studenten, der zur Nachtzeit Experimente mit Pferden betreibt,“ schreibt die Literaturwissenschaftlerin Isolde Schiffermüller. In Kafkas „Elberfeldheft“ heißt es, dass der „junge Mann“ alles über die Elberfelder Pferde gelesen und überdacht hatte – und sich schließlich „entschloß, auf eigene Faust Versuche in dieser Richtung anzustellen und die Sache von vorneherein ganz anders und nach seiner Meinung uvergleichlich richtiger anzufassen als seine Vorgänger.“ Kafka behandelte die Pferde dabei laut Isolde Schiffermüller nicht nur metaphorisch, sondern bezog sich auch „auf ganz konkrete Experimente, nämlich die des Privatforschers Karl Krall.“ Noch konkreter befaßte sich der Literaturnobelpreisträger Maurice Maeterlinck mit den Elberfelder Pferden. Nach Erscheinen von Kralls Buch „Denkende Tiere“ besuchte er ihn und veröffentlichte 1914 einen Aufsatz über dessen Experimente in der „Neuen Rundschau“. Darin bescheinigt er dem von Krall über seine Pferdeschulungsversuche geführten „Elberfelder Protokoll“ die „Beweiskraft photographischer Dokumente“. Die „plötzliche Entdeckung einer mit der unseren eng verwandten Geisteskraft“ hatte bei ihm einen starken Eindruck hinterlassen. Wie Oskar Pfungst in seinem Gutachten führte Materlinck die „Denkfähigkeit“ der Tiere auf eine direkte Beeinflussung durch ihren Trainer zurück, dabei blieb er jedoch nicht stehen, sondern versuchte vielmehr, diese nun zu begreifen. Er vertrat schließlich eine „‚mediumistische‘ Auffassung: Er sah „in ihnen die Mitteilungen einer ‚unerklärten Sensibilität‘,“ einer noch „unbekannten geistigen Kraft“, wie Isolde Schiffermüller schreibt. Auch Kafka hatte angeblich Maeterlincks Aufsatz gelesen. In seinem „Elberfelderheft“ geht es ebenfalls um „praktische Experimente mit einer möglichen Intelligenz und Sprache der Pferde“ – zur „Exploration von subliminaren Geisteskräften, die Tier und Mensch gemeinsam haben,“ schreibt Isolde Schiffermüller: „Die literarische Erforschung einer animalischen Alterität und eines verborgenen Reichtums der Lebewesen schlägt – so wird in Kafkas Protokollen deutlich – eine ganz andere Richtung ein als die der modernen Humanwissenschaften.“ So ist die Geschichte vom Klugen Hans für die junge US-Psychologin Alexandra Horowitz z.B. nur noch eine „bleibende Mahnung, Tieren keine besonderen Fähigkeiten zuzuschreiben, solange sich ihr Verhalten durch einfachere Mechanismen erklären ließe.“ Tiertrainer sollten demzufolge bei Hunden keinen „sechsten Sinn“ vermuten, sondern ihre heimlichen „Hinweise [für sie] unterdrücken“. Wenn es so einfach wäre. Neben Kafka las noch ein weiterer Künstler 1914 den Aufsatz von Maeterlinck: Rainer Maria Rilke: Die „Tatsache, dass in ein paar Pferden, bisher unangerufen, eine Gegenwart des bestimmtesten Geistes wohnt“ beeindruckte ihn so sehr, dass er sich sofort nach Elberfeld aufmachen wollte, aber dann kam ihm der Erste Weltkrieg dazwischen.
.
Nach dem Zweiten interessierten sich einige aus der Lenkwaffenforschung in den Frieden entlassene „Kybernetiker“ für das „Kluge-Hans-Phänomen“ – bei ihrer Beschäftigung mit einer „mathematischen Theorie der Kommunikation“. „Das Wort Kommunikation wird von uns im weitesten Sinne verwendet, um alle Möglichkeiten zu erfassen, mit denen jemand das Bewußtsein eines anderen beeinflußt,“ so formulierte es der US-Mathematiker Warren Weaver in seiner „Theorie“ 1949, in der er auch das Problem behandelte, wie man erkennen könne, dass keine „Kommunikation“ stattfindet. In diesem Zusammenhang brachte er die „Pferde von Elberfeld“ wieder ins Spiel – indem er behauptete, Karl Krall habe auf den Vorhalt, seine Tiere würden „lediglich auf die Kopfbewegungen ihres Dompteurs reagieren“, die Pferde selbst gefragt, ob sie solche kleinen Bewegungen überhaupt erkennen könnten, worauf sie nachdrücklich mit „Nein“ geantwortet hätten.
.
Der Grazer Medienwissenschaftler Daniel Gethmann hat diese Anekdote zum Ausgangspunkt seiner kommunikationstheoretischen Überlegungen zur „Übertragung“ genommen in seinem Aufsatz „Sprechende Pferde“. Für ihn hatte sich bereits in dem Pfungst-Gutachten von 1907 die „kommunikative Perspektive“ umgekehrt: „Es war nicht länger Hans, der spricht, sondern von Osten, dessen Körpersprache die entscheidenden Signale gab. Im neu entdeckten Kommunikationskanal hatte der Sprecher in ‚Hufsprache‘ die Rolle des Empfängers inne, der ‚minimale unabsichtliche Bewegungen‘ wahrnahm. Sprache wurde zu Rauschen, während aus unmerklichen Bewegungen Information entstand...Sobald das Kommunikationssystem und damit die technische Übertragung der unwillkürlichen Zeichen identifiziert war, erwies sich experimentell, dass man mit einem ‚Signaltier‘ nicht nicht kommunizieren kann. Die Theorie der Übertragung kommunikativer Zeichen war damit um das ‚Kluge-Hans-Phänomen‘ reicher.“
.
So wurde es 1980 auf einer gleichnamigen Konferenz der New Yorker „Academy of Sciences“ genannt. Auch Heini Hediger kam dort noch einmal auf das Pferd zu sprechen, wobei er erneut gegen die Eliminationsmethoden der Biologen Stellung bezog: Das Kluge-Hans-Phänomen sei kein Austauschprozeß zwischen einer chemischen Substanz und einem Subjekt, sondern eine sehr viel komplexere Beziehung zwischen Experimentator und Tier.“
.
Man kann sich diesem „Phänomen“ auch noch anders nähern: Thomas Mann verkehrte in München gelegentlich im „Klub“ des oben bereits erwähnten „Okkult-Professors“ und „Hypnosearztes“ Albert von Schrenck-Notzing, dem sich, wie ebenfalls erwähnt, der Elberfelder Tierpsychologe Karl Krall anschloß. Im „Klub“ saß Thomas Mann u.a. mit dem Magenspezialisten Dr. Loeb am Kamin und befragte ihn über Hundekrankheiten. Er arbeitete an einem Buch über seinen Mischlingshund „Bauschan“. Es erschien gleich nach dem Ersten Weltkrieg, zunächst als Privatdruck, mit dem Titel „Herr und Hund. Ein Idyll“. Für den Hundeexperten Konrad Lorenz war das Buch „die schönste Schilderung der Hundeseele“.
.
Thomas Manns jüngste Tochter, Elisabeth Mann-Borgese, eine Seerechtsexpertin und Gründern des maltesischen „Ocean Institutes“ sowie Mitgründerin des „Club of Rome“ und der Zeitschrift „Mare“ erzählte 1991 dem Filmemacher Amadou Seitz, der zuvor an der Verfilmung des Thomas-Mann-Romans „Der Zauberberg“ beteiligt gewesen war: „Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Meine Eltern hatten immer Hunde und ich war ein Hundenarr.“ Das Interview wurde in Kanada geführt, wo Elisabeth Mann-Borgese allein mit ihren Hunden lebte, auf die Frage, ob sie nicht, besonders im Winter, manchmal etwas einsam sei, antwortete sie: „Nein, nein. Ich habe ja immer den Hundebetreuer, der auch hier wohnt.“ Und den braucht sie auch, weil sie viel unterwegs ist – im Dienste des Meeres.
.
.
7.
Der Religionsphilosoph Klaus Heinrich war Mitbegründer der Freien Universität und seine „Dahlemer Vorlesungen“ ein Ereignis. Er hatte sich 1964 mit einer umstrittenen Streitschrift habilitiert: „Versuch über die Schwierigkeit, nein zu sagen“. Dieser 218seitige „Versuch“ erwies sich wenig später als fast der einzige Theorie-Beitrag zur „antiautoritären Bewegung“ in Westberlin (die meisten kamen von der „Frankfurter Schule“). Der Heinrich-Schüler Cord Riechelmann schreibt: „Die religionsphilosophische Studie, die ‚in einer Welt, die zu Protesten Anlaß bietet‘, die Formel vom Neinsagen untersuchte, wurde in ihrer geistigen Fernwirkung zu einem Stoff, der den Protest der Studenten in den späten Sechzigerjahren fütterte.“ Nicht einmal der später fast unvermeidlich werdende „Exkurs über Buddhismus als Ausweg“ (die buddhistische Logik der Verneinung) fehlt in diesem „Frühwerk“, das den „induktiven Verfahren“ den Vorzug gibt: „Erst die Mittel heiligen den Zweck!“
.
Ein erstarkender Protest ist ein anschwellendes „Nein“. In vielen asiatischen Despotien fällt es noch heute den Menschen selbst im Alltag schwer, „Nein!“ zu sagen. In Indonesien z.B. gibt es sieben Worte für „Ja!“, von denen zwei auch ein „Nein“ bedeuten können. Wenn mein vietnamesischer Bekannter etwas im Gespräch verneinte, nickte er und sagte: „same same but different“. Aus dem anfänglichen „Nein!“ des studentischen Protests wurde „kritisches Denken“. Die in Berlin lebende Schriftstellerin Yoko Tawada hat diese Haltung zur Welt (die Adorno als lebensnotwendigen „bösen Blick“ bezeichnete) wunderbar herausgearbeitet (in „Talisman“ 2011). Als Japanerin war ihr dieser Drang zur Kritik so fremd, dass sie ihn sich schnell wieder abgewöhnt hat. Ähnliches gilt für den Wissenssoziologen Bruno Latour, für den die „Kritik“ zu viel bodenloses Nein enthält, weswegen man fürderhin besser auf sie verzichten sollte.
.
Muß man sich das „Nein!“ nun aber (mühsam) erwerben oder wird man damit (leichthin) schon geboren? Solche Fragen stellen sich Lebenswissenschaftler. 2007 starb Alex, der „Professor unter den Papageien“. Er hatte in seinen 31 Jahren bei seiner Besitzerin, der Psychologiedozentin Irene Pepperberg, die ihm unentwegt Worte und Zahlen beibrachte, gelernt, auf verschiedene Weise „Nein!“ zu sagen. In Pepperbergs Buch „Alex und Ich“, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, heißt es: „Während unserer Arbeit lernte Alex, Nein zu sagen. Und Nein hieß dann auch Nein.“ Bis es so weit war, hatte er es erst einmal auf die unter afrikanischen Graupapageien übliche Weise zu „sagen“ versucht: laut kreischen, beißen, oder, „wenn er keine Lust mehr hatte, auf die Fragen eines Trainers zu antworten, die betreffende Person ignorieren“, ihr den Rücken zukehren, sich ausgiebig putzen...Meist kam er damit durch, seine „Trainer“ verstanden ihn: „Subtil war unser Alex nicht gerade,“ meint Irene Pepperberg. Aber dann reichte ihm diese „Sprache“ nicht mehr im Umgang mit seinen Betreuern. Diese sagten häufig „Nein [bzw. No], wenn er etwas falsch identifizierte oder etwas anstellte.“ Irgendwann bemerkten sie, „dass Alex in Situationen, in denen ein ‚No‘ angemessen gewesen wäre, ein Laut wie ‚Nuu‘ hervorbrachte“. Irene Pepperberg, sagte daraufhin zu ihm: „Gut, dann können wir Dir auch gleich beibringen, das richtig schön zu sagen.“ Schon bald verwendete Alex „diese Bezeichnung, um uns zu signalisieren: ‚Nein, das mag ich nicht!'“ In einem Dialog mit seiner Sprachtrainerin Kandia Morton hörte sich das folgendermaßen an: „K: Alex, was ist das? [ein quadratisches Holzstück hochhaltend]
.
A: Nein!
K: Ja. Was ist das?
A: Vier Ecken Holz [undeutlich aber richtig]
K: Vier. Sag es schöner!
A: Nein!
K: Ja!
A: Drei...Papier [völlig falsch]
K: Alex. Vier, sag vier.
A: Nein.
K: Komm schon.
A: Nein.“
.
Laut Irene Pepperberg genoß Alex seine wachsende Publicity immer mehr: Kameras, Mikrophone, staunendes Personal, freudige Trainer und Fans etc.: „Er stand nun mal gerne im Mittelpunkt. Dann trat ein gewisses Glitzern in seine Augen, er plusterte sich auf – im übertragenen Sinne – und nahm die Pose des Stars an.“ Irgendwann war er jedoch das ewige Sprachtraining und auch die wachsende Aufmerksamkeit leid: „In puncto Verweigerung wurde er umso kreativer, je älter er wurde,“ schreibt die Autorin, dann freute sie sich aber doch: „Alex versteht die Bedeutung des Begriffs ‚Nein'“. Sie folgerte daraus sofort positiv – ganz im Sinne ihrer Projektbeschreibung: „Sein Ausdruck eines negativen Konzepts war durchaus schon als fortgeschrittenes Stadium sprachlicher Entwicklung zu betrachten.“
.
Diese zu fördern (bis hin zur Mathematik) war allerdings teuer, zudem kamen dann noch zwei Papageien dazu, wechselnde Assistenten, das Labor, das Büro, ein Zimmer für jeden Vogel usw..Pepperberg gründete eine „Alex Foundation“, ließ sich scheiden und hielt Vorträge bei den Verbänden der amerikanischen Papageienfreunde, wobei sie stets darauf hinwies, dass es soziale Vögel seien und man sie deswegen nicht allein und in Käfigen halten dürfe. Sie bräuchten viel Beschäftigung und Ansprache. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelte sie nichtsdestotrotz einen „elektronischen Babysitter“ und „Unterhalter“ für Alex, bei dem er mittels eines Joysticks Bilder, Filme und Musikstücke auswählen konnte. Alex interessierte sich nur für die Musik, bei der er mitpfiff und -tanzte.
.
1981 war es bereits zu einem ersten Reduzierung der finanziellen Förderung ihrer Forschung gekommen. Auch bei Pepperbergs Kollegen, die alle mit Schimpansen arbeiteten, denen sie die Taubstummensprache beibrachten, einige auch das „Kommunizieren“ mit einer Art von elektronischer Schreibmaschine. In New York veranstaltete die Academy of Science in dem Jahr einen Kongreß mit dem Titel „Das Kluge Hans Phänomen“. Hauptredner war ein Affenforscher, der bewies, dass sein Affe „Nim Chimpsky“ ihn jahrelang hinters Licht geführt hatte: Nim hatte keine Ahnung von Grammatik, obwohl er zehn Sprachlehrer gehabt hatte. Die Papageien- und Affenforscher, die ihrenTieren menschliche Sprache beizubringen versuchen, würden sich ihre Erfolge nur einbilden. Es handele sich dabei nicht um Intelligenz-, höchstens um Gedächtnis-Leistungen...Die akademische Verneinung lief darauf hinaus, dass dabei bloß „Forschungsgelder sinnlos verschwendet werden.“ Und prompt wurden solche Projekte zunehmend weniger gefördert. Der zweite Einbruch bei der Entwicklung des menschlichen Sprach- und Denk-Vermögens bei Graupapageien kam, als Irene Pepperberg mit Alex noch am MIT arbeitete, das wegen seiner Pionierrolle bei der Algorithmisierung unserer Lebenswelt im Geld nur so schwamm, aber nach dem Platzen der „Dotcom-Blase“ war damit erst einmal Schluß. Die Universität sagte Nein. „Nun hatte ich weder einen Job noch einen Ort, an dem ich meine Arbeit mit Alex und seinen Freunden fortführen konnte.“ Aber irgendwie ging es dann doch weiter – an einer anderen Universität, bis Alex im Herbst 2007 endgültig „Nein“ sagte, und seine Besitzerin darüber fast zusammenbrach. Als in der Weltpresse jedoch überall rührende und rühmende Nachrufe auf Alex erschienen (dessen Name ein Akronym für „Avian Learning Experiment“ – Vogellernexperiment – gewesen war), erholte sie sich langsam und dachte sich: Ich habe doch noch ‚Kyaroo‘ und ‚Griffin‘ – die auch schon ganz schön klug sind. Und Alex hat ja bereits „die Welt der Wissenschaft revolutioniert.“
.
8.
Die indischen Ornithologen nennen sie „Hauskrähen“. Sie werden dort von den „Waldkrähen“ unterschieden. Diese versuchen angeblich jene langsam zu verdrängen. Es gibt also auch dort eine Wanderungsbewegung der Tiere und Menschen vom Land in die Stadt. In Bombay ist die „Hauskrähe“ aber immer noch allgegenwärtig. Sie ist kleiner und wendiger als die hiesigen Krähenvögel. Das gilt für viele Tiere und Menschen in den Tropen, die zudem anders als bei uns zusammenleben, was nicht zuletzt mit der (buddhistisch-hinduistischen) Religion zusammenhängt. Die „Hauskrähe“ wird in Indien, obwohl man weiß, dass sie wegen ihrer Klugheit und Gewandtheit viele andere Vogelarten aus dem „city life“ vertreibt, nicht als „Parasit“ (Räuber) oder „Symbiont“ (Partner) begriffen, sondern als „Kommensale“ – als jemand, der zusammen mit einem anderen von der gleichen Nahrung lebt, ohne diesen zu schädigen. In der Nähe von Bombay, aber nicht nur dort, gibt es ein Altersheim für Tiere, wo man neben diversen Haustieren auch Skorpione und Giftschlangen aufgenommen hat – ebenso alte Krähen, die dem anstrengenden Stadtleben nicht mehr gewachsen waren.
.
–
Nicht nur ich, auch andere Deutsche, die Bombay besuchten – haben in ihren „Reiseberichten“, -Reportagen und „Eso-Forum-Beiträgen“ die Krähen in der Stadt thematisiert:
.
– „
Am Tag als ich auswanderte, in der ersten Nacht in Bombay, haben sich vor meinem Hotelzimmer in einem Baum hunderte von Krähen versammelt und einen Krach gemacht, das ich dachte, das werde ich nie aushalten.....ich kam mir vor wie im Alfred Hitchcock Film! 3 Jahre lebte ich in diesem Hotelzimmer und sie kamen nie mehr in dieser Vielzahl in den Baum. Sie kamen aber jeden morgen an mein Fenster und wenn ich mal nicht aufmerksam war, flogen sie mit meinem Spiegelei davon.“
.
– „
Von Mumbai aus ins Nirgendwo – Indien... eine wirklich andere Welt. Lautes Vogelgekreisch von unzähligen Krähen ...“
.
– „
Mumbai: Überall gab es zutrauliche Krähen.“
.
– „
Schon auf der Fahrt zum Hotel bekamen wir einen recht bunten Eindruck von unserer neuen Umgebung. Wegen des Abfalls, der vielfach am Rand der Straßen herumlag, waren etliche Krähen unterwegs.“
.
– „
Die Türen des Zugs stehen offen, so weht ein Lüftchen durch das Frauenabteil. Müll liegt an den Bahngleisen, fauliger Geruch wabert mir entgegen, vermischt sich mit Smogschwaden, und unzählige Krähen kreischen und picken im verderbenden Unrat.“
.
– „
Personal sehr freundlich, hilfsbereit und effizient. Frühstücksbuffet reichhaltig, große Auswahl, Ambiente im Frühstücksraum sehr angenehm. Poolbereich sehr schön. Allerdings versammeln sich abends hunderte von Krähen in den Palmen; sie fliegen einem kamikazeähnlich über den Kopf hinweg.“
.
– „
Das einzige, was die Poolboys nicht in den Griff bekommen haben, waren zwei tote Fischchen, die wohl eine der 500 Krähen, mit denen wir uns täglich um unsere Nachmittagskekse prügeln, reingeschleppt haben.“
.
– „
Anscheinend bestimmt weniger der Grad der Luftverschmutzung als das Verhältnis der Menschen zu ihrer lebendigen Mitwelt den Artenreichtum der Avifauna in den urbanen Zentren, denn wir haben während unserer jahrelangen Indienreisen noch niemals einen Einheimischen auf einen Vogel schießen oder auch nur einen Stein nach ihm werfen gesehen, sondern die Städter lassen beispielsweise Spatzen in ihren Wohnungen nisten, heben nur nachlässig einen Stock, wenn eine Krähe ihnen wieder einen Fisch geklaut hat.“
.
–
Ein Amerikaner: „In Mumbai auf Einladung des Rotary Clubs. Ich liebe fremdes Essen und das Essen ist auf solchen Veranstaltungen immer ausgezeichnet. Wir schießen Krähen und töten riesige Ratten, aber bei den Affen regt sich die Öffentlichkeit hier furchtbar auf.“
.
– „
Dunkle Wolken haben sich am Himmel zusammengezogen, so dass sich die Hochhäuser der entfernten Bombay-Skyline dramatisch gegen einen kobaltgrauen Hintergrund abzeichnen. Als ob sie dieses stimmungsvolle Bild vervollständigen möchten, kreisen Scharen von Krähen wie in einem Hitchcock-Film kreischend über unsere Köpfe hinweg.“
.
– „
Umringt von einer Mauer stehen Siebziger-Jahre-Hochhäuser mit vergitterten Fenstern, in denen sich unser Apartment befindet. Schwärme von kreischenden Krähen umkreisen sie – daher die Gitter. Was für eine Ankunft. Als uns gerade erklärt wird, wie ein indisches Badezimmer funktioniert, ruft aus der Ferne der Muezzin in das Morgengrauen hinein, begleitet von den Krähen. Und so warm es auch ist. Es ist das kalte Grauen. Dazu die Gerüche.“
.
– „
Ich schreibe dies in einem Hotelzimmer von Bombay. Alle halbe Stunde schaut Riyaz vorbei und fragt, ob ich etwas zu trinken oder zu essen möchte. Natürlich ist ihm langweilig und er will sehen, ob ich vielleicht schon fertig bin. Sobald er wieder aus dem Zimmer ist, kommt die Krähe vom nahe gelegenen Baum zurück auf den Fensterrahmen, wo sie die ganze Zeit hockt, und mir aufmerksam zuhört, was ich ihr für Fragen über ihr Land stelle...“
.–
Mir sind die Krähen in Bombay zunächst nicht groß aufgefallen, auch in Berlin sieht man sie täglich und nahezu überall, wenn auch nicht so viele auf einmal. Angeblich sollen sie seit 2010 die Tauben aus der Stadt vertreiben. Wir wohnten 1999 in Bombay im 12.Stock eines Hochhauses. Die Mieterin, die uns ihre Wohnung für einige Wochen überließ, hatte jeden Tag zu einer bestimmten Stunde einen kleinen Heuballen von ihrem Küchenfenster auf das Parkdeck geworfen, wo eine der heiligen Kühe schon darauf wartete. Diesen Fütterungsdienst übernahmen wir nicht, dafür stellten wir irgendwann kleine Futterexperimente mit den Krähen an, die täglich zwischen den Hochhausschluchten hin und her flogen und alles genau beobachteten. Wir legten Wurst-, Brot- oder Käsestückchen auf die Fensterbretter. Es dauert oftmals keine Minute, bis eine Krähe sie fand. Ich empfand das als eine ziemliche Leistung – bei den vielen Fenstern und der geringen Größe des Futters. Jedenfalls konnte ich mir nicht vorstellen, dass unsere mitteleuropäischen Krähen ähnlich aufmerksam sind und vor allem so wenig Scheu zeigen, d.h. derartig schnell reagieren.
.
–
Ich habe jedoch wenig persönliche Erfahrungen mit Krähen. In den Fünfzigerjahren hatte ich einmal eine am Flügel verletzte Nebelkrähe gefangen, die ich in meinem Zimmer pflegte – und mit Fleischstückchen fütterte. Sie hackte jedesmal nach meiner Hand und kackte alles voll, schien überhaupt unglücklich und ständig schlecht gelaunt zu sein. Ich war froh, als sie einigermaßen wiederhergestellt war und ins Freie entlassen werden konnte.
.
–
In Bombay fing ich dann an, jeden nach den Krähen zu fragen. Fast alle wußten eine Geschichte über sie zu erzählen. Am Häufigsten wurde mir berichtet, dass die Krähen oft ungebeten in die Wohnung oder auf die Veranda kommen, um sich Lebensmittel zu stehlen. Aber wenn man sie wirklich benötige, würden sie sich rar machen. Es gibt dort den Brauch, dass sich am Jahrestag eines Verstorbenen seine Freunde und Verwandten zu einem Festmahl versammeln, das aus dem Lieblingsgericht des Toten besteht. Und dabei gebührt einer zufällig vorbeikommenden Krähe der erste Bissen. Diese läßt jedoch gerade bei solchen Gelegenheiten, da sie direkt eingeladen ist, nicht selten stundenlang auf sich warten, so dass das Essen kalt wird. Die Krähen werden dabei nicht als zufällig Angeflogene begriffen, sondern als Wiedergeburt der Seele oder einer der Seelen des Verstorbenen, die sich mit ihrer kurzen Teilnahme am Essen dafür bedankt, dass man an sie gedacht hat.
.–
Eine solche Geschichte, die ich mehrfach gehört habe und der ein Seelenwanderungsglaube zugrunde liegt, wird ähnlich auch von Abodh Aras, einem jungen Mann aus Bombay, erzählt: Nachdem sein Großvater gestorben war, erschien eines Tages eine Krähe am Fenster und rief „Abodh, Abodh“. Seine Großmutter war davon überzeugt, dass sie die Seele ihres Mannes verkörperte, zumal die Krähe dann auch noch besonders gerne „Chakli“ aß, ein Reismehl-Gebäck, das der Großvater immer besonders geliebt hatte. Der Vogel nahm die Gebäckkringel aus der Hand von Abodh Aras. Nach einiger Zeit kamen immer mehr Krähen angeflogen. Noch heute kommen täglich welche zu ihm und warten auf dem Fensterbrett seines Eßzimmers darauf, dass er ihnen was zu Essen gibt, wobei jede gewisse Vorlieben hat.
.
–
Inzwischen kennt sich Abodh Aras mit der Vogelwelt in seiner Stadt aus und ebenso die Literatur darüber. Bereits Mark Twain hat 1896 über die Krähen von Bombay in seinem Buch „Meine Weltreise nach Indien“ mehrere Seiten geschrieben, er nennt sie die „Vögel der Vögel“. Auch in der lokalen Presse ist immer mal wieder von den Krähen die Rede: Mal wird berichtet, dass sie die Eulen attackieren, und ebenso die armen Tiere im Bombay-Zoo, wo sie es besonders auf die Elefanten abgesehen haben, ein andern Mal, dass es den Kuckucken nach wie vor gelingt, den Krähen ihre Eier in die Nester zu legen, die sie dann ausbrüten und großziehen, und dass sie die Spatzen aus der Stadt vertrieben haben, was Abodh Aras jedoch bezweifelt: Es waren seiner Meinung nach die Menschen.
.
–
Dies ist auch die Meinung des stellvertretenden Direktors der „Natural History Society“ von Bombay, Ranjit Manakadan. „So next time, you look at your own indian crow in disdain, think twice and give it the respect due to the fitteste survivor among birds,“ rät er, der im übrigen behauptet, dass die Bombay-Krähen, selbst wenn sie gelegentlich kleine Kinder attackieren, dies nur aus Spaß tun – um sie zu erschrecken.
.
–
Es gibt dort jedoch auch noch die Geschichte von einer Frau in Bombay, die ein Krähennest im Baum vor ihrem Fenster zerstörte, woraufhin sich die Krähen zusammentaten und sie fast ein Jahr lang angriffen, sobald sie das Haus verließ. Derartige Geschichten kennt man auch von unseren Krähen – aus der Presse, wobei sie hier jedoch regelmäßig die Krähenvernichter auf den Plan rufen.
.
–
Madame Blavatsky, die Begründerin der Theosophie hielt sich viele Jahre in Indien auf, 1885 berichtete sie: „Das erste, was einem in Bombay auffällt, sind die Millionen Krähen und Geier. Sie sind die Abfallbeseitiger; eines der Tiere zu töten, ist nicht nur polizeilich verboten, sondern erregt auch die Aggression der Hindus, die stets bereit sind, ihr Leben für das einer Krähe hinzugeben.
.
Der schreckliche Krach, den die Krähen sogar Nachts machen, ist einem erst unheimlich, aber dann kommt man dahinter, dass alle Zuckerpalmen und Kokospalmen in und um Bombay herum von der Regierung verpachtet werden. Man zapft sie an und hängt ausgehöhlte Kürbisse an die Stämme. Der Saft, der dort reinfließt fermentiert und wird zu einem berauschenden Getränk: „toddy“ (Palmwein, den man zu Rum weiterverarbeiten kann). Die Kürbisse werden zwar von sogenannten „toddy-Walas“ regelmäßig gelehrt, aber da die Krähen in den Palmen ihre Nester haben, trinken sie natürlich immer wieder davon. Mit dem Ergebnis, dass diese lärmenden Vögel ständig berauscht sind. Wenn sie in unserem Garten auf einem Bein um uns herum tanzten, hatten diese betrunkenen Vögel definitiv etwas Menschliches und einen schelmischen Ausdruck in ihren listigen Augen.“
.
–
Ergänzt sei: Die Geier lebten u.a. von den menschlichen Leichen auf den „Türmen des Schweigens“ der Parsen – Anhänger des Zarathustra, die einst aus Persien u.a. nach Bombay geflüchtet waren. Da sie immer weniger werden, nicht zuletzt, weil ihre Kinder zunehmend homosexuell orientiert sind, haben die Geier schon seit langem nicht mehr genug zu fressen – und hauen ab. Es wurden von den Parsen bereits neue Geier illegal aus Pakistan eingeführt, aber auch diese blieben nicht lange in der Stadt. Und die Krähen können sie nicht ersetzen, sie essen zwar am Liebsten Fleisch, aber sie können die Leichen mit ihrem leichten Schnabel nicht „aufbrechen“.
.

–
Die Parsen werden auch „Crow-Eater“ genannt, wahrscheinlich weil sie als nicht-hinduistische und nicht-moslemische Minderheit verschiedene Tabus der Hindus und Moslems angeblich nicht für sich akzeptieren. Siehe dazu die pakistanische Novelle von Bapsi Sidhwa: „The Crow-Eaters“ (Reprint 2006), was die Tabus darin betrifft, ist die Hauptfigur, ein Parse „mindful of all possible Sacred Crows,“ schreibt Asif Farrukhi anläßlich der Übersetzung der Novelle von Sidhwa in Urdu. In Wirklichkeit ist es eher umgekehrt, dass höchstens die Krähen dort wie erwähnt Parsen-Eater sind – nach deren Tod.
.
Rund zehn Jahre später ging Mark Twain auf eine Weltreise und landete in Bombay, wo er bereits in der ersten Nacht im Hotel von den dortigen Krähen akustisch derart belästigt wurde, dass er erst nach Mitternacht, als sie endlich Ruhe gaben, einschlafen konnte. „Morgens um halbfünf ging der Spektakel aber von neuem los,“ schrieb er. „Und wer hat ihn angefangen? Die indische Krähe, dieser Vogel aller Vögel. Mit der Zeit lernte ich ihn näher kennen und war dann ganz in ihn vernarrt. Ich glaube, er ist der durchtriebenste Spitzbube, der Federn trägt und dabei so lustig und selbstzufrieden wie kein anderer. Er ist öfter wiedergeboren als der Gott Schiwa und hat bei jeder Seelenwanderung etwas zurückbehalten und es seinem Wesen einverleibt. Jedesmal hat er ein gottloses, sündhaftes Leben geführt, bloß weil es ihm das größte Gaudium machte. Und das Ergebnis der stetigen Ansammlung aller verwerflichsten Eigenschaften ist merkwürdigerweise, daß er weder Sorge, noch Kummer, noch Reue kennt; sein Leben ist eine einzige Kette von Wonne und Glückseligkeit, und er wird seiner Todesstunde ruhig entgegengehen, da er weiß, daß er vielleicht als Schriftsteller oder dergleichen wiedergeboren wird, um sich dann womöglich als ein noch Durchtriebener behaglicher zu fühlen denn je zuvor.
.
Die Krähe ist ein Vogel, der nicht schweigen kann; er zankt, schwatzt, lacht, schnarrt, spottet und schimpft beständig. Seine Ansicht äußert er über alles, auch wenn es ihn gar nichts angeht, mit größter Heftigkeit und Rücksichtslosigkeit. Ich
glaube, die indische Krähe hat keinen Feind unter den Menschen. Sie wird weder von Weißen noch Mohammedanern belästigt, und der Hindu tötet schon aus religiösen Rücksichten überhaupt kein Geschöpf; er schont das Leben der Schlangen, Tiger, Flöhe und Ratten. Wenn ich an einem Ende auf dem Balkon saß, pflegten sich die Krähen auf dem Gitter am andern Ende zu versammeln und ihre Bemerkungen über mich zu machen; nach und nach flogen sie näher herzu, bis ich sie fast mit der Hand erreichen konnte. Da saßen sie und unterhielten sich ohne Scham und Scheu über mich – bis ich es vor Verlegenheit nicht länger aushalten konnte und sie wegscheuchte. Darauf kreisten sie eine Weile in der Luft, unter Geschrei, Gespött und Hohngelächter, kamen dann wieder auf das Gitter geflogen und fingen die ganze Geschichte noch einmal von vorne an.
.
In wahrhaft überlästiger Weise zeigten sie aber ihre gesellige Neigung, wenn es etwas zu essen gab. Ohne daß man ihnen erst zuzureden brauchte, kamen sie auf den Tisch geflogen und halfen mir mein Frühstück verzehren. Als ich einmal ins Nebenzimmer ging und sie allein ließ, schleppten sie alles fort, was sie nur tragen konnten, und obendrein lauter für sie ganz nutzlose Dinge. Man macht sich keinen Begriff davon, in welcher Unzahl sie in Indien vorkommen, und der Lärm, den sie verursachen, ist nicht zu beschreiben. Ich glaube, sie kosten dem Land mehr als die Regierung, und das ist keine Kleinigkeit. Doch leisten sie auch etwas dafür, und zwar durch ihre bloße Gegenwart. Wenn man ihre lustige Stimme nicht mehr zu hören bekäme, so würde die ganze Gegend einen trübseligen Anstrich erhalten.“
.
.
9. Es verwundert nicht: I
n letzter Zeit hat sich eine Art Vogelschutzgebiets-Prosa etabliert, d.h. es mehren sich die Romane, die gewissermaßen um ein Vogelschutzgebiet kreisen. Erwähnt sei u.a. ein Vogelschutzgebiet an der aserbaidschanischen Küste des kaspischen Meeres: die Halbwüste Sirvan, wo es vor allem um den Schutz einer seltenen Trappenart geht. Von ihnen ist ein ganzer Trupp „Heger“ existentiell abhängig; ihr Brigadier wird „Der Perser“ genannt, und so heißt auch der Roman des in Baku aufgewachsenen Physikers und „Geopoeten“ Alexander Ilitschewski, der mit dem „Perser“ einst zur Schule ging. In seinem dicken Roman wird die von weitgreifenden Gedanken erfüllte Idylle im Abseits von saudi-arabischem Kapital zerstört: Wegen der immer fanatischer werdenden Hinwendung der müßigen Saudis zur Falkenjagd wurden die Trappen auf der arabischen Halbinsel ausgerottet, deswegen erkaufen sie sich bei der aserbaidschanischen Regierung das Recht, mit ihren Falken im Trappen-Schutzgebiet zu jagen. Sie bringen 100 Falken mit. Das macht für die Dauer ihres Jagdausflugs 2000 Trappen, rechnet „Der Perser“ seiner Hegertruppe vor. Heimlich bringen sie daraufhin so viele Zuchttrappen wie sie fangen können auf eine unbewohnte iranische Insel im Kaspischen Meer, um sie dort auszusetzen. Die saudischen Falken können nur noch wenige im Nationalpark erwischen, ihre Scheichs beschweren sich bei der Regierung. Diese veranlaßt den Umweltminister, den Nationalpark Sirvan zu schließen – bis die Saudis sich beruhigen. Fortan haben die Heger keine Arbeit mehr und zerstreuen sich in alle Himmelrichtungen. Der Autor plant noch zwei weitere Bände. Bisher lebten und arbeiteten sie im Nationalpark, da sie aber nur selten Gehalt bekamen, fingen sie Falken, die sie für viel Geld auf dem Falkenmarkt im pakistanischen Quetta verkauften. Ansonsten tauschten sie Schwäne in Baku und Umgebung gegen Lebensmittel.
.
Nicht von zu wenig Kapital, sondern von zu viel – nämlich vom Öko-Kapital – wird ein Vogelschutzgebiet in der brandenburgischen Prignitz, dem Brutrevier der vom Aussterben bedrohten Kampfläufer, ausgelöscht. Die Investoren wollen dort, in nächster Nähe des Dorfes „Unterleuten“ (was auch der Titel des Romans von Juli Zeh ist), zehn Windkraftanlagen aufstellen – und können das auch gegen alle naturschützerischen Abwehrmaßnahmen durchsetzen, woran schließlich die Gemeinschaft des davon unmittelbar betroffenen, z.T. davon aber auch profitierenden Dorfes „Unterleuten“ zerbricht. Auch die dortige Kampfläufer-Population wird sich wegen der riesigen WKA-Rotoren woanders ansiedeln.
.
Das taz-Magazin „zeozwei“ hat gerade Juli Zeh interviewt – und dabei gefragt: „In ihrem Roman ist einer der Protagonisten ein klassischer urbaner Linker, er hat die Grünen mitgegründet und gegen Atomkraft gekämpft. Jetzt ist er auf dem Land und kämpft gegen Windkraftanlagen. Was lief da falsch?“ Es lief nichts falsch – im Gegenteil: Er setzte sich als verwaltungssprachlich geschulter Akademiker für die Kampfläufer ein, die zusammen mit den im Schutzgebiet massenhaft rastenden Kranichen „Bird-Watcher“ aus dem In- und Ausland anlocken. Zwar verlor er wegen seines Überengagements im Kampf des Dorfes gegen die Windkraftanlagen dann seinen Job, aber er bekam einen anderen im Vogelschutz. Derart ist sein Werdegang gradlinig geblieben: Grüne, Anti-AKW, Anti-WKA – alles im grünen Bereich also.
.
Es handelt sich bei diesem Roman von Juli Zeh um ökologischen Realismus. In diesem Genre, das zwar aus dem angloamerikanischen Critical SF (wie z.B. „Schöne neue Welt“ von Huxley) kommt, seine Nähe zum sozialistischen Realismus (wie etwa „Der Weg ins Leben“ von Makarenko) jedoch nicht verleugnen kann, geht es stets um die Frage: Wie nahe kommt der Kultur-Schaffende der „Natur“ – oder handelt es sich bei seinem Roman um Etikettenschwindel? Man glaubt es nicht, wieviele Bücher mit Tiernamen im Titel oder mit einem Bild von einem Tier auf dem Umschlag in der letzten Zeit auf den Markt gekommen sind? – Eine reine Irreführung des Konsumenten! Meist machen diese Tiere darin oder darauf nicht einmal als Symbol oder Metapher einen Sinn.
.
Um Kampfläufer geht es auch in dem Roman „Vogelweide“ von Uwe Timm, womit die Vogelinsel Scharhörn neben Neuwerk im Wattenmeer gemeint ist. Auf der baumlosen kleinen Insel brüten neben Möven und Watvögel einige Kampfläufer. Die Person, die den Roman weitgehend allein bestreitet, ist der Vogelwart, der dort lebt und die Vögel zählt. Er ist noch kein passionierter „Bird-Watcher“, sondern ein gescheiterter IT-Unternehmer und seine Haupttätigkeit auf der Insel besteht aus Erinnerungen an die Frauen, mit denen er eine intime Beziehung hatte. Eine Ex besucht ihn dann auch. Es ist also eher eine moderne Beziehungsgeschichte als ein Öko-Roman, auch wenn der Autor sich einige Seiten lang über den Kampfläufer ausläßt – indem er jedoch nur die entsprechende Eintragung in „Brehms Tierleben“ übernahm.
.
Einen eher postmodernen Beziehungsroman veröffentlichte kürzlich die in Brandenburg lebende Amerikanerin Nell Zink. Zunächst steht darin „Der Mauerläufer“, ein im Gebirge lebender Kleiberartiger, im Mittelpunkt – und der Roman heißt auch so. Aber der Ich-Erzählerin geht es dann doch auch eher um sexuell konnotiertes Menscheln, wenn man so sagen darf. Immerhin ist ihr Ehemann ein leidenschaftlicher „Bird-Watcher“ und sie quasi seine Assistentin. Dies verdankt sich der Beeinflussung des berühmten US-Schriftstellers Jonathan Franzen, der gerne über sein „Bird-Watching“ philosophiert und die Autorin überhaupt erst zum Schreiben aufforderte, woraufhin sie nur für ihn eine Probe ihres Romans verfaßte. Dass die Ich-Erzählerin und ihr Mann zunächst in Bern lebten und von dort aus immer wieder in die Vogelschutzgebiete des Gebirges rings um die Stadt aufbrachen (zunächst um ihrem zahmen Mauerläufer namens Rudi zu folgen) rechtfertigt es, diese Geschichte zu den neueren „Vogelschutzgebiets“-Romanen zu zählen. Zumal die beiden dann die Zielgruppe wechseln – und sich für die Erhaltung der Flüsse und Wasservögel engagieren – dafür sogar eine Organisation gründen. Ich lernte bei der Schilderung dieses „Projekts“, dass der Unterschied zwischen einer europäischen Bürgerinitiative und einer amerikanischen „NGO“ darin besteht, dass man sich die Aktivitäten „seiner“ BI etwas kosten läßt, während man mit seiner NGO dafür sorgt, dass einem möglichst viele (oder einige Big) Spender ein aktives Leben finanzieren.
.
Am Konzept der Nationalparks und Tierschutzgebiete wird inzwischen kritisiert, dass diese immobilen eingehegten Reservate dem Zwang und Drang zur Ausbreitung, Wanderung und Veränderung der Flora und Fauna darin nicht gerecht werden. Gleichzeitig ist die Rede vom Naturschutzgebiet Stadt, in die sich alle möglichen Tiere und Pflanzen aufmachen. „Die Dörfer schotten sich gegen die Natur ab, die Städte öffnen sich ihr,“ stellte der Münchner Ökologe Josef Reichholf bereits 2008 fest.
.
Zu den intelligentesten „Kulturfolgern“ gehören die Krähen, die zudem als „Singvögel“ seit 1979 ganzjährig geschützt sind. Deswegen könnte man sagen, dass die Stadt für gewisse Arten durchaus wie ein Nationalpark funktioniert. Die Schriftstellerin Monika Maron hat sich darin auf Rabenvögel konzentriert: auf Berliner Nebelkrähen, ihr Bericht hat den Titel „Krähengekrächz“. Sie hat sich dafür etwas ethologisch Neues ausgedacht, das dem schnellen Ortswechsel dieser Vögel eher Rechnung trägt als das traditionelle – ranschleicherische – „Bird-Watching“ mit Zeiss-Fernglas, Joseph-Beuys-Jacke und jede Menge Männer-Hightech. Zuerst lockte sie eine Krähe mit Futter auf ihren Balkon, dabei tunte sie sich schon mal akustisch auf diesen „Allesfresser“ ein – und kam dann zu der Erkenntnis: „Nicht ich kann mich mit einer Krähe befreunden, sondern nur eine Krähe mit mir.“ Und da sie viel besser sehen können als wir, können sie uns individuell unterscheiden, aber wir sie so gut wie gar nicht. Eingedenk dessen kam Monika Maron auf die Idee, dem blöden Glotzen der Passanten zum Trotz täglich mit einem um sie herum fliegenden Trupp Krähen in der Stadt spazieren zu gehen, wobei sie stets genügend Futter für sie dabei hatte. Es funktionierte, leider ließ sich die Autorin „allein aus literarischer Notwendigkeit“ auf dieses „Krähenexperiment“ ein, und da sie sich als professionelle Schriftstellerin mit Aufwand-Wirkungs-Verhältnissen auskennt, beendete sie das Buchprojekt nach genau 64 Seiten. Sie ersparte sich so eine Auswertung ihrer Beobachtung bzw. Beschreibung, und damit langes Grübeln.
.
.
10.
Die meisten Verhaltensforscher lehnen Empathie und erst recht Telepathie strikt ab, weil dadurch die Ergebnisse verfälscht werden. Die Experimente müssen so objektiv sein, dass man sie jederzeit wiederholen und statistisch auswerten kann. Einzelerlebnisse bzw. -ergebnisse sind bloße Anekdoten.
.
Um deren Qualität endlich in Quantität umschlagen zu lassen, startete der Botaniker Rupert Sheldrake 1998 eine fast globale Anekdotensammlung bei Haustierbesitzern über das Internet. Es ging ihm um eine Untersuchung dessen, was man gemeinhin die übersinnlichen Fähigkeiten von Tieren nennt, die wir nicht ohne Weiteres nachvollziehen können (wenn sie z. B. lange vor den Menschen ein Erdbeben oder eine andere Gefahr spüren). Speziell ging es Sheldrake um das Einfühlungsvermögen von Hunden ihren Besitzern gegenüber. Sheldrake spricht von „gegenseitiger Hilfe“. In seinen bisher gesammelten 120 Berichten über ein derartiges Verhalten von Hunden, so schreibt er in dem Buch „Der siebte Sinn der Tiere“(2003), gehe es immer wieder darum, wie einfühlsam sie auf einen Menschen, der traurig oder krank ist, reagieren.
.
Vor Rupert Sheldrake war bereits der sowjetische Neuropsychiater Wladimir Bechterew in den Zwanzigerjahren dem „siebten Sinn“ von Hunden nachgegangen – im Zusammenhang einer Telepathieforschung, bei der er das Gehirn als Sender und Empfänger von Strahlenenergie begriff. U.a. arbeitete er dabei mit dem Tierdresseur Wladimir Durow zusammen. Durow besaß einen eigenen Zirkus in Moskau, der heute noch existiert. Neben einigen bis dahin als nichtdressierbar geltenden Tieren – wie Igel und Dachse – arbeitete Durow immer wieder mit Hunden, nicht selten zuvor herrenlos gewesene. Aus der Geschichte eines dieser Hunde machte Anton Tschechow die Erzählung „Kaschtanka“, darin geht es um einen mangels „Orientierungssinn“ verwilderten Hund, den Durow in seinem Zirkusunternehmen aufnahm, wo er dann einige „Kunststücke“ vorführte. Die Geschichte seines Dackels „Komma“, der einmal „in Pensa allen herrenlosen Hunden der Stadt das Leben rettete“, erzählte Durow selbst – in seinem Buch „Tiere im Zirkus“ (1969): Er war auf dem Weg zum Gouverneur, um die Erlaubnis für ein Gastspiel seines Zirkus in Pensa einzuholen. Dabei erfuhr er, dass dieser gerade alle herrenlosen Hunde in der Stadt zu töten beschlossen hatte. Um das Unglück abzuwenden, dachte sich Durow eine Blitzdressur aus. Beim Gouverneur brachte er das Gespräch auf Tierdressuren. Als er merkte, dass der nicht viel auf die Klugheit z. B. von Hunden gab, ließ er, um ihm das Gegenteil zu beweisen, seinen Dackel mehrmals Dinge aus dem Büro des Gouveneurs holen, die dieser ihm nannte. Zuletzt brachte „Komma“ dem Gouverneur unaufgefordert eine Petition, in der er um Gnade für die herrenlosen Hunde von Pensa bat. Diese gewährte der Gouverneur ihm dann auch.
.
Solche „Kunststücke“ von Hunden haben sich bewährt, sagen die Evolutionsforscher, sie sind damit jedenfalls viel erfolgreicher als die Wölfe, die stattdessen eher ihre „Wilderness“ verfeinern: Es gibt heute über 40 Millionen Hunde auf der Welt, aber nur noch etwa 40.000 Wölfe, wie der US-Philosoph und Wolfsbesitzer Mark Rowlands als darwinistischen Beweis für größere Fitness vorrechnete. Dem gegenüber meinte die Berliner Publizistin und Hundebesitzerin Katharina Rutschky, dass der Hund sich „unschuldig in einer evolutionären Sackgasse verlaufen“ habe, weil nämlich „der Mensch mit ihm machen kann, was er will“. Aber hat sich diese Unterwerfung unter den Menschen – ihre „komplette Verblödung“, wie der Biologe Cord Riechelmann das nennt – wenigstens für den einzelnen Hund gelohnt? Irgendwie schon: 2002 betrug die weltweit für Haustierfutter und -versorgung ausgegebene Summe bereits 46 Milliarden Dollar, Tendenz steigend, vor allem im Marktsegment ‚Premiumfutter‘. Darüberhinaus wird die Medizintechnik für Hunde immer aufwendiger, es gibt inzwischen psychologische Therapieeinrichtungen und Krankenversicherungen, die für Haustiere bereits zur Normalität werden, wie die US-Biologin und Hundebesitzerin Donna Haraway in ihrem Aufsatz „Hunde mit Mehrwert und lebendiges Kapital“ (2007) schreibt.
.
Bei Durows Dressur von Pikki, einem Foxterrier, war der Neuropsychiater Wladimir Bechterew anwesend, wobei er davon ausging, dass der Hund auf die „mentalen Befehle seines Trainers reagiert“. Durow hatte ihm zuvor seine „Methode“ erklärt: Sie bestehe darin, „die Aufgabe, die der Hund ausführen solle, zu visualisieren – also zum Beispiel ein Buch von einem Tisch zu holen und dann den Kopf des Hundes zwischen seinen Händen zu halten und ihm in die Augen zu sehen. Ich präge in sein Gehirn ein, was ich mir zuvor in mein eigenes eingeprägt habe. Ich stelle ihm mental den Teil des Fußbodens vor, der zum Tisch führt, dann die Beine des Tisches, dann das Tischtuch und schließlich das Buch. Dann gebe ich ihm den Befehl oder vielmehr den mentalen Anstoß: Geh! Er reißt sich wie ein Automat los, nähert sich dem Tisch und packt das Buch mit den Zähnen. Damit ist die Aufgabe ausgeführt.“
.
Bechterew merkte dazu an – in der „Zeitschrift für Psychologie“ (1924): „Es wäre wichtig, nicht nur die Bedingungen zu untersuchen, die die Übertragung des mentalen Einflusses vom Übermittler zum Empfänger regeln, sondern auch die Umstände, die bei der Hemmung wie bei der Ausführung derartiger (bildlich-gedanklicher) Suggestionen von Belang sind. Dies wäre notwendigerweise von theoretischem ebenso wie von praktischem Interesse.“ Der führende sowjetische Psychologe, in dessen Institut später die Weltraumhunde ausgebildet wurden, kam nicht mehr dazu, weitere Forschungen mit Durow durchzuführen, er starb 1927.
.
.
11.
Bei den meisten Tierforschungsprojekten ist das Tier mehr oder weniger fixiert. Nur selten ist es auch einmal umgekehrt. So z.B., als man Rosa Luxemburg 1916 in einem Breslauer Gefängnis inhaftierte, weil sie gegen den Krieg agitiert hatte, und sie dort von ihrem Zellenfenster aus Blaumeisen beobachtete. In den Briefen an ihre Freundin Sophie Liebknecht berichtete sie darüber. Auch der Dichter Ernst Toller forschte in der Haft: 1919 hatte man ihn wegen seiner Beteiligung an der Münchner Räterepublik zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. In seiner Zelle brütete ein Schwalbenpärchen, über das er 1924 ein ganzes „Schwalbenbuch“ veröffentlichte.
.
Der russische Priester Pawel Florenski erforschte in den Dreißigerjahren bis zu seiner Erschießung im sowjetischen Straflager auf den Solowskiinseln Algen, um sie industriell zu verwerten (u.a. als Lebensmittel). In Briefen an seine Kinder berichtete er darüber. 2001 wurden die Briefe von Fritz und Sieglinde Mierau übersetzt und im Anthroposophen-Verlag „Die Pforte“ unter dem Titel „Eis und Algen“ veröffentlicht.
.
Eigentlich sei er mit seiner Isolierung auf den Solowki-Inseln am Ziel seiner Wünsche angelangt, schrieb Florenski seiner Frau. Als Jüngling habe er immer davon geträumt, ins Kloster zu gehen, jetzt lebe er im Kloster, nur dass es eben zum Lager gehöre. Als Kind sei es sein sehnlichster Wunsch gewesen, auf einer Insel zu wohnen, die Gezeiten zu erleben und sich mit Algen zu befassen. „Nun bin ich auf einer Insel, hier herrscht Ebbe und Flut, und ich werde bald mit Algen zu tun bekommen.“
.
Der sieben Jahre in der Bayreuther Psychiatrischen Anstalt inhaftierte Gustl Mollath nahm ein kleines Beerengewächs mit in die Freiheit: eine „Dattelorange“. Für ihn sei dieser Zuchterfolg im Knast ein Zeichen, meinte er: „Wenn man will, kann man vieles durchstehen.“
.
Für Ernst Toller und Rosa Luxemburg war die Vogelbeobachtung mehr ein Zeitvertreib in der Isolation, obwohl Rosa Luxemburg ihrer Brieffreundin gestand, dass sie lieber Biologin als Politikerin geworden wäre – aber die Zeiten waren nicht danach. Auch Ernst Toller kam von der Beobachtung „seiner“ glücklich wirkenden Schwalben sogleich auf das Glück der ganzen Menschheit zu sprechen.
.
Anders die amerikanische Biologin Elisabeth Tova Bailey in ihrem wunderbaren Buch „Das Geräusch einer Schnecke beim Essen“ (2012). Eine schwere Krankheit zwang sie für einige Jahre, im Bett zu liegen. Ihre Freundin besorgte ihr ein Haus auf dem Land und schenkte ihr eine Pflanze, die sie an das Krankenbett stellte. Auf der Pflanze bemerkte die Autorin irgendwann eine Schnecke. Damit sie nicht wegkroch, besorgte sie sich ein Terrarium und beobachtete fortan das Tier darin. Dazu schaffte sie sich jede Menge Literatur über Schnecken an und korrespondierte mit Schneckenforschern in aller Welt.
.
Die meisten Menschen werden quasi aus Versehen Verhaltensforscher: Sie schaffen sich ein Tier oder eine Pflanze an und sind sensibel genug, um wenigstens die Minimalbedürfnisse dieses Wesens einer fremden Art befriedigen zu wollen. Irgendwann wird das zu ihrer Haupt- oder Lieblingsbeschäftigung und schon sind sie auf halbem Wege, um z.B. ein Hunde- oder Rosen-Experte zu werden. „Tatsache ist,“ schreibt Doris Lessing in einem ihrer hervorragenden Bücher über Katzen, „dass jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer mehr über Katzen weiß als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Geliebte Katze‘ oder ‚Cats Today‘ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“
.
Manche „Biophile“, wie die Liebhaber einer anderen Spezies auch genannt werden, merken ihre Neigung erst, wenn es sozusagen zu spät ist, um noch einen Rückzieher machen zu können. Sehr schön und witzig hat das Annemarie Beyer in ihrem kleinen Buch „Mein Leben mit Igor“ beschrieben, dessen Untertitel bereits lautet: „Eines Tages verlor ich den Verstand und kaufte einen grünen Leguan“.
.
Ähnlich erging es der ebenso jungen englischen Historikerin Helen Macdonald. Sie wurde fast irre, als sie in ihrem über fünf Jahre langen engen Zusammenleben mit ihrem Habicht „Mabel“ wunschgetrieben dahin kam, „ein Habicht zu werden“. In ihrem Buch „H wie Habicht“ (2015) schreibt sie: „In meinem Unglück hatte ich den Habicht aber nur in einen Spiegel meiner selbst verwandeltOEIrgendetwas lief schief. Sehr schief.“ Sie erinnert sich an den Anthropologen Rane Willerslev, der das sibirische Volk der Jukagiren erforschte. Dabei erfuhr er, dass „eine solche Verwandlung bei den jukagirischen Jägern als sehr gefährlich gilt, weil man dadurch den Kontakt zur Identität der eigenen Spezies verlieren und eine unbemerkte Metamorphose durchlaufen‘ könne.“
.
Mann kann bei aller Tierliebe auch den Kontakt zur eigenen Spezies verlieren, indem man dabei vereinsamt. Die Leute schaffen sich nicht nur ein Tier an, weil sie einsam sind, sondern vereinsamen auch, weil sie sich ein Tier angeschafft haben. So ging es z.B. dem amerikanischen Moralphilosophen Mark Rowlands, nachdem er sich einen kanadischen Wolf besorgt hatte, den er „Brenin“ nannte – und überall mit hinnahm, daneben joggte er mit ihm zwei Mal täglich ausdauernd. Erst einmal ließ er ihn jedoch abrichten: Mit der „Koehler-Methode“ lernte der Wolf laut Rowlands eine „Sprache“ – und hatte damit „die Chance, auf sinnvolle Weise“ mit seinem Besitzer „zusammenzuleben – statt dass er im Garten hinter dem Haus eingesperrt und vergessen wurde“. Diese Sprache verschaffte ihm „eine Freiheit“ in der „menschlichen Welt“. Mehr noch: „Wir können diese Sprache verstehen.“ Rowlands bekam erst eine Dozentur in Irland und dann eine in Frankreich, Brenin war überall mit dabei, in den Seminaren, auf Partys, in Kneipen, auf Reisen.
.
Als Rowlands merkte, dass er nicht mehr so ausdauernd joggen konnte, schaffte er sich zwei Schäferhunde an, mit denen der Wolf fortan rumjagte. Rowlands Entlastung durch die Hunde hatte jedoch den gegenteiligen Effekt, zumal er auch noch beschlossen hatte, Vegetarier zu werden: „Allmählich zogen wir uns aus der Welt der Menschen zurück“, schreibt Rowlands. Er wurde immer sonderbarer: „Ein moralistischer Vegetarier, das seltsamste aller Geschöpfe, das dazu verurteilt war, den Rest seiner kümmerlichen Existenz ohne die geschmacklichen Wonnen von Tierfleisch zu durchleben. All das war einzig und allein Brenins Schuld, woran ich ihn erinnerte, wenn ich wieder einmal eines seiner Manöver zum Fangen von Kaninchen durchkreuzt hatte.“
.
.
12.
Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz meinte: „Um eine Graugans zu verstehen, muß man als Graugans unter Graugänsen leben, muß man sich ihrem Lebenstempo anpassen. Ein Mensch, der nicht so wie ich von Natur aus mit einer gottgewollten Faulheit ausgestattet ist, kann das gar nicht,“ denn seine zehn Graugänse, mit denen er fast täglich in die Donau-Auen ging, wo sie sich ans Ufer setzten, waren einfach nur „wunderbar faul“, wie er fand. Sein Nachfolger auf der Forschungsstation, Kurt Kotrschal, hat später den Gänsen zwei Jahre lang Sonden implantiert, die ihren Herzschlag registrierten. Dabei kam heraus, dass dieser schon dann extrem in die Höhe schnellte, wenn die Tiere „soziale Kontakte zwischen ihren Artgenossen nur beobachteten!“ Anders gesagt: Lorenz‘ Gänse saßen im Gegensatz zu ihm also gar nicht faul herum, es ging bei ihnen partymäßig hoch her – nur dass sie keine Miene dabei verzogen. Dieser kleine Fortschritt im Wissen über Gänse hatte ein Nachspiel: Einige Tierschützer erboste das Implantations-Experiment derart, dass sie das Institut besetzten. Sie wurden daraufhin angeklagt. Bei der juristischen Klärung vorab, ob der Gänseforscher oder die Gänseschützer ein Verbrechen begangen hatten, ergab jedoch die Abwägung der Tatbestände Tierquälerei versus Hausfriedensbruch, dass das Verfahren gegen sie eingestellt wurde.
.
Das meiste Wissen über Gänse verdanken wir desungeachtet immer noch Konrad Lorenz, der dazu später – im eigenen Institut – auf die Protokolle von Gänsebeobachterinnen zurückgriff. Diese hatten seltsamerweise alle Doppelnamen, waren also wohl feministisch inspirierte Ehefrauen mit einer Festanstellung in seinem Institut. Manchmal erlaubten sie sich in ihren Notizen launige Bemerkungen in Klammern über „ihre“ benamten Gänse – z.B.: „Es sind ja auch nur Menschen!“ oder – bezogen auf einen Ganter namens Uwe, nachdem der nicht auf die Annäherungsversuche der Gans Britta reagiert hatte: „Warum sollte er auch?!“
.
Konrad Lorenz begann seine Gänseforschung bereits 1923 mit wenig Wissen, indem er z.B. seine erste Gans „Martina“ auf sich „prägte“, d.h. er hatte – aus Versehen! – das erste Wort an sie gerichtet, nachdem sie in seinem Brutapparat aus dem Ei geschlüpft war. Martina hatte ihn daraufhin mit einem Auge schief angekuckt und zurückgegrüßt, was wie ein „feines, eifriges Wispern“ klang – und damit war er für immer ihre Mutter geworden. Dies bedeutete, dass er sie bei sich im Bett schlafen lassen mußte. Trotzdem wachte Martina stündlich auf und stieß ein fragendes „Wiwiwiwiwi“ aus – das Lorenz mit einem gebrochenen „Gangganggang“ beantworten mußte, erst dann schlief Martina mit einem leisen „Wirrrr“ wieder ein. Neun weiteren kleinen Gänsen, die Lorenz wenig später ebenfalls auf sich prägte, war dagegen die Geschwisterschar genauso wichtig: Während Martina im Zweifelsfalle stets seine Nähe suchte, was bedeutete, dass er sie überall mit hinnehmen mußte. Der Einfachheit halber nahm er oft die neun anderen gleich mit.
.
Die heute 120 Gänse der Grünauer Forschungsstation, die weitgehend wild leben, werden noch immer als „relativ zahm“ und „ortsfest“ bezeichnet, d.h. sie folgen nicht dem allgemeinen Zug der Graugänse nach Süden – obwohl sich im Herbst durchaus noch eine gewisse „Zugunruhe“ bei ihnen bemerkbar macht. Ihr Verhalten wird dort inzwischen mit Begriffen aus der amerikanischen Gesellschaft analysiert. So beschäftigt man sich z.B. „mit den individuellen Kosten und Nutzen des Soziallebens dieser Vögel,“ wobei sich mindestens der Institutsleiter von einem strengen Darwinismus leiten läßt: „Die einzige gültige Währung im Spiel der Evolution ist, mehr reproduktionsfähige Nachkommen zu hinterlassen, als andere Individuen,“ meint er. Angeblich sehen das auch die Gänse so, denn wie bereits Konrad Lorenz in seinem Buch zur „Ethologie der Graugans: Hier bin ich – wo bist du?“ (1988) schreibt, steigt ein Gänsepaar im Rang seiner Schar im Maße es ihm gelingt, lange zusammen zu bleiben und möglichst viele Jungen groß zu ziehen. Generell gilt zwar, dass Gänse monogam leben – bis das der Tod sie scheidet, aber praktisch geht es auch in einer Gänseschar eher drunter und drüber, wie man so sagt.
.
Dazu eine Protokollzusammenfassung von Lorenz über die 1974 geschlüpfte Sinda, die zusammen mit Alma, Alfra, Jule und Blasius von Sybille Kalas-Schäfer handaufgezogen wurden, sowie die 1973 geschlüpften Florian und Markus, die zusammen mit etlichen anderen Gösseln Brigitte Dittami-Kirchmayer führte. „Zunächst scheint es, als ob Jule mit Markus und Sinda mit Blasius ginge. Später wird Jule oft mit Blasius und Sinda mit Markus gesehen. Offensichtlich ist es die Unklarheit dieser Situation, die allmählich zu einem regelrechten Haß zwischen den beiden Gantern führt. Es kommt wiederholt zu einem Flugkampf zwischen Markus und Blasius.“ Mal unterliegt Markus, mal siegt er – woraufhin „Blasius zusammenbricht und flieht, Markus kommt mit Triumphgeschrei zu Sinda und ihrer Schwester, die noch fest zusammenhalten.“ Die Kämpfe gehen weiter, Blasius muß öfter fliehen, kommt aber stets nach kurzer Zeit wieder. „Markus hält sich in Sindas Nähe auf, aber nicht zu dicht.“ Der Haß der beiden Ganter eskaliert im Frühjahr 1975 in einen dramatischen Luftkampf, dabei wird Blasius verletzt. „In der Folge geht Sinda in dichtem Zusammenhalt mit Markus, zusammen mit Alma fliegen sie in geschlossener Schar. Der Haß zwischen Blasius und Markus bleibt, allmählich kommt es zu einer Überlgenheit des Blasius. Sinda wird einmal eng mit Blasius gesehen. Kurz darauf fliegen Alma, Sinda und Markus zu dritt weg, kommen nach einigen Tagen geschlossen zurück, Blasius etwas später zusammen mit Jule, mit der er nun fest verpaart ist.“ Wenn Sinda Markus sieht, läuft sie ihm sofort entgegen und schnattert mit ihm. Eine Weile zuvor wurde Sinda oft mit Florian und seiner Gattin Nat gesehen. Markus geht nun zwar fest mit Alma, vertreibt aber nach wie vor alle Ganter, die sich für Sinda interessieren. Wenig später „wird Blasius allein angetroffen, ihm fehlen die Schulterdeckfedern. Danach findet man Jule – von einem Fuchs gerissen. Alma und Markus fangen zwei Mal an zu nisten – und brüten schließlich erfolgreich auf einem Nachgelege.“ In seinem Gänse-Buch „Hier bin ich – wo bist Du?“ erzählt Lorenz noch weitaus verwickeltere Beziehungsgeschichten.
.
Ähnlich wissenschaftlich und politisch beseelt wie Konrad Lorenz war der schwedische Jäger und Tierphotograph Bengt Berg, der ebenfalls Gänse erforschte. Was bei Lorenz die Gänsebeobachterinnen mit den Doppelnamen, war bei ihm eine selbstbewußte „dänische Gänsemagd“ ohne Namen. Und was für Lorenz „Martina“ war, wurde bei ihm „die Gans Nummer 5“. In seinem Buch „Die Liebesgeschichte einer Wildgans“ (1930) erzählt Bengt Berg, dass er sechs Gänseeier von einer Pute ausbrüten ließ. Als die Gössel schlüpften, übernahm er sie, wobei er sie beringte – mit Zahlen von 1 bis 6. Die „Nummer 5“ war die „kleinste, zarteste und schüchternste“, deswegen kümmerte er sich besonders um sie. Sie konnte bald, wie ihre fünf Geschwister, fliegen, zog es dann jedoch vor, in Südschweden zu bleiben – auf dem Eis in der Bucht vor Bengt Bergs Haus, wo sie sich „eifersüchtig von einem großen kanadischen Gänserich bewachen ließ (der nicht fliegen konnte).“ Im Frühjahr flog sie jedoch mit einem „jungen Graugänserich herum“. Er durfte dem Kanandaganter nicht zu nahe kommen, d.h. er und die „Gans Nummer 5“ waren nur zusammen, wenn sie aus der Bucht heraus zu ihm flog. Ihr Nest baute sie dann aber „innerhalb der Bucht“ – auf einer Schäre. Während sie mit dem jungen Grauganter unterwegs war, bewachte der alte Kanadaganter ihr Gelege und kümmerte sich dann auch um die Brut, deren Vater er wahrscheinlich war. Sobald die Jungen jedoch fliegen konnten, wurden sie von dem jungen Grauganter – in der Luft – beschützt, vor allem gegen Adler, die damals in Südschweden noch häufig waren und es gerade auf die noch nicht so flugtüchtigen jungen Gänse abgesehen hatten. Die ersten zwei Jahre flog die „Gans Nummer 5“ mit ihrem Grauganter und ihren Jungen im Herbst nach Spanien, in den darauffolgenden Wintern blieb sie aber mit ihrer ganzen Familie bei Bengt Berg. „Da sie die Klügste war, hing alles von ihrer Überlegung und von ihrem Willen ab. Sie hatte das Vertrauen zu mir, weil ich sie großgezogen hatte. Die beiden Ganter folgten ihr, wo sie von sich aus niemals hingegangen wären. Und die Kinder – sie folgten und gehorchten ihr, aber nur ihr“.
.
.
13.
Der Touristenhotspot „Check Point Charly“ ähnelt immer mehr einem Affenfelsen. Aber darum geht es hier nicht, das ist nicht witzig. Affen sind dagegen oft witzig, deswegen versichern wir uns gegenseitig ja ständig, dass sie unsere „nahen Verwandten“ sind. Aber schon allein bei den sogenannten „Menschenaffen“ gibt es große Unterschiede in Witzigkeit. In New York hat eine Gruppe von Zoologen und Zooexperten das Ausbruchsverhalten gefangener Menschenaffen untersucht, sie kamen zu dem Ergebnis: „Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gäbe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen.“ Der Schriftsteller Eugene Linden merkte dazu an: „Auf diese Weise sind die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“ Und das, obwohl sie im Gegensatz zu den Schimpansen in der Freiheit kein Werkzeug benutzen, wenn man vom gezielten Umstürzen morscher Bäume absieht (Termiten graben sie z.B. mit der Hand aus).
.
Die indigene Dayakbevölkerung auf Borneo behauptet, dass die von ihnen „Waldmenschen“ genannten Affen nicht sprechen, weil sie sonst arbeiten müßten. In der Gefangenschaft entwickeln sie sich jedenfalls still und leise zu wahren Ausbrecherkönigen. Eugene Linden erwähnt einige ihrer Fluchtversuche in seinem Buch „Tierisch klug“: Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er dasselbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen – so lange, bis er es geöffnet hatte.
.
Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben – mit anderer Wegsperrtechnologie.
.
Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans allerdings vor der ungewohnten Umgebung. „Auf einer gewissen Ebene wissen die meisten gefangenen Tiere, dass der Zoo der Ort ist, in dem sie leben.“ Von zwei Mitarbeitern an einem Projekt zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Menschenaffen im Nationalzoo in Washington erfuhr Linden von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, diese Affen dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus- und wieder reingegangen.
.
Mit dem Orang-Utan lebt es sich sowieso leichter, wie bereits der Mitbegründer Tierpsychologie Wolfgang Köhler herausfand. Der „Ehrenbürger der Berliner „FU“ wurde nach der Wende Namensgeber des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie zur Kognitionsforschung bei Menschenaffen. Im dortigen Zoo wurde dafür eine Affenanlage namens „Pongoland“ geschaffen, daneben noch ein „Camp“ im westafrikanischen Tai-Nationalpark, um wild lebende, aber an Menschen gewöhnte Schimpansen zu erforschen.
.
Wolfgang Köhler hatte von 1914 bis 1920 die Anthropoidenstation der Preußischen Akademie der Wissenschaften auf Teneriffa geleitet, wo er Untersuchungen über den Werkzeuggebrauch und das Problemlösungsverhalten von Menschenaffen durchführte. 1917 veröffentlichte er über deren „kognitive Leistungen“ ein Buch mit dem Titel: „Intelligenzprüfungen an Anthropoiden“. Seine Affenforschung unternahm er z.T. unfreiwillig, weil er wegen des Kriegsausbruchs nicht von Teneriffa weg konnte: „Jeden Tag Affen, man wird schon selber schimpansoid“, klagte er. Köhler attestierte seinen sieben in Westafrika „frisch gefangenen“ Schimpansen nach einer Reihe „klassischer Intelligenzprüfungen“ eine relative „Gestaltschwäche“. Bei seinem nächsten Forschungsobjekt, dem Orang-Utan-Weibchen „Catalina“, kam Köhler jedoch zu dem Schluß: „Dies Wesen steht uns der ganzen Art nach viel näher als Schimpansen, es ist weniger ‚Tier‘ als sie.“ Und dieser Eindruck resultiere nicht so sehr „aus ihren ‚intelligenten Leistungen‘ als durch das, was man Charakter, Sinnesart o.dergl. nennt.“ Catalina hatte sich während der Experimente in Köhler verliebt. Wohingegen die sieben gefangenen Schimpansen in der Gruppe ihn für ihr ganzes Unglück verantwortlich machten.
.
.
14. Als der Schauspieler Til Schweiger auf seiner Facebookseite ein Video veröffentlichte, auf dem ein Mann mit einer Flasche zwei Feuerquallen zerquetscht, waren sein Fans empört: „Wie gestört kann man eigentlich sein?“ und „Soll ich Tierquälerei jetzt lustig finden???“
.
Die Welt fragte den Hamburger Quallenforscher Gerhard Jarms, ob Quallen Schmerzen empfinden können. Wahrscheinlich nicht, antwortete der. Die Zeitung erinnerte zudem an einen berühmten Quallenversteher: den Jenaer Zoologen Ernst Haeckel: „Alle übrigen Tierformen werden an Schönheit und Zierlichkeit von den herrlichen Siphonophoren übertroffen“, schrieb er und schilderte diese auch Staatsquallen genannten Hohltiere als „zierliche Blumenstöcke“ mit „Blüten, durchsichtig wie Glas“.
.
Die Aquarelle, die er von ihnen malte, gehören zu den schönsten naturkundlichen Darstellungen des 19. Jahrhunderts. Eine Fahnenqualle benannte Haeckel nach seiner früh verstorbenen Frau Anna Sethe, die er sehr liebte: ‚Desmonema annasethe‘.“Bei den „Staatsquallen“ gibt es eine Art, die für Menschen besonders schmerzhaft und manchmal sogar tödlich ist: die „Portugiesische Galeere“ (Physalia physalis).
.
Haeckel schätzte die „Siphonophoren“ vor allem weil sie aus Tausenden von Individuen bestehen, die Arbeitsteilung praktizieren, indem sie verschiedene Funktionen ausfüllen: Beutefang, Verdauung, Verteidigung, Vermehrung usw. Damit ähneln sie einem „stark centralisirten“ und „hochcivilisirten Culturstaate,“ fand er. Der Biologe Mark Martindale entdeckte in ihnen die gleichen Gene, die bei Säugetieren die Aufteilung und den Aufbau des Körpers steuern.
.
Die Welt fand: „Viel haben sie bei den Quallen nicht aufzubauen. Hohltiere besitzen kein Herz, kein Gehirn und kein zentrales Nervensystem. Die einzigen Organe, die bei der in Nord- und Ostsee häufigen Ohrenqualle als rosa Ringe im ansonsten durchsichtigen Fladenkörper auffallen, sind die Geschlechtsteile.“ Die Quallen – auch Medusen genannt – erzeugen durch geschlechtliche Fortpflanzung Larven. Diese setzen sich irgendwo fest und entwickeln sich zu Polypen. Die Polypen erzeugen daraufhin auf ungeschlechtlichem Weg – durch „Sprossung“ – wieder freischwimmende Quallen.
.
Der von der Französischen Revolution beflügelte Naturforscher Jean-Baptiste de Lamarck, der den Begriff „Biologie“ prägte, befasste sich mit „wirbellosen Tieren“; in den Korallenriff-Gemeinschaften hatten es ihm vor allem die Quallen – franz. „Méduses“ – angetan. In ihnen sah er „die Spiele, die Eleganz und das Lächeln der neuen Freiheit“ verkörpert.
.
Inzwischen werden die Quallen weltweit eher als Bedrohung wahrgenommen, weil sie sich wegen Überfischung und Verschmutzung der Meere ungehemmt ausbreiten; hinzu kommt die Erwärmung des Wassers, was die rhythmische Pulsation ihres Magens und ihre Schwimmbewegungen mit dem Schirm (beides geschieht über Ringmuskeln) beschleunigt – und damit auch ihren Nahrungsbedarf.
.
Polypen wie Medusen leben von Plankton (gr. das Umherirrende), Letztere können mit ihren Tentakeln aber auch kleine Fische und Krebse fangen. Anfang der achtziger Jahre gelangte – vermutlich über das Ballastwasser von Frachtschiffen – eine Rippenquallenart (die Meerwaldnuss) in das Schwarze Meer, wo sie sich derart vermehrte, dass schließlich 240 Exemplare pro Kubikmeter Wasser gezählt wurden. Erst durch Aussetzen ihres Fressfeindes Beroe ovata (eine andere Rippenquallenart) konnte ihre Population reduziert werden.
.
In der für die Meerwaldnuss eigentlich zu kalten Ostsee leben bereits zwei Quallenarten, die von der biologischen Anstalt Helgoland als ihre Fressfeinde identifiziert wurden. Im Mittelmeer „vermiest“ die Wurzelmundqualle (Rhizostoma pulmo) „Jahr für Jahr den Urlaub an Italiens Küsten,“ schreibt der österreichische Standard über diese Quallenart, die den Strand violett färbt, wenn sie in Massen angeschwemmt wird. „Der Stachel an den mit Gift gefüllten Nesselzellen lässt bei Berührung die Nesselkapsel im Inneren der Zelle platzen, worauf ein Nesselfaden nach außen gestülpt wird, der das lähmende Gift abgibt.“
.
Für den Menschen ist das nur schmerzhaft, das Beutetier hingegen wird vergiftet und verdaut. Im Mittelmeer gibt es jedoch eine kleine Makrelenart, die am Liebsten Quallen frisst. Laut dem Biologen Jakob von Uexküll, der den Begriff der „Umwelt“ prägte, haben es diese Fische auf zwei Quallenarten abgesehen, die mitunter viel größer als sie selbst sind. In Kiel will eine Firma aus Quallen Arzneimittel und Kosmetika herstellen.
.
Das aus ihnen extrahierte Bio-Kollagen sei ideal für die Wundbehandlung, schreibt der Spiegel, dabei gäbe es nur noch ein Problem: „Wie bringt man Quallen um?“ Bisher erledigten die Kieler Forscher das mit einem Quirl, das Tierschutzgesetz verlangt jedoch eine „artgerechte“ Tötung.
.
In China und Japan isst man gerne „Quallensalat“. In „Asien ist der Handel mit Quallen für den Verzehr bereits ein Multi-Millionen-Dollar-Geschäft,“ berichtete der SWR, hierzulande habe die Lebensmittelbehörde Quallenspeisen noch nicht freigegeben. Desungeachtet versuche die Industrie bereits aus der zunehmenden Not – schrumpfende Fischschwärme und wachsende Quallenbestände – das Beste zu machen, indem sie das Problem zu lösen sich anschickt, wie man die Tiere entgiften und dabei ihren Nährwert erhalten kann.
.
Im Institut für Meereswissenschaften in Barcelona gibt es laut SWR „Quallen für jeden Geschmack: Mit grünen oder phosphoreszierenden Tentakeln, mit bläulichen oder kräftig gelben Schirmen. Der Biologe Josep-Maria Gili züchtet unzählige Quallen in seinen Aquarien als Nahrungsmittel und erprobt Entgiftungsmethoden: Die Qualle hat kein Cholesterin. Sie ist fettfrei. Wie Fisch liefert sie viele Proteine und Spurenelemente und ist reich an Natrium, Kalzium, Calium und Magnesium.“
.
Im Guardian fragte sich kürzlich ein Autor: „Ist es o. k. für Vegetarier, Quallen [Jellyfish] zu essen?“ Was er wohl für solche, die sowieso Fisch essen, in Ordnung fand. Aber dürfen auch Veganer Quallen essen? Im Forum „vegane-inspiration.com“ wurde geantwortet: „Quallen haben kein Gehirn, daher können sie auch nicht leiden. Quallen sind eher wie bewegliche Pflanzen.“ In der taz wurde kurz über diese beiden Fragen diskutiert. „Sind sonst alle weltbewegenden Probleme gelöst?“, fragte eine Redakteurin erst mal. Während eine andere die Frage „Was wollen wir essen?“ durchaus für „weltbewegend“ hielt. Eine dritte behauptete: „Quallen schmecken wie Austern!“
.
Und ohnehin seien bereits über 50 Prozent der in Europa geschlürften Austern mit Quallen gefüllt. Einer der Hausmeister wies darauf hin, dass man Quallen auch immer öfter in Aquarien halte – um sich an ihnen lebend zu erfreuen. Im Aquarium des Berliner Zoos wird bereits seit den achtziger Jahren die größte Quallenzucht des Kontinents aufgebaut. Der für diese „Feenwesen“ zuständige Tierpfleger Daniel Strozynski erzählte dem Tagesspiegel: „Erst dachte ich, das wird auf Dauer ja langweilig.“ Schließlich ließe „sich zu den glibberigen Schönheiten nicht wirklich eine persönliche Beziehung aufbauen“.
.
Heute sagt Strozynski: „Das ist mein Traumjob.“ Weil Medusen hochsensible, kompliziert zu haltende Geschöpfe sind. Ständig forderten sie ihn neu heraus. In seinen Becken werden 22 Quallenarten gehalten. „Wer solche Tiere sehen will, muss also nicht ans Meer fahren, nach Spanien oder Italien“, meint der Kurator des Aquariums, Rainer Kaiser. Der WWF zählte die Quallen zu den „tierischen Gewinnern 2015“.
.
.
14a.
Philosophisch verfocht der Darwinismuspropagandist Ernst Haeckel eine monistische Naturphilosophie, unter der er eine „Einheit von Materie und Geist“ verstand. Der Jenaer Zoologe nahm im September 1904 am Internationalen Freidenker-Kongress in Rom teil, den 2000 Menschen besuchten. Dort wurde er anlässlich eines gemeinsamen Frühstücks feierlich zum „Gegenpapst“ ausgerufen. Bei einer folgenden Demonstration der Teilnehmer auf dem Campo de‘ Fiori vor dem Denkmal Giordano Brunos befestigte Haeckel einen Lorbeerkranz am Denkmal. „Noch nie sind mir so viele persönliche Ehrungen erwiesen worden, wie auf diesem internationalen Kongreß,“ sagte er später. Diese Provokation am Sitz des Papstes löste eine massive Kampagne und Anfeindungen von kirchlicher Seite aus. Insbesondere wurde seine wissenschaftliche Integrität in Frage gestellt, und er wurde als Fälscher und Betrüger dargestellt sowie als „Affen-Professor“ verhöhnt. Allerdings gaben 46 bekannte Professoren eine Ehrenerklärung für Haeckel ab.
.
Am 11. Januar 1906 wurde auf Haeckels Initiative der Deutsche Monistenbund gegründet, den Ernst Haeckel schon zwei Jahre zuvor in Rom vorgeschlagen hatte. Mit dem Monistenbund fanden die bereits seit kurzer Zeit bestehenden, sehr heterogenen monistischen Bestrebungen einen übergreifenden organisatorischen Rahmen, der sich dezidiert auf eine naturwissenschaftliche Basis im Sinne Haeckels stellte, in den aber nicht alle Vertreter des Monismus eingebunden wurden. Haeckel wurde Ehrenpräsident des Deutschen Monistenbundes.
.
Ernst Haeckel gehörte zu den führenden Freidenkern und Vertretern eines naturwissenschaftlich orientierten Fortschrittsgedankens, wodurch seine Ideen nicht nur für rechte und national gesinnte, sondern auch für bürgerlich-liberale sowie linke Kreise attraktiv waren. Die Monisten um Haeckel hatten damals viele Anhänger.
.
Die Nationalsozialisten beriefen sich immer wieder auf vermeintlich wissenschaftliche Grundlagen, wobei insbesondere auch der „Sozialdarwinismus“ Haeckels vereinnahmt wurde. Haeckel setzte die Kulturgeschichte mit der Naturgeschichte gleich, da beide seiner Meinung nach den gleichen Naturgesetzen gehorchten. Diese Vorstellung soll Hitler stark beeindruckt haben – so jedenfalls die These von Daniel Gasman in „The Scientific Origins of National Socialism“ (1971).
.
Die Thesen Gasmans sind allerdings in den letzten Jahren stark in Kritik geraten, so beispielsweise durch den Wissenschaftshistoriker R. J. Richards. Er weist unter anderem auf eine Richtlinie für Bibliotheken und Büchereien der sächsischen Regierung im Jahr 1935 hin, in der Schriften, welche die „oberflächliche wissenschaftliche Aufklärung eines primitiven Darwinismus und Monismus“ verteidigen, „wie diejenigen Ernst Haeckels“, verurteilt und als untauglich für die nationalsozialistische Bildung im Dritten Reich bezeichnet werden.
.
Das Ernst-Haeckel-Haus wurde in der DDR als wissenschaftshistorische Forschungsstätte weiterbetrieben und überstand auch die Wiedervereinigung. In ideologischer Hinsicht wurde bei der Rezeption Haeckels versucht, das revolutionäre Element seiner Biographie zu betonen. So interpretierte Georg Schneider 1950 eine Zeichnung des 16-jährigen Haeckel von 1850 mit dem Titel „Nationalversammlung der Vögel“ als Anteilnahme Haeckels an der innerpolitischen revolutionären Entwicklung Deutschlands, Erika Krauße (1987) wiederum stellte z. B. eine Verbindung der Schullehrer Haeckels mit der Revolution von 1848 her. Am 17. Mai 1963 stellte die DDR das Fischereiforschungsschiff Ernst Haeckel in Dienst, das 1987 durch einen Neubau gleichen Namens ersetzt wurde.
.
.
15. Kurz vor dem Polenfeldzug beantragte Konrad Lorenz bei der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft eine Projektförderung im Rahmen seiner Gänseforschung. Empfehlungsschreiben von Kollegen bezeugten ihm, dass er arischer Abstammung sei, dass die „politische Gesinnung von Herrn Dr. Lorenz in jeder Hinsicht einwandfrei ist“, dass er „aus seiner Zustimmung zum Nationalsozialismus niemals einen Hehl gemacht“ habe und dass seine biologische Forschung den Ansichten im Deutschen Reich gelegen käme. Lorenz bekam das Geld und studierte daraufhin, wie sich das Instinktverhalten von Wildgänsen ändert, wenn sie zu Haustieren gezüchtet oder mit Hausgänsen gekreuzt werden. 1940 veröffentlichte er darüber in einer Psychologie-Zeitschrift den Aufsatz: „Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens“.
.
Seit Lorenz 1973 den Nobelpreis bekam, wird ihm dieser Aufsatz vorgeworfen, zuletzt in dem Buch „Vom Übertier“ (2006) der Kulturwissenschaftler Stefan Rieger und Benjamin Bühler. Sie wiesen dem Gänseforscher darin nationalsozialistische Forschungsziele nach – insofern ihm die „Tierzucht zum Modell für die Menschenzucht“ wurde. Bei Vergleichen zwischen Wild- und Hausgänsen hatte er fatale „Verfallserscheinungen“ bei den domestizierten Rassen festgestellt – und daraus u.a. geschlußfolgert: Auch beim Menschen sei es durch Domestikation „zur Vernichtung oder mindestens Gefährdung von instinktmäßig programmierten Verhaltensweisen wie Mutterliebe oder selbstlosem Einsatz für Familie und Sozietät gekommen“, woraus letztlich „Sozial-Parasitismus“ entstehe. Sein Lehrer, der in Berlin am Zoologischen Garten tätige und ebenfalls auf Anatiden (Entenvögel) spezialisierte Oskar Heinroth, unterstützte den nationalsozialistischen Durchhaltewillen 1941, zu Beginn des „Rußlandfeldzugs“, mit einem Aufsatz, dem er den Titel „Aufopferung und Eigennutz im Tierreich“ gab.
.
Beiden ging es um den Nachweis, dass durch die Verhaustierung die Instinkte „verludern“. In diesem Zusammenhang prägten sie u.a. den Begriff „Triumphgeschrei“ – den Gänse ausstoßen wenn sie einen in ihr Revier eindringenden Rivalen vertrieben haben. All das paßte den Nazis in ihr kriegerisches Weltbild, wenn man dem Philosophen Michel Foucault folgt: „Die Freiheit, die die germanischen Krieger genießen, ist wesentlich eine egoistische Freiheit, eine der Gier, der Lust auf Schlachten, der Lust auf Eroberung und Raubzüge...Sie ist alles andere als eine Freiheit des Respekts, sie ist eine Freiheit der Wildheit...Und so beginnt dieses berühmte große Porträt vom Barbaren, wie man es bis zum Ende des 19.Jahrhunderts und natürlich bei Nietzsche finden wird – den die Nationalsozialisten dann zu ihrem biopolitischen Vordenker erklären.“ Wobei ihre „Transformation aus der Absicht der Befreiung die Sorge um [rassische] Reinheit“ (und saubere Instinkte) werden läßt.
.
„Wir ‚vermenschlichen‘ die Tiere nicht, sondern umgekehrt: ‚vertierlichen‘ die Menschen“, meinte Konrad Lorenz. Sein Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt hat daraus ein ganzes Forschungsprogramm – in „seinem“ Max-Planck-Institut für „Humanethologie“ – gemacht, wobei er z.B. mit dem Unterwasserfilmer Hans Hass die „Raubtierinstinkte“ von Riffhaien und Finanzhaien erforschte.
.
Die harmlosen Gänse wurden und werden seltsamerweise oft in Zusammenhang mit dem Krieg gedacht.
.
Der Schriftsteller Marcel Beyer veröffentlichte 2009 einen Roman mit dem Titel „Kaltenburg“, in dem es um die „Tierkenner“ Joseph Beuys, Heinz Sielmann und Heinrich Dathe geht – vor allem jedoch um Konrad Lorenz. Dieser – im Roman „Kaltenburg“ genannt – habe sich während des Krieges, als er auf den „Kant-Lehrstuhl“ in Königsberg berufen wurde, für den später äußerst populären Ostberliner Zoodirektor Heinrich Dathe („Eberhard Matzke“ im Roman), verwendet. Der wäre inzwischen KZ-Bewacher geworden und hätte es nicht mehr ausgehalten, stattdessen durfte er dann Vögel beobachten – außerhalb des Lagers. Die SS beschäftigte in Auschwitz tatsächlich einen Ornithologen. Der Schriftsteller Arno Surminski veröffentlichte darüber 2008 einen Roman: „Die Vogelwelt von Auschwitz“. Sein Ornithologe heißt darin Grote, er hat einen polnischen Assistenten, den KZ-Häftling Marek. Sie beobachten u.a. auch Gänse. In Birkenau sehen sie einen Kampf zwischen Krähen und Graugänsen, erstere waren in der Überzahl, aber letztere konnten sich halten, indem sie eine „Wagenburg“ bildeten. Als Marek Grote bittet, eine Gans abzuschießen – nicht um sie, wie die anderen Vögel zuvor, zu präparieren, sondern um sie zu essen, antwortet dieser: „Zugvögel dürfen nicht geschossen werden“. Wenig später erschießt ein Wachmann aus Versehen, wie er sagt, doch eine Gans. Grote erwirkt daraufhin „beim Kommandanten eine Verschärfung des Verbots, auf Vögel zu schießen.“ Nach dem Krieg wird Grote – so wie auch der wirkliche SS-Ornithologe – in Polen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Proteste von Ornithologen aus England und den Niederlanden bewirken jedoch, dass seine Haftstrafe auf drei Jahre herabgesetzt wird.
.
1978 kam der Film „Die Wildgänse kommen“ in die Kinos, hierbei handelte es sich um doppelt und dreifach metaphorisierte Vögel: Als Wildgänse bezeichnete man Iren, die im 17. und 18.Jhd in verschiedenen europäischen Armeen kämpften. In dem Film, der auf einen gleichnamigen Roman von Daniel Carney basierte, ging es dann um weiße Söldner, die in Afrika kämpfen. Der Schauspieler Hardy Krüger distanzierte sich wenig später von diesem rassistischen Machwerk. Heute ist „Wildgaense“ sinnigerweise der Name eines Internet-Forums für Neonazis. Diese können sich dabei jedoch auch auf das deutsche Lied: „Wildgänse rauschen durch die Nacht“ von Walter Flex bezogen haben. Über die Entstehung des Liedes im Ersten Weltkrieg schrieb der Autor: „Die Postenkette unseres schlesischen Regiments zog sich vom Bois des Chevaliers hinüber zum Bois de Vérines, und das wandernde Heer der wilden Gänse strich gespensterhaft über uns alle dahin. Ohne im Dunkel die ineinanderlaufenden Zeilen zu sehen, schrieb ich auf einen Fetzen Papier ein paar Verse.“ Die Marschmusik dazu komponierte dann Robert Götz. Das Gedicht und später auch das Lied verbreitete sich zunächst in der Wandervogelbewegung und der Bündischen Jugend, da es ihr als Symbol für den von Flex idealisiert dargestellten „Wandervogel-Soldaten“ galt. Später wurde es in Hitlerjugend, Wehrmacht und Waffen-SS gesungen. Und noch später in der Fremdenlegion, wie ebenso bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken, sowie auf einem Album des Sängers Heino. In der Bundeswehr und im österreichischen Bundesheer ist es ebenfalls ein beliebtes Marschlied.
.
In dem Roman von Arno Surminski fand ich die Bemerkung, dass nicht nur die Gänse, sondern auch andere Vögel kriegerisch wirken: „Ach, die vielen Gemeinsamkeiten der Vogelwelt mit der Welt des Krieges. Die Bombengeschwader flogen in Keilform wie die Wildgänse, Falken stürzten wie Sturzkampfbomber auf ihr Ziel, die Schwäne sangen wie Luftschutzsirenen..., die ganze Vogelwelt befand sich im Krieg.“ Etwas anders sah das der sowjetische Kriegsberichterstatter Wassili Grossman, in seinem Tagebuch schreibt er über sich und seine Kollegen, die immer wieder vom Hinterland an die Front müssen: „Der unangenehmste Augenblick ist genau dieser Wechsel von den Nachtigallen zu den Flugzeugen?“
.
.
16. In der sozialistischen Frühphase der Bremer Universität, in den Siebzigerjahren, haben wir uns mit den Frühschriften von Marx und dem Begriff der „Entfremdung“ wahre „Paper“-Schlachten geliefert. Und dann verschwand er. Nun verzeichnet Google bereits wieder 447.000 Eintragungen und die Philosophin Rahel Jaeggi veröffentlichte ein Buch „zur Aktualität“ des Entfremdungs-Begriffs. „Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ‚Nach Marx‘ und ‚Der neue Chef‘.“
.
Die „Entfremdung“ ist ein sinnliches Wort – man denkt dabei an die „Fremde“, romantisch bis elendiglich, an Entwicklungen, die einen „befremden“, ans „Fremdgehen“ und „fremdeln“, ans „Verfremden“ und an „Realitätsfremdes“. Laut Wikipedia ist die E. ein „Zustand, in dem eine ursprünglich natürliche Beziehung (zwischen Menschen, Menschen und Arbeit, Menschen und dem Produkt ihrer Arbeit sowie von Menschen zu sich selbst) aufgehoben, verkehrt, ge- oder zerstört wird.“ Wir erleiden diese E. jedoch nicht nur, sondern ermöglichen sie uns auch. Bei Hegel heißt es: „Was der Geist will, ist, seinen eigenen Begriff erreichen (den Ort an dem er theoretisch und praktisch in Harmonie mit dem Ganzen steht); aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll Genuß in dieser Entfremdung seiner selbst.“
.
In diesem Satz hat sich der Geraer Öko-Landwirt Michael Beleites mit seinem neuen Buch „Land-Wende. Raus aus der Wettbewerbsfalle“ verfangen. Die „Harmonie“ (mit der Natur) sowie „eine Rücknahme überdehnter Naturentfremdung“ ist sein Anliegen – der „Versuch einer Wiedervereinigung der Realität“. In theoretischer Hinsicht beruft der Autor sich dabei auf sein bereits am 26.1. hier erwähntes Biologiebuch „Umweltresonanz“. In der „Land-Wende“ geht es ihm nun darum, seine „biologischen Erkenntnisse an einem praktischen Beispiel konkret“ zu machen: „Aus der Perspektive einer fundamentalen Kritik am Selektionsdenken und an der Wettwerbslogik“ (in der heutigen Landwirtschaft). Was bis hin zu der allgemeinen Forderung, nach „mehr Aufenthalt im Freien“ und „mehr körperliche Arbeit in ‚freier Natur'“ geht. Für das Ganze, die Gesellschaft, bedeutet das, „ein integratives Verhältnis zur Natur“ zu finden. Bereits mit der Seßhaftigkeit und der damit zusammenhängenden „Domestikation“ von Tieren und Pflanzen sowie der „Selbstdomestikation“ der Menschen sei es zu einer „Degeneration“ gekommen.
.
Ebenfalls 2016 hatte Beleites bereits eine Schrift mit dem Titel „Dicke Luft: Zwischen Ruß und Revolte: Die unabhängige Umweltbewegung in der DDR“ veröffentlicht. Mit seinem Buch „Land-Wende“ begibt er sich nun in dünne Luft. 1940 hatte der Verhaltensforscher Konrad Lorenz einen Aufsatz „Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens“ veröffentlicht, der ihm 1973, bei Entgegennahme des Nobelpreis, angekreidet wurde: „Die Tierzucht“ gerate ihm darin „zum Modell für die Menschenzucht“. Bei Vergleichen zwischen Wild- und Hausgänsen hatte Lorenz fatale „Verfallserscheinungen“ bei den domestizierten Rassen festgestellt – und daraus u.a. geschlußfolgert: Beim Menschen sei es ebenfalls durch Domestikation „zur Vernichtung oder mindestens Gefährdung von instinktmäßig programmierten Verhaltensweisen wie Mutterliebe oder selbstlosem Einsatz für Familie und Sozietät gekommen“, woraus letztlich „Sozial-Parasitismus“ entstehe. Auch Beleites spricht von „Parasitentum“ (dem er eine „organismische Integration“ entgegenstellt). Ob diese aber auch die von Lorenz diagnostizierte „Verluderung der Instinkte“, die Beleites „eine Art Präzisionsverlust erblicher Verhaltensmuster“ nennt, bei Mensch und Tier verhindert – und ob wir das wirklich wollen, läßt er in seinem durchgängigen „Biologismus“ offen. Erst recht Nietzsches Gegenfrage: „Seid natürlich! aber wie, wenn man eben ‚unnatürlich‘ ist...“
.
Beleites zitiert den Wissenschaftsjournalisten Jörg Blech: „Die Umwelt in den Industriestaaten passt nicht zur Natur des Menschen.“ Immer mehr werden krank. Die Bolschewiki waren noch davon überzeugt, sie und ihn passend zu machen. So meinte z.B. der Sowjetdiplomat Adolf Joffe in seinem Abschiedsbrief an Trotzki 1927: „Wer wie ich an den Forschritt glaubt, kann sich sehr gut vorstellen, dass die Menschheit, wenn unser Planet erschöpft ist, längst Mittel und Wege gefunden haben wird, um sich auf anderen, jüngeren Planeten anzusiedeln.“
.
P.S.: Nachdem Juri Gagarin 1961 den ersten Schritt in diese richtige Richtung getan hatte – als Kosmonaut von „Wostok 1“, jubelte der Philosoph des Judentums Emanuel Lévinas: Damit werde nun endgültig und weltweit das „Privileg der Verwurzelung und des Exils“ beseitigt. Fortan würden wir alle in der „Diaspora“ leben – und damit keiner mehr. Womit schon mal ein gutes Stück Entfremdung aufgehoben wäre.
.
.
17. Der Berliner Arbeitskreis für Human-Animal-Studies Chimaira hat gerade ein neues Buch veröffentlicht: „Das Handeln der Tiere“ (2016). Zentral ist darin der Begriff „Agency“, was so viel wie Handlungsmacht und Wirkmacht bedeutet. Dabei gehen sie jedoch nicht so weit wie ihr amerikanisches Vorbild, die feministische Biologin Donna Haraway, die nicht einmal Labortieren Handlungsmacht absprechen will. Ich fand dazu in dem Buch der Kulturwissenschaftler Benjamin Bühler und Stefan Rieger „Vom Übertier“ ein Beispiel aus dem permanent Hunde vernutzenden Leningrader Großlabor von Iwan Pawlow: Einer der Hunde „vertrug die Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit nicht“, woraufhin Pawlow prompt einen „Freiheitsreflex“ in seine Reiz-Reaktions-Theorie einführte.
.
Die Autoren der „Human-Animal-Studies“ loten in ihrer Aufsatzsammlung weniger das Widerstandspotential der Tiere aus als die theoretische Tragfähigkeit des Begriffs „Agency“. Im Vorwort erwähnen sie jedoch einige Anekdoten über Tiere, die sich etwas einfallen ließen, z.B. eine Kuh, „die aus einem Schlachthof ausbrach und sich ihren Weg durch eine Großstadt bahnte“ und eine Schimpansin, die eine Zeichensprache lernte und diese nutzte, um damit Bitten an eine Wissenschaftlerin zu richten. Die Herausgeber fügen hinzu: „Die Geschichten über die freiheitsliebenden und gewitzt handelnden Tiere scheinen die Ausnahme zu bilden, die die Regel bestätigen, wonach das Tier‘ das Gegenbild des Menschen‘ darstellt.“
.
Es mehren sich jedoch die Fälle, dass wir auch die in seiner „Sprache“ geäußerten Wünsche verstehen. Der US-Psychologe Kenneth Shapiro spricht in bezug auf Hunde von ihrem „Interesse, eine Beziehung zu einem Menschen zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten“, wobei er an seinen eigenen Hund und dessen Bemühungen, ihn zu beeinflussen, denkt. Es handelte sich dabei um einen herrenlosen Mischlingswelpen, den Tierschützer auf einer Müllkippe fanden und in ein Tierheim brachten, wo der Autor ihn erwarb. Sein Bericht über das Zusammenleben mit dem von ihm „Sabaka“ genannten Rüden findet sich in der Aufsatzsammlung „Ich, das Tier“ (2008). Der Hund schaffte es z. B. mit seiner „offensichtlichen Überzeugung“, dass Shapiro „ihn ausführen werde“, dass genau „diese Absicht“ auch bei ihm „ausgelöst“ wurde.
.
Ein anderes Beispiel findet sich im „Mother Nature Network“ (mit Film): In Cincinatti ging eine Wildgans zu einem Polizeiauto und machte sich durch Schnabelhiebe an der Tür und lautes Quaken bemerkbar. Der Polizist dachte, sie wäre hungrig und gab ihr ein Stück Brot, aber sie wollte nichts. Sie fuhr stattdessen fort zu quaken und entfernte sich langsam, wobei sie immer wieder anhielt und sich umdrehte. Der Polizist meinte sie zu verstehen und folgte ihr. Die Gans lotste ihn auf eine Wiese an einem Kanal. Dort lag ihr Junges, das sich völlig in die Schnur eines kaputten Luftballons verheddert hatte. Der Polizist traute sich nicht nahe ran – aus Angst vor der Muttergans, aber da kam ihm eine Kollegin zu Hilfe, die das Gänslein aufhob und es von der Schnur befreite, was eine ganze Weile dauerte, während die Mutter aus zwei Meter Entfernung zuguckte und dabei nervös von einem Bein aufs andere trat.
.
.
18.
Die Meeresdiplomatin und Sachbuchautorin Elisabeth Mann-Borgese unterscheidet in der Verhaltensforschung die Feldbiologie von der Laborbiologie: Hierbei holen sich die Wissenschaftler ihre Tiere ins Labor, dort gehen sie raus zu ihnen. Während diese sich auf die „Sprache“ der Tiere konzentrieren, bringen jene ihnen Englisch bei (Darwin meinte, diese Sprache sei besonders gut dafür geeignet.). Das hat sich auch die in Italien lebende Elisabeth Mann-Borgese gedacht, als sie ihrem Vorstehhund Arli beibrachte, auf einer speziell für ihn konstruierten Schreibmaschine Gedichte auf Englisch zu tippen, später auch Zahlen („Das ABC der Tiere“ – 1973). Sie konnte sich dabei u.a. auf die diesbezüglichen Erfahrungen der Mannheimer Witwe Paula Moekel mit ihrem Airedale-Terrier stützen, die 1919 unter dem Titel „Mein Hund Rolf“ veröffentlicht wurden, zusammen mit Schreibproben von Rolf.
.
Das Rudeltier Hund fand nichts dabei, sich dem Rudelführer Mensch unterzuordnen – und lernte dabei, ihn immer besser zu verstehen – so die Meinung der Kynologen. Die Strategie der gekonnten Unterordnung unter die Menschen erwies sich für die zahmen Hunde „erfolgreicher“ als die Strategie des Rückzugs in die Wälder der (wilden) Wölfe, rechnen die Darwinisten vor, denn es gibt heute 50 Millionen Hunde auf der Welt, aber nur noch 40.000 Wölfe.
.
Dem gegenüber meinte die Berliner Hundeforscherin Katharina Ruschky, dass der Hund sich „unschuldig in einer evolutionären Sackgasse verlaufen“ habe, weil nämlich „der Mensch mit ihm machen kann, was er will.“ Ungeachtet dessen lobt sie in dem Buch „Der Stadthund“ (2001) ihren in Kreuzberg aufgewachsenen Cocker-Spaniel „Kupfer“, dessen großstädtisches Benehmen sie gegen das so viel ungehobeltere von Landhunden ins Feld führt. Sie steht damit im Gegensatz zu den Hundeforschern Eberhard Trumler und Horst Stern: Beide waren davon überzeugt, Hunde gehören nach draußen: Selbst ein Zwinger sei besser als eine Wohnung.
.
Aber hat sich die Unterwerfung unter den Menschen als „Haushund“ (Pet) – ihre „komplette Verblödung“, wie der Biologe Cord Riechelmann das nennt – wenigstens für den einzelnen Hund gelohnt? Irgendwie schon: 2002 betrug die weltweit für Haustierfutter und -versorgung ausgegebene Summe bereits 46 Milliarden Dollar, Tendenz steigend, vor allem im Marktsegment ‚Premiumfutter‘. Darüberhinaus wird die Medizintechnik für Hunde immer aufwendiger, es gibt inzwischen Welpenschulen, Agility-Kurse, psychologische Therapieeinrichtungen und Krankenversicherungen, die für Haustiere bereits zur Normalität werden, wie die US-Biologin und Hundebesitzerin Donna Haraway in ihrem Aufsatz „Hunde mit Mehrwert und lebendiges Kapital“ (2007) schreibt.
.
Riechelmann geht davon aus, daß die Wölfe „sich zu Teilen selbst domestizierten“. Das betraf vor allem rangniedere Tiere, die das Interesse am Rudel verloren haben und sich statt dessen „häufig in der Nähe von Dörfern, auf Müllhalden oder am Rand von Spielplätzen“ aufhielten. Riechelmann sieht diese Art Hund noch in den großen urbanen Mischlingshunden der Punks aufscheinen, weil diese meist so friedlich sind, daß sie sich nur selbst erzogen haben können.
.
Der Philosoph Theodor Lessing sah in der „Verfeinerung und Hochzüchtung“ von Tieren (und Pflanzen) ebenfalls eine Krankheit, die den Untergang ihrer Wildheit zur Folge habe, wobei er speziell den Hund als einen „geknebelten und in sich hineingeprügelten Wolf“ begriff. Das könnte auch die feministische US-Biologin Donna Haraway so sehen, da für sie die „Wildheit“ doch unsere ganze Hoffnung ist. Gleichwohl läßt sie ihre Hündin „Cayenne“ professionell ausbilden und beschäftigen.
.
An der Differenz von Stadt- und Landhund hakte bereits Thomas Mann an – in seiner Erzählung „Herr und Hund. Ein Idyll“ (1927). Darin geht es um einen „Hühnerhund“ mit bäuerlichem Hintergrund, dessen Eigenschaften Thomas Mann zwar außerordentlich schätzte, die aber für die „Welt“, das heißt für die Stadt München, seiner Ansicht nach nichts taugten, weswegen er seinen Hund „Bauschan“ auch nie nach dorthin mitnahm. Anders der Humorist Loriot, der „ein Leben ohne Mops“ zwar für „vorstellbar, aber völlig sinnlos“ hielt. In den Fünfzigerjahren beauftragte der „Stern“ ihn mit einer Cartoon-Serie „Auf den Hund gekommen“. Aber nach Leser-Protesten und Abo-Abbestellungen setzte Henri Nannen sie schnell wieder ab. Wikipedia kann sich noch an zwei Loriot-Cartoons erinnern: In einem Strandkorb sitzt eine Hundedame – aufrecht, im Bikini und mit Badekappe. Vor ihr im Sand spielt ein kleiner Mensch, daneben steht ein Hund auf seinen Hinterbeinen. ‚Kurverwaltung‘ steht auf seiner Armbinde, streng schaut er unter seiner Schirmmütze hervor. „Wenn nun jeder seinen Menschen an den Strand mitbrächte!“ blafft der Hund. Zwei Hunde lehnen am Fenster und schauen hinaus; es regnet stark. Auf dem Fußboden liegt ein Mensch, zusammengerollt und schlafend. Sagt der eine Hund zum anderen: „Bei dem Wetter möchte man keinen Menschen vor die Tür jagen!“
.
Ähnlichen Protest löste ein Gast in einer Talkshow aus, als er erzählte, dass er seinem Hund eine neue Niere gekauft habe. Die Tierschutzaktivistin Karen Duve meinte über den Protestierenden: „Diese Empörung hätte er nicht empfunden, wenn sich derjenige stattdessen einen Porsche gekauft hätte. Für religiöse Menschen ist es schwer auszuhalten, wenn jemand ein Tier wie seinesgleichen wertschätzt. Sie sehen dadurch ihre vermeintliche Sonderstellung im Tierreich angegriffen.“
.
Als auf einem Antipsychiatrie-Kongreß im Haus der Demokratie der schlafende Hund einer Referentin aufschreckte und bellte, griff ein Psychiatrieerfahrener dies sofort auf: „Ja, ich kann nur jedem raten, der unmündig ist, sich einen Hund anzuschaffen. Wenn der einem gehorcht, wird man sofort für mündig erklärt.“ Der Wiener Verhaltensforscher Kurt Kotrschal, Autor des Buches „Der Faktor Hund“, sieht das ähnlich: „Menschen, die Hunde besitzen, werden eindeutig positiver wahrgenommen als solche ohne.“ Für einen Politiker sei der Hund gar „ein soziales Schmiermittel, das ihn in der Öffentlichkeit als sozial, nett und umgänglich darstellt“. Laut Kotrschal hilft der Hund in der Politik, den Geschmack des gesellschaftlichen Mainstreams zu treffen, „so ähnlich, wie öffentlich Kinder zu küssen“. So zogen z.B. mit den bislang 44 US-amerikanischen Präsidenten über 400 „First dogs“ ins Weiße Haus ein. Berühmt wurde vor allem der Hund von Richard Nixon, als er seinem Herrn vor laufender Kamera half, dessen Watergate-Lüge mit treuherzigem Blick Glaubwürdigkeit zu verleihen. Laut den „Simpsons“ kam „Checkers“ dafür in die „Hundehölle“.
.
Diese kann sich auch auf Erden befinden: In kalifornischen Gefängnissen leben „Cell dogs“, sie werden von den Insassen zu Wachhunden ausgebildet. Für die Dauer dieser „subjekttransformierenden Beziehung“ leben sie mit den Inhaftierten in einer Zelle. Für beide gilt: „Der Weg zu Freiheit und Arbeit außerhalb der Gefängnismauern“ besteht aus dem Lernen von „Disziplin und Gehorsam“. Hunde, die die abschließende Prüfung nicht schaffen, erwartet der Tod.
.
.
19. „Kaninchen sind eigentlich äußerst interessante Tiere.“ (Heini Hediger) In Indien erzählt man sich folgenden Witz: Ein Europäer ist gestorben und angeblich in den Himmel gekommen. Seine Witwe will sicher sein und versucht über ein Medium mit dem Toten in Kontakt zu kommen, schließlich gelingt es ihr: Sie fragt, wie es ihm gehe? „Prima,“ antwortet er. „Wir essen ausgiebig, vögeln dann und schlafen danach, anschließend essen wir wieder was und vögeln ein bißchen, dann schlafen wir erneut, usw. – ein angenehmes Leben.“ Ich habe mir den Himmel ganz anders vorgestellt, erstaunte sich die Witwe. „Wieso Himmel? fragt ihr Mann. „Ich bin jetzt ein Kaninchen und lebe in Australien.“
.
Dort müssen viele Europäer ihre Wiedergeburt erlebt haben, denn bereits kurz nachdem man die ersten englischen Kaninchen 1788 in Australien ausgesetzt hatte, wurden sie – ebenso wie die weißen Siedler – zu einer wahren Landplage, indem sie von allen eingeführten Haustieren „die weiträumigsten Zerstörungen anrichteten,“ wie „australien-panorama“ weiß. Man hielt sie dort zunächst nur in kleinen Ställen zum Schlachten, aber dann setzte der Jäger Thomas Austin auf seiner Farm in Victoria 24 Wildkaninchen und Hauskaninchen aus. „Die Einführung von ein paar Kaninchen wird kaum Schaden anrichten, kann mir aber auf meinem Jagdrevier ein Gefühl von Heimat geben“, soll er seinerzeit erklärt haben. Die Farmer Westaustraliens versuchten die Kaninchen ab 1901 mit einem 3256 Kilometer langen „Rabbit-Proof Fence“ von ihrem Land fern zu halten. Zur Kontrolle wurden „Kanincheninspektoren“ eingesetzt, die auf Kamelen am Zaun entlangritten. Als das nicht half (im Gegenteil: auch die Kamele verwilderten und wurden „Schädlinge“), versuchte man es mit der künstlichen Einführung von Kaninchen-Pockenviren (Myxomatose). Der Nachteil war, dass diese „Kaninchenpest“ jedesmal auf halber Strecke bei den damit infizierten Populationen stehen blieb, weil der Rest immun dagegen geworden war. 200 australische Wissenschaftler arbeiten seitdem ununterbrochen an neuen, für die Kaninchen noch tödlicheren Ansteckungskrankheiten. 2015 berichtete „spektrum.de“: „Anscheinend ist das K5-Calicivirus die neue Superbiowaffe gegen die Kaninchenplage. Dabei handelt es sich um einen aus Südkorea importierten, deutlich infektiöseren Stamm des bereits seit 1995 in Australien verbreiteten Kaninchen-Calicivirus (RHDV).“
.
Abgesehen von dieser Ausrottungswissenschaft wird über Kaninchen so gut wie gar nicht geforscht, klagte der Zürcher Tierpsychologe und Zoodirektor Heini Hediger. Auch die ganzen Institute für „Jagdwissenschaft“ (heute für „Wildbiologie“) lassen die Kaninchen meist links liegen. Hediger zufolge tragen die Jäger aber auch sowieso nur wenig zum Wissen über Tiere bei: „Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung“.
.
Der als Sanierer auf vielen Gütern des preußischen Adels tätig gewesene Alfred Henrichs berichtete in seiner Biographie „Als Landwirt in Schlesien“, dass man u.a. auf der Herrschaft Buchenhöh (vormals und ab 1945 wieder Zyrowa genannt) riesige Mengen Fasane für die Jagd aufzog, an die jährlich 60.000 Hühnereier aus Galizien verfüttert wurden, zusammen mit einer Unmenge von Kaninchen, die zu diesem Zweck mit Haut und Haaren gekocht und durch den Fleischwolf gedreht wurden. Für ihr eingezäuntes Freigelände war ein „Karnickeldirektor“ verantwortlich, für das in Volieren gehaltene Federvieh ein „Fasanenmeister“. Wenn die Vögel ausgewachsen waren, wurden sie frei gelassen, aber weiter gefüttert – bis zum Tag der Jagd, an dem laut Henrichs „alles abgeschossen wurde, was vor die Flinte kam“. An einem solchen Jagdtag erschossen fünf Adlige, hinter denen jeweils zwei Büchsenspanner gingen, rund 2500 Tiere – meist Fasane und Kaninchen. Die Jagd bildete bei vielen Magnaten laut Henrichs „Das Zentrum ihres Denkens“, dem Grafen auf Buchenhöh machte es wenig, dass seine Fasanen- und Kaninchenaufzucht irrsinnige Summen verschlang, er hatte Mary, die Tochter eines amerikanischen Millionärs, geheiratet. Wichtig war ihm vor allem, gelegentlich den Kaiser als Jagdgast bei sich zu haben. „Ich erinnere mich eines Gutshauses, dessen zugehörigen Betrieb ich betreute, in dessen Salon in einer Virtrine ein weißer Damenhandschuh aufbewahrt und wie eine Reliquie verehrt wurde. Ihn hatte die Dame des Hauses getragen, als sie dem Kaiser vorgestellt wurde und er ihr einen angedeuteten Handkuß gewidmet hatte.“
.
In Berlin lebten bis 1989 zigtausend Kaninchen unbehelligt im Todesstreifen zwischen dem antiimperialistischen Doppelschutzwall. Sie gehörten der DDR, aber der Westberliner Verleger Wagenbach kümmerte sich um sie – publizistisch. Als die Mauer fiel, war Schluß mit lustig – auch für die Kaninchen: Sie verteilten sich im gesamten Stadtraum. Eine Gruppe lebte sogar auf der kleinen Verkehrsinsel des Moritzplatzes – umtost von Autos. Für einige Zeit sah man sie überall, aber nun berichtet der Naturschutzbund (NABU), „dass man heute oft vergeblich nach ihnen sucht, da ihre Zahl deutlich zurückgegangen ist.“ Desungeachtet findet sich im Tiergarten, an den umzäunten Blumenbeeten um das Königin-Luise-Denkmal noch immer der Satz „Bitte die Tür wegen der Kaninchenplage geschlossen halten“.
.
Hediger hat Wildkaninchen auf dem Land erforscht, Wagenbach die auf dem Grenzstreifen. Jetzt haben Ökologen der Frankfurter Universität einige wesentliche Unterschiede im Leben von Wildkaninchen in der Stadt und auf dem Land entdeckt. Es geht dabei im Wesentlichen um unterschiedliche Reviergrößen. Wer den rührend naturalistischen Kaninchenroman „Unten am Fluß“ (1972) von Richard Adams gelesen hat, weiß: Auf dem Land lebende Wildkaninchen siedeln in großen Gemeinschaftshöhlen. In der Stadt „schrumpfen dagegen ihre Bauten, es gibt sogar Singlewohnungen,“ berichtete die SZ.
.
Der Bayreuther Biologe Dietrich von Holst erforschte 20 Jahre lang Wildkaninchen auf einem großen Versuchsgelände. Manchmal starb bis zu 80 Prozent seiner Population – durch Krankheiten und Raubtiere, aber sie erholte sich auch immer wieder dank der enormen Vermehrungsrate seiner Nagetiere. Ihre durchschnittliche Lebensspanne betrug zweieinhalb Jahre, dominante Tiere wurden bis zu 7 Jahre alt, während die rangniedersten schon wenige Tage nach Eintritt der Geschlechtsreife vor lauter Angst-„Stress“ dahinsiechten. Wenn Nahrungsknappheit droht, können die Weibchen ihre Föten zurückbilden.
.
Bei den Kindern sind Zwergkaninchen sehr beliebt, die sie gerne mehrmals am Tag mit Apfelshampoo waschen („Kaninchen mögen doch gerne Äpfel!“). Weil sie sich so schnell vermehren, sind sie auch beliebte Kindergeburtstagsgeschenke – zum Entsetzen der betroffenen Mütter, die sie erst einmal auf dem Balkon absetzen. Dort vermehren sie sich dann ohne Rücksicht auf das Inzesttabu munter weiter. Ich half einmal einer Prenzlauer Berg Mutter, sie immer wieder los zu werden. Schon nach kurzer Zeit winkten alle Kinderbauernhöfe ab: „Wir haben bereits zu viele!“ Schließlich trug ich sie zum Zoo in Charlottenburg, wo ich mich am Wirtschaftshof jedesmal in eine lange Schlange von Müttern mit Kaninchen und Meerschweinchen einreihen mußte. Die Kuscheltiere werden dort in einer großen Halle in zwei Gehegen gehalten. Einmal bemerkte eine Mutter, als sie ihr Kaninchen zu den anderen setzte, dass es von drei Rammlern heftig bedrängt wurde. Die Tierpflegerin versicherte ihr: „Keine Angst, das gibt sich bald.“ Beruhigt verließ die Mutter die Halle. Zu mir gewandt meinte die Pflegerin daraufhin: „Aber bis dahin haben wir es längst verfüttert“. Das Leben eines Kaninchens ist weder lang noch witzig. Ich hatte allerdings eins, ein großes mit Namen Christoph, das einmal in der Woche voller Übermut unseren Dackel und die Katze durch die Wohnung jagte. Immer im Kreis. Allen dreien schien diese Umdrehung des Verhaltens von Beutetier und Raubtier großen Spaß zu machen.
.
.
20. Als die taz sich in Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft für Mehlwürmer als „EM-Orakel“ entschied, mußte sie sich diese erst einmal beschaffen, was kein großes Problem war, aber die Würmer mußten auch regelmäßig versorgt und auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Dazu stellte man einen Tierpfleger ein.
.
Taz-Betriebsrat: Wie bist Du zu diesem Job gekommen und ist alles ok?
.
H.H.: Als Mehlwurmpfleger, eigentlich ja Mehlkäferpfleger, muß man die Insekten schon ein bißchen mögen. Ich hatte mich aber eigentlich immer nur theoretisch mit ihnen befaßt, die Bücher des Insektenforschers Fabre gelesen z.B.. Aber man muß sich doch auch praktisch mit diesen Tieren auseinandersetzen. Deswegen habe ich mich gleich gemeldet, als die taz die Stelle ausschrieb, zudem war ich sowieso gerade arbeitslos. Zunächst hatte ich allerdings „Ohrwurmpfleger“ in der Anzeige gelesen und gedacht, so ein Blödsinn, und Fußball interessiert mich doch auch nicht... Dann habe ich mich aber beworben, wurde auch sofort genommen und hab gleich angefangen, mich einzuarbeiten – in die Materie.
.
D.h. ich fragte mich: Wo gibt es überhaupt noch freilebende Mehlwürmer bzw. Mehlkäfer? Man soll ja immer vom Wildtyp ausgehen. Als erstes habe ich die Berliner Vollkornbäckerei „Mehlwurm“ angerufen, aber die haben angeblich keine in ihrem Mehllager, der Name der Bäckerei ist also irreführend. Und die Großbäckereien haben diese sogenannten Vorratsschädlinge auch nicht mehr, weil sie in China backen lassen, die kriegen die fertigen Teigwaren von dort und müssen sie nur noch aufbacken. In Preußen wurden einst strenge Hygienevorschriften erlassen, die u.a. gegen Mehlwürmer in Bäckereien gerichtet waren. Der schlesische Dichter August Scholtis erwähnt, dass der Amtsvorsteher bei seinen diesbezüglichen Inspektionen in der Bäckerei seines Vaters jedesmal „gewaltigen Krach“ wegen der Mehlwürmer schlug. Schließlich schaffte sich sein Vater einen Igel an, der die Würmer fraß. Vielleicht wurde Preußen auf diese Weise bereits mehlwurmfrei. Desungeachtet sollen die Mehlkäfer immer noch weltweit verbreitet sein. Hierzulande aber wohl nur noch als nützliche Futtertiere für allerlei andere Tiere; auch Angler kaufen die Mehlwürmer gerne, sie gelten bei ihnen als „verkannte Topköder“. 100 Gramm kosten in den Zoogeschäften rund 2 Euro. Als Käfer, im Endstadium, leben diese Insekten nur etwa 8 Wochen, spätestens nach der Eiablage sterben sie. Im Ei und als Larve – im Mehlwurmstadium also – kann ihre Lebensdauer mehrere Monate betragen, währenddessen wachsen sie ständig und müssen sich deswegen immer wieder häuten, bis zu 14 mal, wie einige kommerzielle Mehlwurmzüchter zählten.
.
Mit ihrer Verpuppung beginnt die Metamorphose,die immer noch geheimnisvoll ist: Im fertiggesponnenen Kokon wird aus einem weichen wurm- oder raupenähnlichen Tier ein harter flugfähiger Käfer. Es hat den Anschein, als würde sich der Mehlwurm im Kokon zunächst in eine Art Saft auflösen, aus dem dann etwas ganz Anderes feste Formen annimmt. Das müssen die Gentechniker erst mal nachmachen. Nun gut, das ganze Artwissen kann man inzwischen auf Wikipedia finden, es geht heute um das Individuum – um den einzelnen Mehlwurm.
.
Da gibt es ängstliche, neugierige, träge, energische, kannibalistische, nachtaktive und eher tagaktive usw.. Das hängt auch ein bißchen von der Umwelt ab – vom Futter, von der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Sie haben es gerne feuchtwarm. Die Mehlwurm-Verhaltensforschung steht aber noch am Anfang. Bisher gab es genaugenommen nur eine Mehlwurm-Vernichtungsforschung. Darin waren die Deutschen übrigens lange Zeit führend. Ich erinnere nur an den großen Mehlwurmforscher Dr. Salm-Schwader, der lange Zeit Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Schadinsekten, speziell für die Kulturfolger unter ihnen, war. Das sagt bereits alles.
.
Ganz anders Jacqueline Horn aus dem Abtei-Gymnasium Brauweiler, die das Werden und Vergehen einer mehrköpfigen Mehlwurmgeneration sorgfältig protokollierte (auf: „abteigymnasium.de“). Und dann die Schüler der Klassen 4a und 4b der Surheider Schule in Bremerhaven: Sie erforschten kürzlich die Intelligenz von Mehlwürmern. Ihnen zufolge können die Mehlwürmer schlecht sehen, dafür aber gut riechen – z.B. Haferflocken, die man ihnen in einiger Entfernung und mit Hindernissen (Bleistifte und Lineale) dazwischen, bereitlegte. Bei einem vielfältigen Nahrungsangebot teilen die Mehlwürmer sich anscheinend auf. Die der Schüler krochen zuerst hin und her, dann entschied sich einer für Kartoffeln, einer für Cornflakes, drei für Gurken und fünf für Tomaten. Die jungen Forscher nehmen an, „dass der Mehlwurm bei dieser Auswahl am liebsten Tomaten frisst.“
.
Die taz-Mehlwürmer bekommen ebenfalls ein reichhaltiges Obstangebot, Ökoobst selbstverständlich, und dazu Mehlprodukte – ebenfalls aus Ökoläden. Der Unterschied ist aber auch: Wenn die Bremerhavener Schüler von „dem Mehlwurm“ reden, meinen sie die ganze „Mehlwurmheit“ – in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, während wir in der taz den einzelnen Wurm ansprechen. Gut, es gibt hier einige Mitarbeiter, die wollen, dass man von der „Mehlwürmin“ spricht. So viel ich weiß, kann man die Mehlkäferlarven aber gar nicht gendern, erst in der Puppe differenzieren sie sich geschlechtlich. Das ist aber natürlich kein Argument gegen die weibliche Form.
.
Ich bin noch nicht lange Mehlwurm-Wart bei der taz. Deswegen ist mein Auge auch noch nicht so geschult, dass ich die einzelnen Würmer wirklich auseinanderhalten könnte. Um sie zu kennen und zu benamen, muß ich sie einstweilen noch farblich markieren. Die echten Mehlwurmliebhaber lehnen so etwas ab, weil es das quasi natürliche Erkennen von Besonderheiten verhindert: z.B. ein zu kurzer Fühler, ein dunkler Fleck, eine spezielle Fortbewegungsweise...eine winzige Anomalie eben.
.
Dieser da (siehe taz-video EM-Orakel), den ich schwarz markiert habe, natürlich mit Naturfarbe, heißt Maria. Nach einer ehemaligen taz-Mitarbeiterin, die an die Seelenwanderung glaubte. Sie ist dann auch nach Indien gegangen, zu einer NGO, die sich am Himalaja an Bäume kettet, um sie vor dem Gefälltwerden zu schützen. Der andere schwarz markierte Mehlwurm ist kleiner, er hat noch keinen Namen, muß sich bei der EM erst noch qualifizieren...
.
Nein, Quatsch. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen, ihn zu benamen, weil wir nicht wußten, ob er durchkommt, er ist sehr klein geblieben – bisher, also haben wir ihn erst einmal nur markiert, für alle Fälle. Eigentlich ist diese Namenlosigkeit aber nicht gut, unprofessionell, sowieso arbeitet man – als Pfleger und Hobbyforscher – bei Mehlwürmern quasi gegen die Uhr, weil die Tiere so kurzlebig sind. Die Kollegen am Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Leipzig haben es da mit ihren Schimpansen leichter. Die werden bis zu 50 Jahre alt. Da kann man als Affenforscher ruhig mal ein oder zwei Freisemester einschalten. Bei der taz, wenigstens in der Wissenschaftsabteilung, der die EM-Mehlwurmhaltung angegliedert ist, wird dagegen stramm durchgearbeitet. Anders ist es natürlich bei den taz-Imkern, die komischerweise zur Werbeabteilung gehören. Die können auf alle Fälle im Winter eine ruhige Kugel schieben.
.
Ich will mich aber nicht beklagen, bis jetzt haben mir die Mehlwürmer viel Freude bereitet. Es sind eigentlich harmlose und sehr genügsame Tiere. Vorbildlich geradezu! Neulich las ich: „Mehlwürmer können Zwergbandwürmer auf den Menschen übertragen, weshalb sie nicht roh verzehrt werden sollten.“ Das würde ich sowieso nie tun! Aber seitdem der Wissenschaftsredakteur diese Meldung veröffentlicht hat, geben mir einige Leute in der taz nicht mehr die Hand. Jedenfalls die, die noch an Veröffentlichtes glauben.
.
.
21.
Komisch: Je größer und dreister die Kakerlaken, desto eher nimmt man an, dass sie aus dem Osten stammen, hier nennt man sie polnische Kakerlaken, dort russische. In umgekehrter Richtung, aus dem Westen, vermutete man die Herkunft der die „Lustkrankheit“ Syphilis übertragenden Bakterien: Hier sprach man von der französischen Krankheit , dort von der spanischen. Die gemeine „deutsche Küchenschabe“ heißt auch in Amerika „deutsche Küchenschabe“. Dort gibt es daneben noch einige andere Kakerlakenarten – u.a. „amerikanische“ und „Waldschaben“. Während die Küchenschaben ähnlich den Mehlwürmern Allesfresser sind, haben die Waldschaben sich auf Zellulose spezialisiert. Ihre Darmflora ist ähnlich zusammengesetzt wie die der Termiten.
.
Im Gegensatz zu den Mehlkäfern machen die Kakerlaken keine Metamorphose durch: Sie überspringen das Larven- und Puppenstadium quasi und schlüpfen fertig aus dem Ei. Anfangs sind sie noch klein und haben noch keine Flügel, sie müssen sich mehrmals häuten. Aber Kakerlaken ebenso wie Mehlkäfer fliegen sowieso nicht gerne.
.
Im Haus werden die „Küchenschaben“ meist totgetreten oder sonstwie umgebracht, wenn man sie erwischt. Wegen der feuchtwarmen Luft halten sie sich auch gerne in Bienenstöcken auf. Die amerikanische Imkerin Sue Hubbell schreibt in ihrem Buch „Leben auf dem Land“ (2016), dass sie anfangs die „amerikanischen Schaben“, die sie regelmäßig beim Öffnen ihrer Bienenstöcke fand, mit dem „Stockmeißel“ entzweischnitt. Und jedesmal rannte das hintere Ende weg, das offensichtlich auch ohne den Kopf bestens funktionierte.“ Laut einer US-Kakerlakenstudie sollen sie sogar mit abgeschnittenem Kopf noch „lernfähig“ sein. Sue Hubbel überließ dagegen bald ihren Bienen die Aufgabe, die Schaben und deren Eier aus dem Stock zu werfen.
.
Der Philosoph Martin Heidegger hatte bereits zum Beweis seiner These, dass Tiere „weltarm“ seien, auf ein ähnliches Experiment von Insektenforschern zurückgegriffen: „Es ist beobachtet worden“, führte er in seiner Vorlesung 1929/30 über „Die Grundbegriffe der Metaphysik“ aus, „daß eine Biene, wenn man ihr den Hinterleib während des Saugens vorsichtig wegschneidet, ruhig weitertrinkt, während ihr der Honig hinten wieder herausfließt. Das zeigt schlagend, daß die Biene in keiner Weise das Zuvielvorhandensein von Honig feststellt. Sie stellt weder dieses fest noch auch nur – was noch näher läge – das Fehlen ihres Hinterleibs...Sie ist einfach von dem Futter hingenommen. Diese Hingenommenheit ist nur möglich, wo triebhaftes Hin-Zu vorliegt.“
.
Heidegger gibt nicht an, welcher Insektenforscher das Experiment durchgeführt hat. Genaugenommen ist es ein Plagiat, das Original stammt vom Baron Münchhausen, wobei sich bereits hinter diesem Namen Erzählungen von vielen Autoren verbergen:
.
„Als wir die Türken, zwei Monate später, in die Festung Otschakow hineintrieben, befand ich mich bei der Vorhut und geriet durch die Schnelligkeit meines Litauerhengstes in des Teufels Küche. Ich war mit Abstand der erste hinterm Feind, und als ich sah, dass er die Festung nicht halten wollte, sondern stracks weiterfloh, hielt ich auf dem Marktplatz an und blickte mich um. Aber weder der Trompeter noch meine anderen Husaren waren zu sehen. So ritt ich den Litauer zum Marktbrunnen und ließ ihn trinken. Er soff ganz unmäßig, als wäre sein Durst überhaupt nicht zu löschen. Schließlich wollte ich ihm einen beruhigenden Klaps auf die Kruppe geben und -schlug ins Leere! Als ich mich verwundert umdrehte, blieb mit der Mund offenstehen! Was meint ihr wohl, was ich sah? Nichts! Das Hinterteil des armen Tieres, das Kreuz und die Flanken, alles war fort und wie abgeschnitten! Und das Wasser, das der Gaul soff und soff, floss hinten einfach wieder heraus!
.
Während ich noch grübelte, wie das zugegangen sein mochte, kam mein Reitknecht angaloppiert und berichtete mir atemlos folgendes: Als ich hinter dem fliehenden Feinde durch das Festungstor ritt hatte man gerade das Schutzgatter fallen lassen, und dadurch war das Hinterteil des Pferdes glatt abgeschlagen worden!
.
Übrigens, vor der Festung Otschakow hatte ich mit meinem Husarensäbel so heftig und so lange auf die Türken eingehauen, dass mein Arm, als sie längst über alle Berge waren, ununterbrochen weiterfocht. Um mich nun nicht selber zu schlagen oder Leute, die mir zu nahe kamen, für nichts und wieder nichts zu prügeln, musste ich den Arm acht Tage ganz fest in einer Binde tragen. Dann war er in Ordnung, und ich habe seitdem nichts mehr davon gemerkt. Ähnlich war es mit dem Pferd.“ Diese Münchhausen-Geschichte über die „Hingenommenheit“ (des Pferdes und des Erzählers) hat meistens den Titel: „Der halbierte Litauer“.
.
Das Tier nimmt in der Heideggerschen Entwicklungskonzeption eine mittlere Position ein – zwischen dem „weltlosen“ Stein und dem „weltbildenden“ Menschen. Bei einem anderen Experiment von Insektenforschern schnitt man den Bienen kurzerhand die beiden Fühler ab, um aus dem daraus resultierenden Orientierungsverlust zu schließen, welche Wahrnehmungsaufgaben ihre Fühler haben (eine Menge!). Bei weiteren Experimenten bohrte man sogar den winzigen Kopf von Bienen auf, um zu kucken, was da drin steckt. Seitdem die US-Regierung und die EU die Gehirnforschung mit mehreren Milliarden Dollar bzw. Euro fördern und damit nach dem Gen-Hype einen ganz neuen Geschichtsabschnitt, die „Neuro-Ära“, eingeleitet haben, werden noch ganz anderen Tieren die Schädel geöffnet.
.
Zurück zu den „Waldschaben“: Bei der Imkerin Sue Hubbell gelangen sie mit dem Brennholz ins Haus, aber das ficht sie nicht an: „Ihr Verdauungsapparat und meiner sind so verschieden, dass wir nicht dieselbe ökologische Nische bewohnen.Wir sind keine Konkurrenten, also kann ich Nachsicht mit ihnen üben, d.h.ich muß sie nicht vertreiben,wie die Bienen es tun, oder sie zerquetschen,wie eine Hausfrau es tun würde.“ Stattdessen begriff die Autorin sich als Teil eines neuen, „noch im Versuchsstadium befindlichen Lebensform-Experiments“ der harmlosen Waldschaben in ihrer Hütte, an deren „Körperbau die Evolution seit dem Oberkarbon fast spurlos vorübergegangen ist. 250 Millionen Jahre sind wirklich eine lange Zeit.“ Mindestens so lange gibt es die Kakerlaken bereits.
.
Der Anthropologe Hugh Raffles interessiert sich ebenfalls für Kakerlaken. In seiner „Insektopädie“ (2013) legt er jedoch nahe, dass es ihm nicht recht ist, wenn ein solches Tier sich umgekehrt auch für ihn interessiert: Als eine besonders dicke Kakerlake ihm einmal von oben, von der Schiene des Duschvorhangs aus, zusah, wie er sich wusch, war ihm das unheimlich – und er erschlug sie.
.
Anders der in Berlin lebende russische Maler Nikolai Makarov: Er und seine Freunde waren gerade an den dicksten Küchenschaben interessiert, mit denen sie regelmäßig „Kakerlaken-Rennen“ in ihrem „Tarakan-Klub“ veranstalteten („Tarakan“ heißen die Kakerlaken auf Russisch). Die Tiere wurden zwar von Makarov gefangen gehalten – in kleinen Terrarien, dafür wurden sie regelmäßig mit den besten Lebensmitteln gefüttert, was ihnen wahrscheinlich in den letzten 250 Millionen Jahren noch nie passiert war. Auch nicht, dass man sie mit Namen ansprach. „‚Ivan der Schreckliche‘ gegen die ‚Ehrgeizige Olga‘,“ titelte die FAZ, „beim Kakerlaken-Wettrennen avanciert die gemeinhin als abstoßend empfundene Küchenschabe zum umsorgten und bejubelten Wettkämpfer.“ Der Zeitung erzählte der Maler (der nebenbeibemerkt gerne die Stille malt): „Die Idee habe ich vom Dichter Michail Bulgakow, in seinem Buch ‚Die Flucht‘ beschreibt er, wie sich russische Emigranten im Exil mit Kakerlakenrennen die Zeit vertrieben.“ Die FAZ fügte hinzu: „Inzwischen verweist Makarov auf einen illustren Kakerlaken-Fan-Kreis: Banken, die Berlinale, Modemessen, ein Theaterfestival buchten die schräge Schau. Auch ins Fernsehen zu Stefan Raab hat es Makarov schon mit seinen ‚Haustieren‘ geschafft.“
.
Es gibt auch noch zwei Kakerlaken-Romane, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben: Zum Einen „verfressen, sauschnell, unkaputtbar“ von Hans-Hermann Sprado. Er erzählt darin, wie er in einem Hotelzimmer in Kontakt mit einigen großen Küchenschaben kam, die er „selbst mit roher Gewalt nicht außer Gefecht setzen konnte.“ Woraufhin er „immer mehr Respekt für diese Tiere entwickelte,“ die ihm schließlich zu „dem Erfolgsmodell der Evolution“ wurden. Der andere Roman – von Daniel E. Weiss: „La Cucaracha oder die Stunde der Kakerlaken“ handelt von einer hochgebildeten Kolonie „deutscher Schaben“, die in der New Yorker Wohnung eines jüdischen Juristen leben, wo sie sich in seiner Bibliothek eine erstaunliche Bildung angefressen haben. Ihr eher kontemplatives Dasein wird jedoch gestört, als der Jurist von seiner kakerlakenfreundlichen Freundin verlassen wird und eine neue Freundin bei ihm einzieht, „die sich als Putzteufel und neurotische Hygienefanatikerin entpuppt.“
.
Ihre cucharachafeindlichen Aktivitäten nützen jedoch nichts: „Sind Schaben im Haus, vermag Hygiene wenig. Denn die Allergie-erregende Substanz, die von den Schaben hinterlassen wird, wenn sie nur über eine Wurst oder einen Teller laufen, verträgt sogar einstündiges Kochen bei 100 Grad,“ wie die US-Allergieforscher Halla Brown und Harry Bernton herausfanden. Der Schriftsteller Daniel E. Weiss schreibt, dass die Schaben die Bücher als „Larven“ fraßen, sich demnach also auch wie die neue Freundin seines Protagonisten irgendwann „entpuppten“. Das ist wie oben erwähnt falsch, richtig ist jedoch, dass sie „auch Papier, Tinte und Stiefelwichse verzehren,“ wie der Kakerlakenforscher und Nobelpreisträger Karl von Frisch herausfand.
.
Man kann sie allerdings erziehen: In der Frankfurter Wohnung des Künstlers Johannes Beck und des Trendforschers Matthias Horx gab es einen großen WG-Tisch, in dessen Mitte ein großer Porotonstein lag. Als ich sie bei einem Frühstück nach dem Grund fragte, erfuhr ich, dass ihre Kakerlaken darin wohnen. Sie kämen jedoch erst nach dem Essen raus, um sich die Reste zu holen, danach würden sie sich diskret wieder in ihren Stein zurückziehen.
.
.
22. Im Koran ist die 16. Sure den Bienen gewidmet, es heißt darin: „Aus ihren Leibern kommt ein süßer Trank, der ein Heilmittel ist für die Menschen. Wahrhaftig, darin liegt ein Zeichen für jene, die nachdenken.“
.
Der Prinzessinnengarten in Kreuzberg lud kürzlich zum 4. Stadthonig-Fest ein. Schon vor einigen Jahren hat ein Stadtimker im Akazienwäldchen des Gartens einige Bienenstöcke aufgestellt. Nun gibt es drum herum noch Verkaufs- und Informationsstände. Zu den Veranstaltern zählen Slow Food Berlin, Mellifera, Stadthonig-Vertriebe und ImkerInnen, von denen es in der Berlin rund eintausend geben soll.
.
Ihre Bienenvölker stehen in der Stadt auf Dächern und Balkonen, in Schrebergärten und auf Friedhöfen. Auch ein Redakteur der taz betätigt sich nebenbei als Imker. Auf dem taz-Dachgarten hat eine Imkerin drei Bienenvölker gestellt. Aus einem flog gerade die alte Königin mit einem Schwarm aus – und ward nie mehr gesehen. Auch die Feuerwehr, die bei Schwarmflug oft geholt wird und die die eingefangenen Schwärme, so sie herrenlos sind, gerne an Ökofrauen verschenkt, die sich als Imkerin versuchen wollen, konnte da nicht helfen.
.
Für Aufklärung sorgte der Imkerverein Mellifera. Er erklärte den Bienenfreunden: „Jede moderne Betriebsweise unterdrückt den Schwarm. Die Maßnahmen der ’Schwarmtrieblenkung‘ und einseitige züchterische Selektion sollen ihn im Vorfeld verhindern. Die somit fehlende natürliche Vermehrung der Völker wird durch künstliche Ablegerbildung und Königinnenzucht ersetzt. Dabei ist der Schwarm der eigentliche Höhepunkt der Volksentwicklung. Nur der Schwarmakt kann als Geburt von Bienenvölkern gelten.“
.
Das sollte dann auch auf die ausgeschwärmten taz-Bienen zutreffen und ist überhaupt gegen die „industrielle Bienenhaltung“ gesagt. Imkereien in den USA und in Australien zum Beispiel arbeiten mit bis zu 80.000 Völkern zwecks Bestäubung riesiger Mandelbaum- und Obst- sowie Gemüseplantagen. Das Ergebnis nennt sich nun: „Colony Collapse Disorder“, kurz: „Bienensterben“, noch kürzer: „CCD“. US-Präsident Obama hat dagegen eine „Taskforce“ eingerichtet.
.
In Deutschland gibt es diese „Krankheit“, über die viel geforscht wird, auch schon, obwohl die hiesigen Imker im Durchschnitt nur 7,8 Völker bewirtschaften. Manche machen die in der industriellen Landwirtschaft eingesetzten Gifte für das „Bienensterben“ verantwortlich, andere die sich mehrenden Strahlenquellen von Handys, Internet und TV-Sendern, wieder andere bestimmte Milben oder Viren, und einige begreifen diesen ganzen „Stress“ in der Summe als tödlich für Bienen.
.
Als die Bienen-Forschung in den zwanziger Jahren die Öffentlichkeit faszinierte – unter anderem entdeckte der Zoologe Karl von Frisch damals die „Bienensprache“, mit der sie sich über ergiebige Trachten verständigen –, hielt der Anthroposophie-Begründer Rudolf Steiner vor den Bauarbeitern des Goetheaneums Vorträge über eine wesensgemäße Bienenhaltung. Dabei sagte er voraus, dass die Bienenzucht in 80 oder 100 Jahren in eine große Krise geraten werde – vor allem wegen der künstlich gezüchteten Königinnen. Bemerkenswerterweise hat Steiner damals auch bereits den „Rinderwahnsinn“ (BSE) vorausgesagt – und hinreichend begründet.
.
Zu den eher szenigen Kreuzberger Imkerinnen zählt die Barbesitzerin Erika Mayr. Sie ist Vorsitzende des Imkervereins Charlottenburg/Wilmersdorf und hat ein Buch über „Die Stadtbienen“, so der Titel, geschrieben. Darin erklärt sie auch, warum es in Berlin so viele gibt: Nicht nur stehen hier besonders viele Straßenbäume, bei der Baumauswahl ließ man sich nach dem Krieg vom Potsdamer Gärtner und Imker Karl Förster dazu beraten, und der „wählte gute Trachtbäume aus, deren Blütezeiten unmittelbar aufeinander folgen: Kastanie, Ahorn, Robinie und Linde ... Deshalb liegen die Erntemengen der Stadtimker auch deutlich über denen der Landimker.“ Zudem ist Honig aus der Stadt angeblich weniger mit Pestiziden belastet als der von Landbienen.
.
Zwischendurch scheint dieses bienenfreundliche Wissen aber verloren gegangen sein. So erfuhr Erika Mayr von Mitarbeitern aus den Berliner Grünflächenämtern, dass sie nur noch wüssten: „Birken verursachen Schmutz, und Autos werden von den Blattläusen der Linden ganz klebrig.“
.
Langsam findet jedoch ein Umdenken statt. Nicht nur will die „grüne Stadt“ Berlin mehr Bienenbäume pflanzen, es gibt auch immer mehr Imker. Damit dürfte es hier bald genug Bienen geben. In Brandenburg gibt es dagegen ein Defizit: Für eine flächendeckende Bestäubung wären vier Völker pro Quadratkilometer nötig, Brandenburg kommt aber bei dieser Rechnung nur auf ein Volk.
.
Erika Mayr wird auch „Biene Mayr“ genannt, in Anspielung an den Bestseller „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“ von Waldemar Bonsels aus dem Jahr 1912. Nachdem jüngst ein Biologe dem Buch in einer Art Gutachten politische Unkorrektheiten nachgewiesen hatte und eine „monarchisch-imperialistische“ und eine „sozialdarwinistisch getönte rassistische Tendenz“ aufdeckte, kam prompt eine „kindgerechte“ Fassung auf den Markt. Streitpunkt ist die finale Immenschlacht gegen ein verschlagenes Hornissenvolk, bei dem die wackeren Bienen alle Angreifer vernichten. In der gereinigten Version entfällt nun das Stechen und Sterben, die Hornissen werden nur übertölpelt, gefangen genommen und ausgewiesen.
.
22a. Wegen des anhaltenden Bienensterbens kommen immer mehr Bücher über sie auf den Markt. Der Dresdner Dichter und Bienenfreund Marcel Beyer, dessen verstorbener Dichterkollege Thomas Kling ein Wespenfreund war, trug in Göttingen Passagen aus seinem Essay „Mein Bienenjahr lesen“ vor. Die anwesende Literaturwissenschaftlerin Christiane Freudenstein wies ihn anschließend darauf hin, dass auch der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch ein großer Bienenfreund war – und sogar einige bienenkundliche Artikel verfasste. Das war Marcel Beyer neu, er fragte Christiane Freudenstein, ob sie diese nicht veröffentlichen könne ...
.
Soeben erschienen sie im Göttinger Wallstein-Verlag. Im Vorwort der Literaturwissenschaftlerin erfährt man: Wilhelm Buschs Brüder Otto, Adolf und Hermann „unterhielten Bienenstände“ und Wilhelm Busch wurde im Alter von neun Jahren zwecks „Erziehung“ zu seinem bei Göttingen lebenden Onkel Pastor Georg Kleine gegeben: einer der „Koryphäen der deutschen Bienenzüchter“; Verfasser des Buches „Die Bienen und ihre Zucht“ und Herausgeber des Bienenwirthschaftlichen Centralblatts.
.
Er begeisterte Wilhelm Busch derart für die Imkerei, dass dieser, als die Eltern sein „Lotterleben“ als Künstler nicht mehr finanzieren wollten, den Gedanken fasste, als „Bienenzüchter nach Brasilien“ zu gehen. Aber „es sollte nicht sein; ich gerieth auf andere Bahnen“.
.
Im 19. Jahrhundert hatte der Honig eine große wirtschaftliche Bedeutung: Er war für die Armen das einzige Süßungsmittel. Bis zur Hochzüchtung der Zuckerrübe gab es bloß importierten Rohrzucker aus den Kolonien, den sich nur die Reichen leisten konnten. Heute ist es umgekehrt!
.
Damals gab es allein im Königreich Hannover 300.000 Bienenstöcke, schrieb Wilhelm Busch 1867 in seinem Artikel „Unser Interesse an den Bienen“. Zuvor hatte der Direktor der Spandauer Realschule, Christian Konrad Sprengel, entdeckt, dass die Befruchtung der Blütenpflanzen durch Insekten geschieht (nicht mechanisch, durch direkten Kontakt oder den Wind, wie bis dahin angenommen) – und deswegen gefordert: „Weil die Bienenzucht die Wohlfahrt aller Einwohner eines Landes befördert, muss der Staat ein stehendes Heer von Bienen haben.“
.
Einer der ersten Beiträge von Wilhelm Busch für den „Münchner Bilderbogen“ hat den Titel „Die kleinen Honigdiebe“. Sein letztes größeres Werk – „Schnurrdiburr“ – thematisierte einen Bienenschwarm, der nicht wieder eingefangen werden konnte. Die Schwarmbildung war auch in der Korrespondenz mit seinen Brüdern immer Thema. In seinem Artikel für die Imkerzeitung, „Kennen die Bienen ihren Herrn?“, versetzte er sich in ihre Lage und kam zu dem Schluss: Die Imker sind „die allergrößten Honigdiebe unter der Sonne“.
.
Im dritten Artikel „Das Netz einer Bienenzelle“ (1868) erklärte Wilhelm Busch die Mathematik der Bienenwaben (zum Nachbauen). Der Würzburger Bienenforscher Jürgen Tautz erkennt dagegen die „Intelligenz der Bienen“ heute eher im verwendeten Wachs, den er einen „intelligenten Werkstoff“ nennt: „Die Bienen bauen ihre Waben rund, wenn sie das Wachs auf 45 Grad erwärmen, werden sie sechseckig.“ Demnach bauen die Wespen ihre papiernen Waben als präzisere Rhombendodekaeder.
.