“Tierversuche sind oft grausam – unnötig sind sie leider trotzdem nicht”, meint der Wissenschaftsjournalist Arvid Leyh. Für diese Erkenntnis hat der eingefleischte Vegetarier etwas länger gebraucht. Ein Gastbeitrag von Arvid Leyh.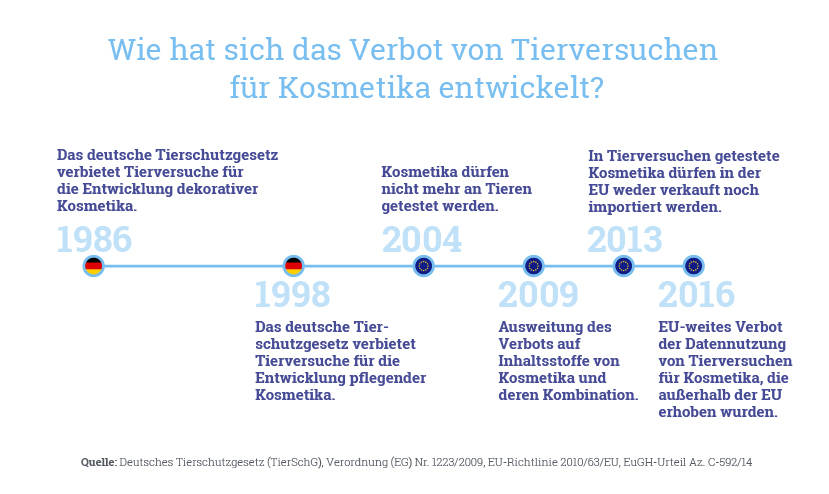
Zu Tierversuchen gibt es nur zwei Meinungen. Befürworter berufen sich auf die Notwendigkeit von Erkenntnissen, die anders nicht zu gewinnen seien. Gegner betonen die Grausamkeit der Versuche und die Hybris der Wissenschaftler. Beide Positionen sind moralisch stark aufgeladen – und das macht die Diskussion nahezu unmöglich: Zwischen richtig und falsch ist kein Konsens zu finden.
Moralische Positionen sind immer subjektiv – und dies ist ein subjektiver Text. Ein Text, der sucht, der aber – hier der Spoiler – keine einfache Antwort findet. Dabei hatte ich mal eine: Ende der 80er hatte ich genug Bilder von Putenfarmen und Schweinetransporten gesehen und wurde Vegetarier. Ich wollte nicht Teil dieser Fleischindustrie sein. Und sollte auch nur ein Schwein meinetwegen überleben, hätte es sich schon gelohnt. Da der Durchschnittsdeutsche im Jahr 88 Kilo Fleisch vertilgt, ist das nur ein Tropfen, aber ich fühle mich gut damit. Und darauf kommt es an.
Alternativen zu Tierversuchen
Während die Technik fortschreitet, ergeben sich immer alternative Möglichkeiten zu Tierversuchen. Zu deren Entwicklung hat das BMBF seit 1980 500 Projekte gefördert.
Zellkulturen sind jetzt schon weit verbreitet. Menschliche Haut lässt sich zum Beispiel künstlich herstellen.
Zellkulturen sind wichtige Ergaenzungs- und Ersatzmethoden für Tierversuche. Foto: Umberto Salvagnin
Bildgebende Verfahren werden auch bei Versuchstieren eingesetzt. Inzwischen gibt es sogar Scanner für Mäuse.
Die meisten Versuche der Pharmafirmen finden inzwischen in vitro statt und werden von Computern gesteuert.
Für den Unterricht gibt es zum Beispiel virtuelle Blutegelganglien, simuliert auf einem Computerchip. So lassen sich einzelne Neurone reizen und ihre Reaktionen auslesen.
Tiere sind auch Menschen
Diese Linie des vegetarischen Lebens hat sich seitdem stetig verlängert, denn wer sich intensiv mit Geist und Gehirn beschäftigt, lernt in der Biologie schnell, dass sich der Mensch vom Tier nicht großartig unterscheidet. Unsere Emotionen mögen mehr Facetten haben, aber was Jaak Panksepp in seiner Affective Neuroscience beschreibt, hat er an Ratten gelernt: Sie fürchten um ihr Leben, sie sind liebevoll zu ihrem Nachwuchs, sie können sogar lachen. Pferde erkennen die Mimik von Menschen, Rabenvögel verfügen über eine Theorie of Mind, Schimpansen betrügen. Und auch wenn die klügsten Tiere über massiv geringere kognitive Fähigkeiten verfügen als wir – es geht nicht um Intelligenz und Bewusstsein, es geht um die Reichhaltigkeit der emotionalen Welt. Zusammengefasst gehöre ich also bei den Positionen in der Debatte, die Max Suddenhoff in seinem Buch „Der Unterschied zwischen Mensch und Tier“ beschreibt, zu den Romantikern.
Foto: Understanding Animal Research
Auch das ist eine komfortable Gutmenschenposition, richtig und falsch sind einmal mehr eindeutig verteilt und lange galt mir das auch für Tierversuche. Doch dann, vielleicht im fünften Jahr meiner Aktivität als hauptberuflicher Hirnberichterstatter, wurde mir klar, worüber ich da berichtete: So gut wie jede Erkenntnis, die wir zum Gehirn haben, stammt aus einem Tierversuch. Sensorik und Motorik, das Geschehen an den Synapsen, die molekularen Grundlagen von Krankheiten wie Multipler Sklerose, Schlaganfall, Alzheimer – all das wissen wir, weil irgendwann Tiere dafür gelitten haben. Das zwang mich zum Denken.
Versuche am lebenden Wesen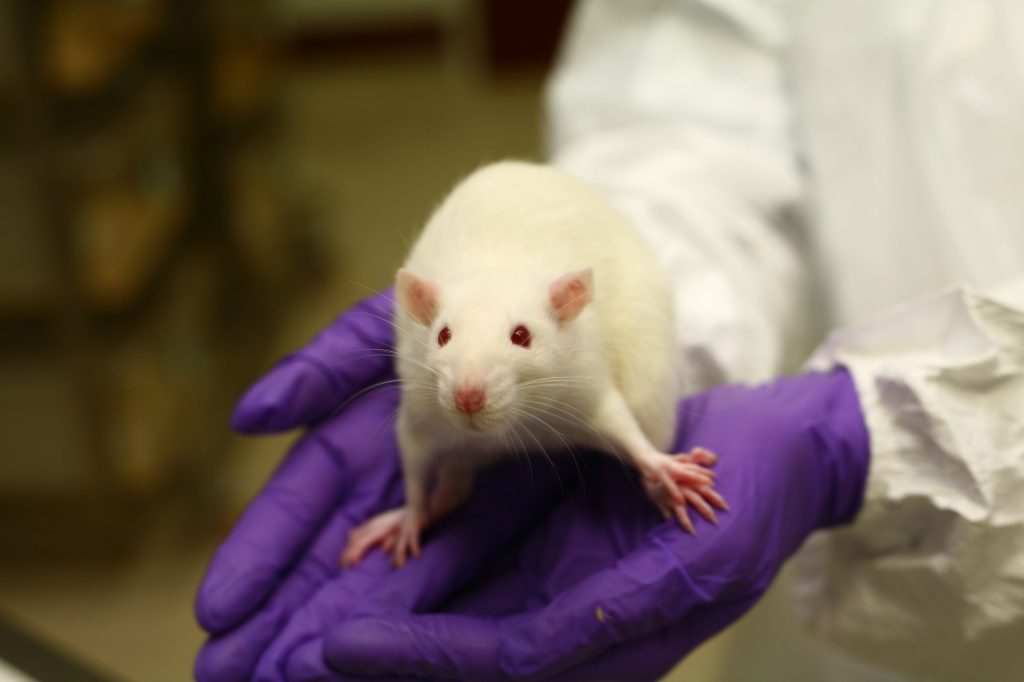
Versuche am Menschen sind verboten und stoßen uns ab, nahezu automatisch erscheint der Name Mengele auf dem mentalen Bildschirm. Versuche an Tieren sind reglementiert, aber erlaubt. Wir denken dabei schnell an die Kosmetikindustrie und unnötig gequälte Kaninchen. Oder, schlimmer noch, wir denken an die Tierversuche der „Naturphilosophen“ der Royal Society in den Zeiten der Aufklärung. Unsägliche Grausamkeiten wurden begangen, noch heute kann einem schlecht werden bei so viel mittelalterlicher Grausamkeit. Descartes hatte zwar die Wissenschaft vom Reglement der Kirche befreit, die Tiere aber außen vorgelassen: Sie galten ihm nur als unbelebte Automaten.
Wie hat sich das Verbot von Tierversuchen für Kosmetika entwickelt?
Hat sich das inzwischen verbessert? In den Augen der Tierversuchsgegner nicht, und dazu zählen inzwischen erstaunlich viele Studenten. Spricht man mit Anatomen, beklagen die öfter mal den Widerstand angehender Mediziner, sich im Präp-Kurs „die Hände schmutzig zu machen“: Man könne doch auch eine virtuelle Maus präparieren. Doch hier gibt es vermutlich auch Verständnis von Tierversuchsgegnern – gerade Mediziner sollten wohl über möglichst vielfältige Erfahrungen mit dem Körperinneren verfügen, bevor sie praktische Ärzte werden.
Unnötige Forschung?
Die Tierversuche, über die wir hier reden, haben allerdings weniger mit dem Medizinstudium zu tun. Oft geht es um physiologische Zusammenhänge ohne absehbar praktischen Nutzwert. „Grundlagenforschung“ heißt das: Wissen, um des reinen Wissens willen. Und hier wird es kritisch, auch und gerade für mich, der sich für das Gehirn interessiert, weil er sich selbst verstehen möchte; es ist nicht überlebensnotwendig, zu wissen, wie ich ticke. Entsprechend unterstellt man auch den Wissenschaftlern gern, ihre Forschung sei reiner Selbstzweck.
In gewissem Sinn stimmt das. Ein Wissenschaftler hat eine Frage, die er beantworten möchte. Zeigt sich im Lauf der Forschung, dass nur ein Tierversuch die Antwort geben kann, muss er diesen beantragen und begründen: Warum muss es eine Maus sein – reicht nicht auch eine Fruchtfliege? Hat er sämtliche Kurse im Umgang mit Versuchstieren gemacht? Ist der Versuch ethisch begründbar? Und bei all diesen Regularien kamen trotzdem im Jahr 2014 drei Millionen Tiere ums Leben. Warum?
Warum forschen Wissenschaftler an Mäusen?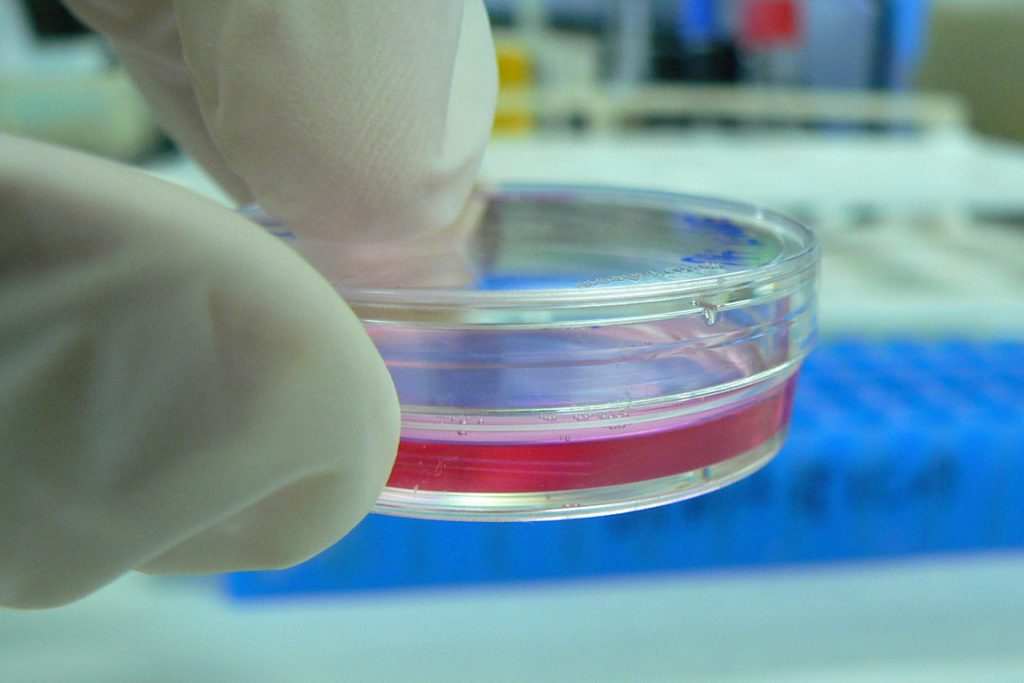
Oft wissen wir es, oft genug auch nicht. Was bei der Multiplen Sklerose beispielsweise als „Entmarkung“ bezeichnet wird, betrifft die eine bestimmte Gruppe von Gliazellen, die Oligodendrozyten. Über sie wissen wir inzwischen einiges, können die Krankheit aber immer noch nicht heilen. Das bedeutet nicht, dass die Forschung sinnlos gewesen wäre. Es bedeutet vielmehr, dass die Prozesse in unserem Körper von hunderten biochemischen Faktoren abhängen, die immer kleinteiliger werden, je mehr wir darüber wissen. Über zwanzig Stoffe sind heute – Stand März 2016 – bekannt, die bei MS eine mehr oder minder wichtige Rolle spielen. Und Multiple Sklerose ist hier nur ein Platzhalter. Schaut man auf die großen neurologischen Krankheiten, wiederholt sich die Komplexität. Kein Wunder, dass die großen Durchbrüche bislang immer noch ausstehen.
Also keine Tierversuche?
Alles bislang Gesagte spricht gegen Tierversuche. Aber so einfach ist es nicht. Zwar sind auch Wissenschaftler nur Menschen und freuen sich über sensationelle Entdeckungen mit ihrem Namen darauf. Aber sie sehen sich auch in der Verantwortung – etwa den rund 130.000 Patienten mit Multipler Sklerose allein in Deutschland gegenüber – und allen anderen Kranken. Das ist Teil des Hippokratischen Eides. Wer einmal einen Parkinson-Patienten ohne und dann mit eingeschalter Tiefhirnstimulation gesehen hat, versteht das sofort. Aktuell verschafft diese Technik 10.000 Patienten ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben. Eine Technik von vielen, die es ohne Tierversuche nicht gäbe.
Ich könnte als weiteres Beispiel Organtransplantationen nennen, die weitaus häufiger praktiziert werden. Oder als Hoffnungen Stammzelltherapien und Neuroprothesen. Solche Forschungen sind es, die mich zum Umdenken brachten. Und das vor allem, seit ich Vater bin: Meine Kinder haben keine ernsthaften Krankheiten, doch ich habe schon über viel neurologisches Elend geschrieben – genug, um meine Fantasie in stillen Nächten zu füttern. Eltern kennen das und kommen vermutlich zu demselben Schluss: Sollte eines unserer Kinder eine schwere Krankheit bekommen, würden wir, würde ich, sofort jede Art von Bedenken über Bord werfen – kein tierisches Leben kann so wichtig sein, wie das Leben meiner Kinder.
Keine einfache Antwort
Jeder Patient ist Vater, Mutter, Kind von irgend jemandem. Dass die moderne Medizin so vielen von ihnen helfen kann, verdankt sie vor allem Tierversuchen – bis zurück zu denen der frühen Royal Society. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Doch auch wenn alles in mir nach Alternativen schreit, sind Tierversuche an vielen Stellen aktuell nicht zu ersetzen. Sie pauschal abzulehnen bedeutet, das Leben vieler jetziger und kommender Patienten aufs Spiel zu setzen. Das kann nur wollen, wer selbst im eigenen Umfeld nicht betroffen ist – was über die Spanne eines ganzen Lebens selten der Fall ist.
Wie hoch ist der Anteil von Versuchstieren an der gesamten Nutzung von Tieren?
Die wenigsten Menschen würden Fleisch essen, wenn sie die Tiere selbst erlegen müssten. Sie machen es sich einfach, weil sie es sich einfach machen können: Andere töten, andere weiden aus. Ähnlich einfach machen es uns wir Vegetarier, denn wir können uns zu dieser Zeit in dieser Gesellschaft ohne Probleme fleischlos und trotzdem vollwertig ernähren. Ginge morgen der Strom aus, müssten wir wieder Hasen jagen – das wäre gewöhnungsbedürftig.Bei Tierversuchen ist es ähnlich: Wir können es uns leisten, gegen sie zu sein. Doch diese Position blendet vergangene Erkenntnisse aus und braucht noch keine kommenden. Tatsächlich aber brauchen wir Tierversuche – und wenn nicht wir, dann andere. Menschen.
Aus diesem Dilemma gibt es keinen Ausweg: Irgendjemand leidet in jedem Fall und darüber nachzudenken, erzeugt eine Spannung, für die wir psychologisch nur schlecht ausgerüstet sind. Nach meinem persönlichen Erleben gibt es einige solcher ethischen Dilemmata – und ich muss mit ihnen leben.
Der Artikel ist zuerst erschienen auf www.dasGehirn.info.
Das könnte Sie auch interessieren
Tag des Versuchstieres – “Wir wissen viel besser, was im Gehirn passiert”
Tag des Versuchstieres – Tierversuche ermöglichten Therapien gegen Volkskrankheiten
DFG-Broschüre „Tierversuche in der Forschung“ jetzt auch auf Englisch
Prechts “Tiere denken” enttäuscht





