Über den angemessenen Umgang mit Tieren bei ihrer Thematisierung:
.
Früher, als ich noch über Kaufleute, Manager, Betrüger und Unternehmer Texte schrieb, gab es immer wieder Gegendarstellungen, Ärger, Klagen etc., von den darin „Thematisierten“, aber seitdem ich über Pflanzen und Tiere schreibe, passiert so etwas seltsamerweise nicht mehr. Dabei sollen sich letztere doch laut Darwin von den ersteren kaum unterscheiden – und umgekehrt. Die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, kann als echte Darwinistin nur bestätigen, “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“.
.
1. Kuhglocken-Streit in der Schweiz
Der aus Thüringen stammende Alfred Brehm schrieb 1883 über das musikalische Gehör der Kühe im Thüringer Wald: „Jede Herde besitzt ihr eigenes vollstimmiges Geläute, und gerade in ihm suchen die Hirten ihren größten Stolz. Es gibt gewisse Tonkünstler, die Schellenrichter, die im Frühjahr von Dorf zu Dorf ziehen, um das Geläute zu stimmen. Jede Herde muß wenigstens acht verschiedene Glocken haben, die großer, mittlerer und kleiner Baß, Halbstampf, Auchschell, Beischlag, Lammschlag und Gitzer genannt werden. Man hat beobachtet, daß die Rinder das Geläute ihrer Herde genau kennen und verirrte Kühe durch dasselbe sich zurückfinden.“
In den letzten Jahren wurde immer mal wieder versucht herauszufinden, wie Kühe auf Musik im Stall reagieren: Bei klassischer Musik geben sie angeblich mehr Milch, bei Volks- und Rockmusik weniger. Mit Klaviermusik kann man sie auch auf der Weide von weither anlocken, wie ein argentinischer Pianist mit einer Herde auf Youtube vorführte. In Spanien beschallt die Familie Siebert 700 Kühe auf ihrer Priegola-Farm jeden Tag. „Es klappt nur mit Mozart“, sagt der Bauer. Seine Kühe würden damit täglich ein bis sechs Liter mehr Milch produzieren. Es gibt nicht wenige „Experten“, die in der Milchmenge einen Indikator für die Zufriedenheit einer Kuh sehen. Neuerdings wird in der Schweiz darüber geforscht und gestritten, inwieweit die Kühe von den Glocken um ihren Hals in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden.
Die Schweizer sind zu Recht stolz auf ihre Kuhkultur, Bauern und Sennerinnen genießen hohes Ansehen, die Kuhforschung hat weltweite Bedeutung. Als die Wissenschaftler jedoch untersuchten, ob Kuhglocken nicht die reinste Folter für die Kühe seien, gerieten die Agrarfunktionäre in Rage: Sie sollten sich lieber wichtigeren Dingen widmen, die Kuhglocken seien ein hohes Schweizer Kulturgut. Kunstschaffende schwärmen von der „Magie der Kuhglocken“, die Tourismuswerbung vom „Soundtrack der Alpen“. Als sich eine Bürgerinitiative gegen den Lärm der Glocken bildete, konterten die Milchbauern: Das seien alles Städter – mithin nicht ernst zu nehmen. Die Kuhforscher legten nach: Der Schallpegel der Glocken, bis zu 100 Dezibel, den auch Motorsägen erreichen, könne zu Gehörschäden und Verdauungsstörungen führen. Statt Glocken sollte man heute zur Ortung der Kühe besser GPS verwenden. Die patriotische Presse und die Bauern tobten. Auf Facebook bekriegte sich eine „Pro“ und eine „Contra Kuhglocken“- Partei. Das Zentrum für tiergerechte Haltung Tänikon gab zu bedenken, man müßte die Kühe selbst befragen. Auch der Wissenssoziologe Bruno Latour riet, den Kühen das Wort zu erteilen. Aber wie? Eine vorläufige Antwort gab eine Gruppe von Elefanten in einem indischen Forstbetrieb: Wenn sie nach Feierabend in den Wald entlassen wurden, fielen sie oft in Plantagen ein. Ihre Mahuts banden ihnen schließlich Kuhglocken um, damit die Bauern rechtzeitig gewarnt wurden und die Elefanten vertreiben konnten. Das funktionierte auch – bis zu jenem Tag, als die Elefanten das akustische Warnsignal ausschalteten und ungestört eine Bananenplantage abernteten: Sie hatten alle ihre Glocken mit Schlamm verstopft. Den Kühen müßte man auf den Almen erst einmal Schlammkuhlen einrichten, damit sie in dieser Sache entscheidungsfähig werden.
Leserbrief von Christoph Krolzig, 78337 Öhningen:
Wer schon mal entlaufene Rinder zusammen getrieben hat, kann sich das
nicht so richtig mit einem GPS Tracker vorstellen. Man rennt bergauf und
bergab, in Schweiß gebadet, bei Brillenträgern die Brille total
verschmiert, alle Sinne total angespannt. Man muss Entscheidungen in
einem Bruchteil von Sekunden treffen. Das geht manchmal durch Brombeeren
und Büsche, wodurch einem nachher schon mal die Kleider in Fetzen vom
Leib hängen können. Gute Ortskenntnisse sind gefragt und das Wissen um
die Psychologie der Kühe, welche wehrhafte Fluchttiere sind. Wenn eine
viel befahrene Straße, eine Bahnlinie oder ein Gemüsefeld in der Nähe
sind, bleibt keine Zeit inne zu halten, um an irgendwelchem Elektrokram
herum zu fummeln.
Kuhglocken funktionieren auch im Gewitter-, Sonnen- oder Schneesturm,
oder wenn bei einem Sturz das GPS verloren geht, oder bei der Kuh die
Batterie am Sender leer ist.
Kühe sind keine Elefanten. Wenn Kühe im Frühjahr vor dem Austrieb ihre
Glocken umgehängt bekommen, haben sie so ein Leuchten in den Augen und
eine nervöse Vorfreude befällt sie. Das ist wohl die pawlowsche
Konditionierung, weil die Glocken ihnen signalisieren, dass es jetzt
wieder auf die Weide geht, aber wenn ihnen die Glocken total lästig
wären, würden sie sich so nicht verhalten.
Ich rate jedem, der zu diesem Thema was zu sagen hat, zu einem
Sommerpraktikum auf einer Alm, oder bei einem Weidebauern. Das bringt
Realität in die Diskussion. Man nennt das auch Feld- (oder Wiesen-)
forschung.
.
Kuh-Denkmal "Us Mem" in Leeuwarden.
Bauernkriegsdenkmal-Entwurf von Albrecht Dürer .
Chrustschowscher Offenstall auf der LPG Tierproduktion "Florian Geyer" Saarmund..
2. Löwen und Schimpansen schießen
Mit den Löwen passieren seltsame Sachen. Das fing schon mit der Französischen Revolution an: 1792 erlaubte die Nationalversammlung eine Fortexistenz der königlichen Menagerie nur unter der Bedingung, dass der Löwe nicht mehr als „König der Tiere“ firmieren durfte. Dem kamen die Menageriekuratoren sogleich wissenschaftlich nach. Danach gehörte er bloß noch zu den „Katzenartigen“, ansonsten änderte sich nicht viel für ihn in Paris. Der Revolutionshistoriker Jules Michelet träumte jedoch etwa zur gleichen Zeit davon, die gefangen gehaltenen Löwen wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die wahre Naturgeschichte vorzutragen.
2002 berichtete ‚Der Spiegel‘: „Der Tod des einäugigen Löwen Marjan im Zoo der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Tierfreunde in aller Welt erschüttert. Er hatte die Invasion der Sowjetunion, den Bürgerkrieg, die Taliban und zuletzt die US-Bombenangriffe überlebt. Das Tier kam 1974 mit Hilfe des Kölner Zoos nach Kabul. Als vor einiger Zeit ein Taliban-Kämpfer in den Käfig kletterte, um seine Tapferkeit zu beweisen, fraß Marjan ihn. Der Bruder des Taliban warf daraufhin eine Granate auf ihn, weshalb er am Ende halb blind und lahm sein Dasein fristete. Marjan starb am Montag an Nierenversagen.“
Aber seit 2014 hat der Zoo in Kabul
wieder
einen neuen Löwen: „Die Welt“ schrieb: „Er fristete ein trostloses Dasein auf dem Dach einer Luxusvilla in Kabul – nun ist der Löwe Mardschan die neue Attraktion im Zoo der afghanischen Hauptstadt. Ein reicher afghanischer Geschäftsmann hatte vor etwa einem Jahr für 20.000 Dollar das Löwenjunge gekauft. Die Raubkatze hauste auf der Dachterrase seines Palastes in Kabul, ansonsten vernachlässigte er das Löwenjunge jedoch sträflich. Vertreter der Tierschutzbehörde nahmen es schließlich in ihre Obhut. Diese Woche präsentierte der Zoo den wieder aufgepäppelten Löwen als seine neue Attraktion. Nach Angaben des behandelnden Tierarztes Abdul Kadir Bahawi war Mardschan fast tot, ‚er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mal mehr seinen Kopf heben. ‚Wir wussten nicht, ob er überlebt. Aber unsere Bemühungen haben Früchte getragen, und er ist heute bei guter Gesundheit, er spielt gerne und ich denke, er mag uns sehr‘.“
Jetzt, im Sommer 2015, sorgt ein Löwe in Zimbabwe für Schlagzeilen: Cecil. Der 13jährige Rudelführer war die Attraktion des „Hwange National Parks“ – bis er Ende Juni von einem reichen amerikanischen Großwildjäger erschossen wurde. 2009 war Cecil mit seinem Bruder in einen Kampf mit einem Rudelführer geraten, wobei er verwundet und sein Bruder getötet wurde. Aber auch ihr Gegner war verletzt worden – so schwer, dass die Parkranger ihn schließlich erschossen. Cecil hatte sich derweil in einen anderen Teil der Parks zurückgezogen, wo er ein eigenes Rudel „erwarb“ und sich mit einem anderen Löwen namens Jericho anfreundete. Ihre zwei Rudel umfaßten zuletzt sechs Weibchen und ein Dutzend Kinder.
Cecil hatte man 1999 einen GPS-Chip unter die Haut transplantiert, seit 2008 wurde sein Leben von Zoologen der Oxford Universität wissenschaftlich begleitet. Er war an die Nähe der Menschen gewohnt, mit dem Auto konnte man sich ihm bis auf 10 Meter nähern, ohne dass er unruhig wurde. Das machte ihn laut Wikipedia „so populär“.
Benamt wurde „Cecil“ nach dem englischen Großwildjäger und südafrikanischen Politiker Cecil Rhodes, der 1889 Nord- und Südrhodesien (heute Sambia und Zimbabwe) unter britische Herrschaft brachte. Er gilt als einer der skrupelosesten Imperialisten. Sein Diamantenkonzern „De Beers“ besitzt noch heute faktisch das Welt-Diamantenmonopol.
Der amerikanische Zahnarzt und Hobbyjäger Walter Palmer, der Cecil erschoß, zahlte angeblich 50.000 Dollar an den Jagdwild-Vermittler Theo Bronkhorst, um „Cecil“ zu töten. Dazu wurde der Löwe mit Fleisch aus dem Nationalpark heraus und auf ein Privatgelände gelockt, das einem Einheimischen namens Honest Ndlovu gehörte. Dort schoß Palmer mit Pfeil und Bogen (dpa spricht von einer Armbrust) auf Cecil, wobei er ihn verwundete, erst 40 Stunden später fand er ihn im Busch, wo er den Löwen erschoss. Anschließend trennte er Cecils Fell und seinen Kopf ab. Während Palmer sich kürzlich von den USA aus für seine Tat entschuldigte, wurden seine einheimischen Helfer festgenommen. Der Generalstaatsanwalt von Zimbabwe fordert die Auslieferung von Palmer. In den USA forderten inzwischen über 100.000 Menschen ebenfalls seine Auslieferung an Zimbabwe. Cecils Tod sei eine „vermeidbare Tragödie“ gewesen, die den Bedarf an strengeren Gesetzen verdeutliche, meinte ein demokratischer Senator im US-Kongreß während einer Debatte über Cecil. Das für Artenschutz zuständige US-Innenministerium schlug vor, den afrikanischen Löwen als gefährdete Art einzustufen.
Der amerikanische Zahnarzt und Hobbyjäger Walter Palmer, der Cecil erschoß, zahlte angeblich 50.000 Dollar an den Jagdwild-Vermittler Theo Bronkhorst, um „Cecil“ zu töten. Dazu wurde der Löwe mit Fleisch aus dem Nationalpark heraus und auf ein Privatgelände gelockt, das einem Einheimischen namens Honest Ndlovu gehörte. Dort schoß Palmer mit Pfeil und Bogen (dpa spricht von einer Armbrust) auf Cecil, wobei er ihn verwundete, erst 40 Stunden später fand er ihn im Busch, wo er den Löwen erschoss. Anschließend trennte er Cecils Fell und seinen Kopf ab. Während Palmer sich kürzlich von den USA aus für seine Tat entschuldigte, wurden seine einheimischen Helfer festgenommen. Der Generalstaatsanwalt von Zimbabwe fordert die Auslieferung von Palmer. In den USA forderten inzwischen über 100.000 Menschen ebenfalls seine Auslieferung an Zimbabwe. Cecils Tod sei eine „vermeidbare Tragödie“ gewesen, die den Bedarf an strengeren Gesetzen verdeutliche, meinte ein demokratischer Senator im US-Kongreß während einer Debatte über Cecil. Das für Artenschutz zuständige US-Innenministerium schlug vor, den afrikanischen Löwen als gefährdete Art einzustufen.
Absurderweise wurden und werden in den Zoologischen Gärten jedoch immer wieder Jungtiere geradezu massenhaft getötet, weil die Löwen sich auch in Gefangenschaft fleißig vermehren – und es nicht genug Abnehmer für ihren Nachwuchs gibt. Für die freilebenden, die immer weniger werden, ebenso wie die ihnen zur Verfügung stehenden Freiflächen, gilt wenigstens in Zimbabwe nun, dass die Großwildjagd dort rigoros verboten wird.
Das Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie fand daraufhin einen zivilisatorischen Kompromiß, dem die Doppelbedeutung von „shoot“ – Erschießen und Filmen – zugrunde liegt: Die Forscher hatten in den letzten Wäldern einiger westafrikanischer Staaten „Kamerafallen“ aufgestellt. Diese lieferten ihnen 7000 Stunden Material. Sie werden von den Wissenschaftlern in kurze Sequenzen aufgeteilt und ins Netz gestellt. Und dann sollen wir (User) uns einzelne Teile davon ankucken und all jene Stellen markieren, wo ein Schimpanse durchs Bild läuft. Ihn sozusagen virtuell erschießen. Die Primatenforscher müssen dann nicht das ganze Material alleine sichten, wir – „Citizen-Scientists“ – leisten die Vorarbeit für sie, als eine Art Treiber, um, wie es heißt, „neue Erkenntnisse über die Lebensweisen und Vorkommen wildlebender Schimpansen in unterschiedlichen Lebensräumen“ zu gewinnen. Die Leipziger versprechen sich davon „Hinweise zur Entstehung des modernen Menschen.“ Also wie wir wurden was wir sind.
Literatur:
Über wirkliche Löwen: Joy Adamson: „Frei geboren. Eine Löwin in zwei Welten“ (1960), „Die Löwin Elsa und ihre Jungen“ (1962) und „Für immer frei. Elsas Löwenkinder finden eine neue Heimat“ (1962)
Über metaphorische Löwen: Hans Blumenberg: „Löwen“ – In vielen Jahren hat Hans Blumenberg in der Literatur, der bildenden Kunst und der Philosophie die unterschiedlichsten Löwenbilder und -geschichten gesammelt und sich seine Gedanken dazu gemacht. So auch über die Löwen des Henri Rousseau, die er als „verhinderte“ Löwen bezeichnet, denn Rousseau habe das Paradies gemalt. Paradiese aber „sind dadurch definiert, daß in ihnen Löwen am wenigsten das sein können, was sie sind, zugleich aber an ihrem Wesen nicht leiden können...“
Weltweit sind neben Adlern die Löwen – einzeln oder gleich mehrfach – das beliebteste Staatssymbol: in Indien, Singapur, Burma, Sri Lanka, Kenia, Malawi, Äthiopien, Luxemburg, Belgien, Bayern, Rumänien, Tadschikistan, Georgien und Armenien beispielsweise.
.
.
.
.
.
3. Das Walblasen
Wale können auf zweierlei Weise Atemluft ausblasen. Einmal durch ihre Atemlöcher auf der Kopfoberseite und zum Anderen durch den Mund. Wie wir müssen sie beim Tauchen die Luft anhalten, damit sie lange genug unter Wasser bleiben können und tief genug kommen, um Nahrung zu finden. Einige Arten können bis zu zwei Stunden tauchen, dazu speichern sie in ihrem Blut und ihren Muskeln Sauerstoff. Ist ihre Luft verbraucht, tauchen sie auf und stoßen diese durch ihre Atemlöcher aus – was wie eine Fontäne aussieht. Seeleute berichten, dass manche Wale sich einen Spaß daraus machen, die Fontäne so auszustoßen, dass die Schiffsmannschaft naß wird. Außerdem stinkt ihre ausgeblasener Atem unangenehm und ist laut.
Die andere Möglichkeit, Luft auszustoßen, besteht darin, dass sie Luft aus dem Mund blasen. Der „Berliner Kurier“ zeigt auf seiner Internetseite ein Video, auf dem Beluga-Wale unter Wasser Ringe blasen. Dazu formen sie ihren Mund – ähnlich wie Tabakraucher, die Ringe ausstoßen – zu einem Kussmund.
„Spektrum.de“ erwähnt Buckelwale, die „Blasenjagden“ auf Fische veranstalten. Sie treiben zu mehreren einen Schwarm nach oben, „dann produzieren sie regelrechte Blasenvorhänge, indem sie Luft ins Wasser ablassen, um die Beute weiter zu konzentrieren, bevor sie schließlich mit weit geöffnetem Maul senkrecht aufsteigen, um ganze Schwärme auf einmal zu verschlingen.“ Die Autoren teilen allerdings nicht mit, ob die Wale ihre „Blasenvorhänge“ mit den Atemlöchern bilden oder mit dem Maul oder mit beidem. Der in arktischen Gewässern lebende Grönlandwal besitzt wie alle Bartenwale zwei Blaslöcher, mit denen er zwei Fontänen bis zu vier Metern hoch blasen kann. Der Blauwal sogar bis zu zehn Meter. Zwar blasen die Wale ihre verbrauchte Atemluft schon aus, bevor ihr Blasloch aus dem Wasser herausragt, so dass Wasser mit hochspritzt, aber ihre Fontäne besteht z.T. auch aus Schleim, der in den Atemwegen sitzt und mit ausgestoßen wird.
Der Meereszoologe und Walforscher Boris Culik vom Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel erwähnt ferner, dass eine gehörige Portion Wasser auch der Atemluft selbst entspringt: Im Körper des Wals hat die Luft eine Temperatur von 37 Grad. Sie ist mit Feuchtigkeit gesättigt. Kommt sie beim Ausatmen aus dem Nasenloch herausgeschossen, dehnt sich die Luft aus und kühlt ab. Dabei kondensiert der Wasserdampf augenblicklich zu kleinen Wassertröpfchen. Der feine Nebelstrahl unterscheidet sich von Walart zu Walart. Der Pottwal zum Beispiel atmet nicht senkrecht nach oben aus, sondern 45 Grad zu Seite. Walfänger und geübte Beobachter können die Meeressäuger schon von weitem an der Höhe und der Form ihrer Fontäne identifizieren.
Zu den geübtesten Beobachtern zählen die von der Waljagd lebenden Ureinwohner Kamtschatkas, Alaskas und der Aleuten, während die Zoologen lange Zeit nur fragmentarische Kenntnisse von den Walen besaßen und z.T. männliche und weibliche Wale als zwei Arten begriffen. Das änderte sich mit dem romantischen Dichter und Hüter des Herbariums im Berliner Botanischen Garten Adelbert von Chamisso und dessen 1824 veröffentlichte Abhandlung über Wale. Dazu schreibt die Literaturwissenschaftlerin Marie-Theres Federhofer – in den „siberian-studies“: „Chamisso verwendet darin die Kenntnisse einer Urbevölkerungsgruppe, und es gelingt ihm, dieses Wissen in die Ordnung eines europäischen Wissenschaftsverständnisses hinein- und weiter-zuvermitteln. Bereits im Titel seiner Schrift (Cetaceorum maris Kamtschatici imagines ab Aleutis e Ligno Fictas) weist Chamisso darauf hin, dass er sich hier des Wissens von Aleuten, also von Einheimischen bedient. Diese besuchte er während seiner Weltreise zweimal, in den Sommern 1816 und 1817. Chamissos Wissen über Wale ist mithin das Resultat von Übersetzungsprozessen: Das mündlich überlieferte Wissen der Aleuten wird in eine europäische Form der Wissenspräsentation übersetzt, sie werden verschriftlicht und einem europäischen Denkstil, der zoologischen Systematik, angepasst...Im historischen Rückblick berührt es schmerzlich, dass sich Chamisso ausgerechnet zu einem Zeitpunkt ernsthaft mit den Kenntnissen der Aleuten auseinandersetzte, als diese brutal von russischen Pelzhändlern unterdrückt und versklavt wurden.“ Und gleichzeitig die Wale durch europäische und amerikanische Walfänger fast ausgerottet wurden. Sie bejagten die Wale im Ochotskischen Meer und in der Bering-See so exzessiv, dass die von diesen Tieren lebende und alle Teile verwertende Bevölkerung Kamtschatkas (Itelmenen, Korjaken, Ewenen, Aleuten) Hunger litt. Heute gehören nur noch 2,5 % der Bevölkerung zu den Ureinwohnern Kamtschatkas.
Im Prinzip hat sich wenig geändert – wie ein nordamerikanischer Indianer einem Ethnologen erklärte: „Unsere Vorfahren haben die Tiere geheiratet, sie haben ihre Lebensweise kennengelernt, und sie haben diese Kenntnisse von Generation zu Generation weitergegeben. Die Weißen schreiben alles in ein Buch, um es nicht zu vergessen.“
3a. Aufschreiben:
Ein Junge meinte: „Moby Dick – ist das nicht ‚Amerikka‘: der Leviathan oder Behemoth... Den ein fanatischer Verrückter à la Obama bin Laden zur Strecke bringen wollte?“ „Aber nein,“ antwortete seine kleine Schwester und lachte: „So heißt doch der kleine dicke Junge aus der Adalbertstraße, mit dem bin ich im Kinderladen gewesen.“ Man sieht, die Moby-Dick-Rezeption ist noch weit davon entfernt, sich auf einen Nenner bringen zu lassen. In einer solchen Situation hilft es, sich wieder auf den Urtext – den Roman von Herman Melville – zu besinnen. Dort heißt der Verrückte „Kapitän Ahab“. Und so hieß dann auch eine kleine Caféhaus-Kette in Kalifornien, weil deren Besitzer meinte, wie Gregory Peck auszusehen. Sein zunächst expandierendes Unternehmen wurde aber von Käptn Ahabs Gegenspieler auf dem Walfängerschiff, dem vernünftigen Steuermann Starbuck, d.h. von der „Starbucks Coffee Company“, in den Konkurs getrieben. Inzwischen beweisen weltweit Millionen zufriedene Starbucks-Kunden täglich, dass die Jagd auf den weißen Wal weiter geht – auf vernünftige Weise. Und dass Melville ein großartiger US-Autor ist. Der Berliner Büchertisch in der Gneisenaustrasse hatte kürzlich sein Schaufenster mit allen deutschen Ausgaben des Romans Moby Dick seit 1927 und aus Ost- und Westdeutschland dekoriert. Zwischendrin hat man etwas verschämt einen Bildband von Walschützern aufgestellt.
„So lange wie es KZs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben,“ hatte der Pariser Anthropologe Claude Lévi-Strauss einst gemeint. Seitdem gibt es mehr Wal- und Delphinschützer auf der Welt als Wale und Delphine. Insbesondere die Schwertwale und die Delphine werden heute weniger gejagt und getötet als „artgerechten“ Intelligenz- und Kommunikations-Tests unterworfen. Im Endeffekt kam dabei bereits heraus, dass für sie – ebenso wie für die höheren Affen – eigentlich längst die Menschenrechte gelten müßten.
Auf der Internetseite der Universität Weimar findet sich der Eintrag: „Heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal nicht nur als herausragender Beitrag zur Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung des 19. Jhds., die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt.“ Genannt werden:
„Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der Versicherung und Technik, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung; Fragen nach den Gegensätzen von Staat und Wirtschaft, von Land und Meer, von Universalismus und Partikularismus, von Macht und Norm, von Geld und Moral.“
An der Uni Weimar traf sich seit 2006 jährlich eine zwölfköpfige Gruppe von Kulturwissenschaftlern – mit dem Ziel, „jedes der 135 Kapitel von ‚Moby Dick‘ samt der Paratexte zu kommentieren. Das Projekt eines ‚historisch-spekulativen‘ Gesamtkommentars fragt dabei nach den Gründen für die enorme Bedeutung von ‚Moby Dick‘ für die Selbstbeschreibungen unserer Kultur und nach den Ambiguitäten und der Zerrissenheit des Symbols in Form eines weißen Wals, den es in allen sieben Weltmeeren zu jagen gilt.“ Heraus kam dabei jetzt eine 135 Texte lange Serie der Vierteljahreszeitschrift des Fischer-Verlags „Neue Rundschau“, in der das Weimarer Autorenkollektiv jede Menge neue Fakten um die Fiktion „Moby Dick“ anhäuft.
.
Wale (Photo: Spektrum.de
.
.
4. Der Götterbaum, auch Baum des Himmels genannt
Der chinesische Götterbaum (Ailanthus altissima) dürfte inzwischen der in Berlin verbreiteste Laubbaum sein. 250 Jahre lang hat man vergeblich versucht, ihn hier heimisch werden zu lassen. Lenné pflanzte ihn ins Palmenhaus auf der Pfaueninsel. Wenn sein Stamm astlos ist, ähnelt der Götterbaum mit seiner Krone aus Fiederblättern einer Palme. Man nennt ihn auch „Ghettopalme“.
Erst 1945 – als Berlin in Schutt und Asche lag – fing der Götterbaum an, sich hier zu vermehren – und wie. Nach dem Mauerfall hat seine Berliner Population noch einmal enorm zugelegt. Das Götterbäumchen wächst aus Spalten zwischen Gehsteig und Mauerwerk und kommt listig zwischen Hecken hoch. Fast kann man sagen, es breitet sich heimlich aus: eine „gelbe Gefahr“, inzwischen zählt man Ailanthus zu den „100 schlimmsten invasiven Arten“. Ich sehe ihn nicht so. Es ist noch nicht lange her, dass ich ihn identifiziert habe. In Ulrich Gutmairs Buch über die Nachwendezeit: „Die ersten Tage von Berlin“ geht es u.a. um den amerikanischen Essigbaum (Rhus typhina – ein Strauchgewächs), das sich in Berlin ausbreitet. Die Indianer haben einst aus seiner inneren Rinde eine hellgelbe Farbe für ihre Kriegsbemalung gewonnen. Mich haben dagegen Heiderose Häsler und Iduna Wünschmann in ihrem Buch über „Berliner Pflanzen“ für den chinesischen Götterbaum begeistert, auf den ich nun an allen Ecken und Enden stoße. Und seitdem behaupte ich, Gutmairs Sumachgewächs Essigbaum ist in Wahrheit ein Götterbaum – ein Laubbaum und kein Strauch. Desungeachtet sehen sie sich ähnlich und sind auch gleich vermehrungsfreudig. Die Gärtner raten, sie nur in Betoneinfassungen auszupflanzen. Der anspruchslose und widerstandsfähige Götterbaum breitet sich unterirdisch aus, bis zu drei Meter im Jahr, daneben aber auch durch Samen. Dazu braucht es mindestens zwei Götterbäume, denn sie sind getrenntgeschlechtig. Um aus dem Zierbaum eine Nutzpflanze zu machen, führte man in Wien einst neben dem Götterbaum auch den Götterbaum-Spinner ein: ein schöner brauner Nachtfalter aus China, der an den Flügelenden eine schlangenaugenähnliche Zeichnung hat. Seine Raupen leben von Götterbaumblättern. Nach ihrer Verpuppung läßt sich aus ihrem Kokon eine Seide – die sogenannte „Eri-Seide“ – herstellen: haltbarer und billiger als die übliche, laut Häsler und Wünschmann.
Als Schmetterling (Imago) ist er seinem Götterbaum auch freiwillig nach Europa gefolgt. Man kann sagen: der Götterbaum und der Ailanthus-Spinner leben in einer engen Beziehung, auch wenn letzterer nicht zur Befruchtung der Baumblüten beiträgt, sondern nur seine Raupen sich von den Blättern ernähren läßt, die seine einzige Nahrung bilden, denn als Imago nimmt er keine Nahrung mehr zu sich. Man kann deswegen noch weiter gehen und sagen: Dieser Falter ist eine Ausweitung des vom Tageslicht lebenden Götterbaums in die nächtliche Luft...Ein Spaß, den der Baum sich etliche Blätter kosten läßt.
Kein Spaß sind dagegen die Feldzüge gegen den Götterbaum und damit gegen den Götterbaum-Spinner. Der Invasionsbiologe Ingo Kowarik schreibt: „Seine Bekämpfung hat im Mittelmeerraum bereits hohe Kosten verursacht. Als wirksame Methode zu seiner Vernichtung erwies sich, den Baum zu fällen und die Austriebe mit Glyphosat (Monsanto) zu behandeln. In den USA setzt man den Rüsselkäfer Eucryptorrhynchus brandti ein, um ihn biologisch zu bekämpfen.“
.
Leserbrief:
Ihren Schlußsatz hat nicht der Berliner Invasionsbiologe Ingo Kowarik gesagt, sondern die unbekannte Wikipedia-Autorin des Eintrags „Götterbaum“. Professor Kowarik kommt darin zwar zu Wort, jedoch mit einer Vermutung, warum dieser Baum erst ab 1945 vermehrt in Erscheinung trat: Vor 1945 waren offene Flächen verhältnismäßig selten und diese wurden zu intensiv gepflegt, um den Aufbau einer spontanen Population zu ermöglichen. Dies würde auch erklären, warum der Götterbaum seine Vermehrung nach 1989 noch einmal forcieren konnte: Jedoch nicht, wie Sie nahe legen, weil die Mauer fiel, sondern weil etwa zur selben Zeit der Neoliberalismus derart griff, dass z.B. in den Gartenbauämtern der Bezirke nur noch ein Zehntel der Belegschaft übrig blieb, mitunter nur noch drei Leute, die für alles Fremdfirmen beauftragen, die dann schlechtbezahlte, mißmutige und unbedarfte Hilfskräfte die Arbei machen lassen. In anderen Worten: Die Grünanlagen, an denen die Stadt reich ist, werden nicht mehr „intensiv gepflegt“, sie verwildern, was dem Öko-Zeitgeist entgegenkommt, da man von „naturbelassen“ spricht und sich über „Langgraswiesen“ freut. Auch Sie haben z.B. mal eine Lobeshymne auf eine völlig verwilderte Brachfläche bei Karow-Nord veröffentlicht. Neoliberalismus das heißt auch Gentrifizierung – und damit Ghettobildung, also ein adäquates Umfeld für die „Ghettopalme“. Was Sie bei dem Götterbaum nicht erwähnen, ist, obwohl es Ihnen angeblich an einer gesteigerten Aufmerksamkeit für diese Pflanze nicht fehlt, dass der Widerstand der Bürger gegen ihn zunimmt: Immer öfter greifen sie heimlich zur Axt. Und am nächsten Tag gibt es wieder einen Götterbaum weniger. So geschehen bei dem wirklich hübsch palmenartig gewachsenen Götterbaum in der Grünanlage der Jugendkunstschule Pankow. An der Wendeschleife der Straßenbahn am Mauerpark wurden die Äste der Götterbäume sogar einfach nur abgeknickt. Und die taz, die wegen ihres Neubaus, der acht Eschen weichen sollen, Ärger mit einer Baumschützer-Initiative in der Nachbarschaft bekam, entschärfte den Streit, indem es erst mal die Götterbäume an der anderen Grundstücksseite fällen ließ.
Joachim Steinke, stud.bio.
.
Junger Götterbaum am Straßenrand (Photo: Wikimedia-Commons)
.
.
5. Die griechische „Tiertragödie“ – und wie ihr begegnet wird
Homer besang sie noch, die fleißigen Holzfäller, die Arkadiens Wälder für den Schiffsbau vernichteten. Aber schon 400 Jahre später beklagte Platon in seinem Fragment gebliebenen „Kritias“ die Folgen – Erosion und Humusschwund: „Übriggeblieben sind nun im Vergleich zu einst nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fort geflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb.“
Mit den griechischen See-Eroberungen verschwanden die Wälder und mit den Wäldern die Tiere. Mit diesen, vor allem aber mit der türkischen Vereinahmung des Landes um 1460, verschwanden dann auch die Griechen selbst, wenn man dem italienischen Religionshistoriker Francesco Carotta glauben darf: Für ihn ist Griechenland noch heute türkisiert, ersichtlich schon an der Schafskultur. Die Griechen betrieben Rinderzucht – und opferten ihren Göttern mitunter bis zu 5000 Rinder auf einmal. Die Schafzucht – das ist sozusagen die letzte Fruchtfolge eines ausgebeuteten Landes: Danach kommt nur noch Bau-Erwartungsland und Tourismus.
Also: An Tieren gibt es heute in Griechenland sehr viele Schafe, eine Menge Ziegen, einige wenige Esel, und ganz viele verwilderte Hunde und Katzen. Bis in die Siebzigerjahre konnte man in allen deutschen Tierhandlungen auch noch griechische Landschildkröten für ein paar Mark kaufen. Elias Canetti berichtete, dass in England schon vor dem Ersten Weltkrieg alle Kinder eine griechische Landschildkröte hatten. Sie wurden zumeist als Kinderzimmerkompromiß eingesetzt: Die Kinder wollten unbedingt einen jungen Hund – und die Eltern erlaubten ihnen dann gnädigerweise eine pflegeleichte Schildkröte – mit der Folge: „Die Zerstörung ihrer angestammten griechischen Lebensräume und ihre Beliebtheit als Haustier haben den Schildkrötenbestand inzwischen stark gefährdet und Schutzmaßnahmen für ihren langfristigen Erhalt unabdingbar werden lassen,“ schreibt eine Tierschutzoreganisation. Eine andere – griechische – behauptet dagegen und generell: „Griechenland ist reich an Tierarten.“ Den Autoren fallen dann aber an Land nur „Eidechsen, Bienen, Hummeln, Libellen und Heuschrecken“ ein, vor denen sie quasi warnen: „Man muss sich daran gewöhnen, dass die Insekten in südlichen Ländern wesentlich größer sind als im Norden. Sie wirken mitunter schon ein wenig beängstigend.“ Im Gegensatz zu den 125 Schmetterlingsarten, die es dort noch geben soll – vor allem im berühmten „Tal der Schmetterlinge“ auf Rhodos. Bei den Eidechsen unterscheidet man, ebenso wie bei den Schlangen, noch mehrere in Griechenland lebende Arten, auf Samos soll es sogar das eine oder andere Chamäleon geben. Außerdem leben in Griechenland mehrere Fledermausarten.
Wo Schafe sind gibt es auch Geier, in Griechenland gleich mehrere Arten. Der Steinadler heißt dort kretischer Goldadler. Auf Lesbos will man Seidenreiher und Flamingos gesehen haben.
Im Wasser sind ebenfalls, wie es heißt, „viele Tierarten zu Hause, was auch für die gute Wasserqualität spricht. Krebse, Einsiedlerkrebse und Fische flüchten, trotzdem ist Vorsicht angesagt, gerade wenn Seegras die Sicht versperrt. An Felsen und Steinen im Wasser sind oft Seeigel zu finden. Die Stacheln sind Mörderisch...“ Wieder eine Warnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es mit den Fischen in den griechischen Gewässern nicht mehr weit her ist. Ein Bekannter wurde dort im letzten Jahr dennoch oder deswegen von einer Muräne gebissen. Freude machte ihm dafür der Anblick zweier Delphine.
Aber bleiben wir an Land: In den Resten der Wälder Nordgriechenlands soll es angeblich noch einige Wildkatzen, Luchse, Wölfe und Marder geben. Im Westen, entlang der albanischen Grenze, Braunbären und im Süden neben Wildziegen noch Schakale.
Darüberhinaus gibt es auf Kreta einige endemische Arten wie die Kretische Wildziege (Kri-Kri), die Kreta-Stachelmaus und den kretischen Dachs. Früher war Kreta ein „Vogelparadies“, die meisten waren allerdings Zugvögel, die dort nur Rast machten. Heinz Sielmann, Deutschlands bekanntester Tierfilmer und einer der wichtigsten Pioniere seines Genres, begann seine Film-Karriere auf der „Insel der Glückseligen“, wie Homer Kreta nannte. 1944 kam er dort als Unteroffizier hin, durfte jedoch gleich im Auftrag des Reichsjagdamtes mit dem Filmen von Bartgeiern und Bezoarziegen in den Bergen beginnen. Auf diese Weise bekam er angeblich nichts von der starken kretischen Partisanenbewegung und den Geiselerschießungen der Deutschen mit, die die Insel 1941 erobert hatten. Ebensowenig dann von den Kreta zurückerobernden Engländern, die ihn mitsamt seiner Ausrüstung gefangen nahmen, nach London verfrachteten und ihm befahlen, sein Filmmaterial bei der BBC zu schneiden. 1947 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. Weil seine drei Kreta-Filme so gut angekommen waren, bekam er gleich eine Anstellung bei der British Film Division. Von dort ließ er sich an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) nach Hamburg versetzen, wo er dann für den damals noch englischen NDR Naturfilme drehte – und dabei reich und berühmt wurde.
Die Sielmann-Biographen Clemens und Köhncke schreiben: „Bei einem Projekt über Spechte leistete er Pionierarbeit beim manipulativen Filmen des Inneren von Spechtbauten durch Auftrennen des Baumes und Einfügen einer Glaswand. Sein daraus entstandener Film ‚Woodpecker‘ übertraf bei seiner Ausstrahlung durch die BBC 1954 sogar die Einschaltquoten der Fußballweltmeisterschaft in Bern.“ Sechs Jahre zuvor hatte er bereits mit großem Erfolg seinen ersten „Naturtonfilm“ – „Lied der Wildbahn“ in deutschen Kinos gezeigt. 1960 fuhr er auf der Yacht des Unterwasserfilmers Hans Hass zu den Galapagos-Inseln, wo er u.a. Galapagosfinken filmte. Der Kinofilm „Galapagos“ war Sielmanns erste Eigenproduktion, weitere folgten. In den Siebzigerjahren übertraf er mit seinen TV-„Expeditionen ins Tierreich“ den Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek an Beliebtheit. Ab 1982 drehte Sielmann vor allem Filme über die letzten Tierparadiese in Europa – Kreta bzw. Griechenland war nicht mehr dabei.
2010 wurde in Athen ein „Rotbuch der bedrohten Arten in Griechenland“ vorgestellt. Darin wurden mehrere hundert der fast tausend untersuchten Tierarten als vom Aussterben bedroht gelistet. Der Schutz dieser Artenvielfalt sei genauso wichtig wie der des archäologischen Vermächtnisses des Landes, erklärte S. Giokas von der Griechischen Zoologischen Gesellschaft anlässlich der Vorstellung des Rotbuchs. Zu den am meisten bedrohten Tieren gehören die Süßwasserfische, bei denen 37 der untersuchten Arten als bedroht gelistet wurden. Ähnlich sieht es bei den Vögeln aus. Von 422 in Griechenland lebenden Vogelarten konnten für 122 Arten ausreichende Daten gesammelt werden. Mit dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte, 62 Arten – vor allem Wasser- und Raubvögel, bedroht sind. Gefährdet sind auch mehrere Delphinarten, die Mittelmeer-Mönchsrobbe ist sogar kurz davor auszusterben. Für diese Misere ist die griechische Ökonomie verantwortlich, denn, wie die taz schrieb, „Wilderei, industrielle Landwirtschaft, Überfischung, Städtebau und die Verschmutzung von Wasser und Grundwasser tragen zur Vernichtung der Arten bei“.
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ (laut Hölderlins „Patmos“-Hymne) – und deswegen sind dann auch in Griechenland die deutschen Tierschützer besonders stark vertreten: Allerdings helfen sie dort nicht den vom Untergang bedrohten Arten, sondern im Gegenteil, den unter ihnen wildernden Hunden, die, ähnlich wie in der Türkei, von ihren Besitzern verstoßen, verletzt und verkrüppelt wurden. Dazu heißt es auf einer Internetseite: „Griechische Hunde (und natürlich auch Katzen) haben den gleichen Stellenwert, den wir in Deutschland vielleicht gerade mal einer Ratte zugestehen würden. Sie fristen ein Dasein ohne Würde oder gar Liebe, werden oft nicht einmal angefasst, geschweige denn gestreichelt... Kurz gesagt: Sie werden geduldet solange sie zu irgend etwas zu gebrauchen sind! Als Arbeitsgerät oder Alarmanlage zum Beispiel. Werden die armen Tiere krank oder ist man ihnen einfach nur überdrüssig werden sie ‚entsorgt‘.“ Um solche Hunde kümmern sich die Tierschützer, u.a. indem sie diese nach Deutschland „in liebevolle Hände“ vermitteln. Weil das aber ein schlechtes Licht auf die Griechen wirft, die ja nicht zuletzt von deutschen Touristen leben, verhängte der griechische Staat ein „Ausfuhrverbot“. Die Deutschen reagierten 2015 mit einer Petition, in der es u.a. heißt: „Griechenland be- und verhindert zur Zeit massiv die Ausreise von Hunden. Hetzerische Verleumdungskampagnen über die angeblich furchtbarsten Schicksale, die das vermittelte Tier am Zielort erwartet, werden großflächig gestreut. Unter anderem wird in den griechischen Medien behauptet, die Tiere würden in Versuchslabore geschickt, in der Fleischindustrie verarbeitet und in Bordellen missbraucht. Dieses Ausreiseverbot hat katastrophale Auswirkungen auf die notleidenden Streuner. Absurderweise blüht gleichzeitig der illegale Handel mit Haustieren und anderen Tieren in Griechenland. Tausende reinrassiger Tiere werden aus dem Ausland mit falschen oder fehlenden Dokumenten nach Griechenland eingeführt. Unzählige illegale Züchter vermehren unter schlimmsten Bedingungen Tiere aller Rassen. Hunderte von Anzeigen für den Verkauf dieser Tiere sind täglich im Internet zu finden.“ Also – wie einst Byron: auf nach Griechenland! „Unsere Tierärzte gehen nicht nur der Tiere wegen nach Griechenland, sie lehren auch den Griechen durch ihr Beispiel, dass der Mensch gegenüber dem Tier verantwortlich ist. Eine Entwicklungshilfe des Herzens,“ schreibt ein engagierter Veterinär im Forum „sms.at“ – unter dem Stichwort „Eulen nach Athen“.
.
Leserbrief:
Hallo,
der dümmste Artikel, der nur so von Fehlern strotzt, den ich je über Griechenland gelesen habe.
( Ich arbeite seit 50 Jahren mit griechischen Naturschützern zusammen)
Helmut Opitz
NABU-Vizepräsident
Am Tretenbach 11
D-77960 Seelbach
Tel. (+49) (0) 7823 649
Mobil (+49( (0) 173 93 58 93 2
Fax (+49) (0) 7823 5603
www.NABU.de
Die Adresse und die Nummern gelten auch für :
Fachschaft für Ornithologie Südlicher Oberrhein im NABU. e.V.www.fosor.de
Der NABU ist ein Mitgliederverband. Helfen Sie die Natur zu schützen, werden Sie jetzt Mitglied.
NABU – Nature and Biodiversity Conservation Union is the German partner of BirdLife International which is a global allianceof conservation organisations working in more than 100 countries. www.birdlife.org
.
Blinder Schäferhund
.
Hund in Pawlows Labor
.
Hundedenkmal (Russland)
.
Griechin mit deutschen Pudeln
.
Hunde-Denkmal (USA)
.
.
6. Flora und Fauna am Engelbecken
„2006 kam Prinz Georg Friedrich von Preußen, um sich einen Eindruck über die Probleme bei der Sanierung des Kanals zu verschaffen.“ (Webpage des Hauses Hohenzollern)
Wie erwähnt hatte der ursprünglich in Mitte gegründete Bürgerverein Luisenstadt die Bürgerbeteiligung bei der Rekonstruktion des Grünstrangs zwischen Urbanhafen und Engelbecken an sich gerissen
(siehe taz vom 12. 2. 08).
Er veranlasste, dass daraus ein original grün überdachter Korso wurde, ließ Bäume fällen und das Engelbecken mit Sandsteinquadern einfassen. Außerdem wurden noch zwei mal acht Fontänen im See installiert. Bevor dazu das Wasser abgepumpt wurde, hatte sich bereits eine vielfältige Flora und Fauna dort angesiedelt. Erwähnt sei insbesondere eine Rohrdommel: Obwohl der Schilfbewuchs am Ufer so dürftig war, dass mancherorts nur drei Halme dastanden, verstand sie es, sich zwischen ihnen nahezu unsichtbar zu machen. Der Biologe Cord Riechelmann war einer der wenigen, der sie dennoch entdeckte; er verriet ihr Nest jedoch niemandem.
Die Verschönerungsarbeiter machten das Schilf dann jedoch ringsum nieder. Nur vor der Seeveranda des Cafés am Engelbecken sind in diesem Jahr wieder einige Pflanzen nachgewachsen. Dort befindet sich nun auch die einzige Stelle, an der die Tiere im Wasser, so sie möchten, an Land gehen können – sieht man einmal von einem Entenhäuschen ab, das vor zwei Monaten im See verankert wurde. Von wem, weiß man nicht, denn die Bürgerinitiative hat man bei der Umgestaltung der zwei Grünzüge und des Engelbeckens ausgebremst.
Der oben erwähnte taz-Artikel rief sowohl die Baumschützer vom Landwehrkanal als auch etliche Anwohner auf den Plan, der Bezirksbürgermeister stoppte alle weiteren „Investitionen“. Die 16 Fontänen wurden jedoch nicht abgestellt; ihr Lärm geht nach wie vor den Spaziergängern auf die Nerven. Zumal niemand einsieht, warum aus Kostengründen so viele Brunnenfontänen abgestellt wurden, dann jedoch ausgerechnet in Kreuzberg 16 neue installiert wurden.
Andere, wie die Russin Tamara Ernst, lassen sich durch die Fontänen nicht davon abhalten, weiterhin die Enten zu füttern – um diese Jahreszeit fast ausschließlich weibliche Tiere. Tamara Ernst hatte 2003 im Lotto gespielt und dabei sechs Richtige gehabt. So glaubte sie jedenfalls, aber auf ihrem Quittungsschein standen ganz andere Zahlen. Sie meint, dies wäre durch den unsauberen Scanner im Lottoladen geschehen, der die Zahlen auf ihrem Schein falsch abgelesen hätte. Viele ähnliche Scanfehler in anderen Lottoannahmestellen schienen ihr Recht zu geben. Die „West-Lotto“ wechselte deswegen sogar alle Computer-Terminals aus. Die Berliner Lottogesellschaft war sich jedoch keiner Schuld bewusst und zeigte Tamara Ernst wegen Betrugs an
(siehe taz vom 17. 8. 05).
Ein Gericht bestätigte diesen Verdacht, indem sie ihn von Experten erhärten ließ. Tamara Ernst ging in Berufung. Aber sie verlor. Dennoch geht Tamara Ernst weiter täglich zum Entenfüttern an das Engelbecken, nebenbei arbeitet sie als Dolmetscherin – auf 1-Euro-Basis – in einem Migrantenbetreuungsprojekt.
Wieder andere haben es auf die mindestens zwei Wasserschildkröten abgesehen, die seit Jahren im Engelbecken leben. Diese haben sowohl das Ablassen des Wassers als auch die vielen Enten überstanden, die sie immer wieder gerne mit dem Schnabel nach unten drücken, wenn sie an die Wasseroberfläche kommen. Die Schildkröten sind wahrscheinlich froh, dass die Verschönerungsmaßnahmen wenigstens die Reiher und die Schwäne vertrieben haben. Bisher hat es auch noch kein Mensch geschafft, sie zu fangen und in seinem Terrarium zuhause zu reprivatisieren.
Die Wasserschildkröten fressen dasselbe wie die Enten. In einem diesbezüglichen Netzforum heißt es: „Es könnte so einfach sein: Man geht in den Zoohandel und kauft eine Dose Schildkrötenfutter. Die meisten Produkte sind laut Hersteller für so ziemlich alle Arten geeignet. Doch so ist es leider nicht. Schildkröten sind durchaus anspruchsvoll, was die Fütterung angeht. Abwechslungsreiche Fütterung ist oberstes Gebot!“ Dafür sorgen die Wasserschildkröten im Engelbecken selbst.
Anders ist es mit den Spatzen, die dort besonders viel hermachen. Es sind jetzt meistens die jungen mit noch etwas Flaum auf Rücken und Bauch. Sie lernen gerade, den Besuchern der Café-Terrasse und den Sonnenblumenkernekauern am Ufer
Leserbrief:
Lieber Helmut,
am 26.8. habe ich mit viel Interesse deinen Artikel über das Engelbecken gelesen, ich wohne ja in der Nähe, trank, als noch der Schwan dort brütete und alles noch schön und „wild“ aussah, gern einen Kaffee und erinnerte mich an ein Gespräch mit dir, dass dort eine Rohrdommel gebrütet haben soll. Da habe ich ja seinerzeit sehr heftig widersprochen, aber du bestandest strikt darauf.
Zwar habe ich nicht Biologie, sondern Kunst studiert, bin aber seit jüngsten Jahren ein obsessiver Vogelbeobachter- und -kenner und konnte mir partout nicht vorstellen, diesen extrem seltenen Vogel (ich glaube, es gibt ca. 600 Paare in ganz Deutschland) überhört zu haben, übersehen natürlich schon, da er sehr versteckt lebt – allerdings nur in sehr breiten Schilfgürteln in extrem ruhigen Gegenden. Beides trifft auf das Engelbecken überhaupt nicht zu und ich bin mir sicher, dass Cord – falls er ihn denn mit eigenen Augen gesehen haben will – einen Fischreiher bzw. Graureiher mit einer Rohrdommel verwechselt hat. Denn den nicht besonders seltenen Fischreiher sah ich dort des öfteren in zwei Ex. – allerdings nicht brütend, er nistet auf Bäumen. Also, eine brütende Rohrdommel im Engelbecken muss meiner Ansicht nach zu 99% eine Fata Morgana, eine Elfe oder eine (Zukunfts)vision sein.
Um also Gewissheit zu bekommen, fragte ich nach deinem Text nach beim Spezialisten für die genaue jährliche, systematische Bestandsaufnahme der Brutvögel in Berlin, Herrn Prof. Dr. Böhner, ob es denn wirklich möglich sei und erhalte die Antwort, dass „nach allem was ich weiß, sind Rohrdommeln zur Brutzeit, oder gar eine Brut, in der Berliner Innenstadt nie nachgewiesen worden.“ In den Randzonen der Stadt zb. Flughafensee hätte man mal die Rufe von Männchen vernommen, aber keine Brut festgestellt. Man solle zwar nie etwas völlig ausschließen, aber auch in den Auswertungen der Berliner ornithologischen AG bis in das Jahr 2006 gebe es solche Beobachtung nicht. Auch Böhner glaubt also in diesem Fall eher an eine Verwechslung des extrem scheuen Vogels, „vielleicht mit einem Graureiher“.
Nun habe ich in der Vergangenheit einmal Cord Riechelmann selbst um eine fachspezifische Information gebeten, als ich für mare den Text über das Säugetierpenismuseum verfasste. Ich bat um Verifikation seiner Ausage über die spezielle Verankerung des Walpenis im Körper. Der Satz wurde wortwörtlich, wie bestätigt, gedruckt und hatte den Leserbrief einer Biologin an mare zur Folge, die den Artikel wohl mochte, aber genau diese beiden Zeilen als „völlig absurd“ bezeichnete, ein spezieller Muskel, der den Penis halte, sei ja zu schön um wahr zu sein, eine Männerphantasie, meinte die Dame spöttisch und da Cord bei weiterer Nachfrage strikt auf die Richtigkeit seiner damaligen Aussage beharrte, fragte ich ihn, ob die Leserbriefschreiberin mit ihm direkt telefonieren könne, ein Streitgespräch unter Fachleuten, ich wäre da überfragt. Zwar weiß ich nicht, was aus dem Gespräch unter Experten geworden ist, aber Cord willigte ein, mit der Dame telefonisch zu klären, ob Muskel oder was immer sonst das Walglied hält...;-) Eigentlich ist mir das ja egal, aber in diesem Fall gabs einen der doch insgesamt seltenen Leserbriefe. Die kommen ja meist dann, wenn jemand einen „Fehler“ bemerkt zu haben glaubt.
Gut, das Penis-Muskelstück war eher eine Fachdiskussion, aber bei der Rohrdommel fühle ich mich denn doch berufen zu sagen, dass die Info, die du verbreitest, mindestens zu 99% nicht richtig ist. Persönlich hätte ich natürlich überhaupt nichts gegen Rohrdommeln in meinen Kiez, im Gegenteil – und vielleicht schaffen die es auch irgendwann wie Wildschwein, Fuchs und Falke die Stadt zu erobern, aber bisher gibt es nur eine Behauptung, deren Herkunft ausschließlich dein Gewährsmann mit unbekannter Quelle ist. Ich würde mich aber freuen, die Rufe des Vogels hier zu vernehmen, zukünftig auch Eisvögel und Störche im Engelbecken zu füttern und lasse mich gern überzeugen, wenn ich unrecht habe,
herzliche Grüße
Wolfgang
Wolfgang MüllerWaldemarstr. 48D- 10997 BerlinTel.: +49- 30 – 614 42 34wm@die-toedliche-doris.dehttp://www.wolfgangmueller.nethttp://www.die-toedliche-doris.de
.
Rohrdommel (Photo: wildvogelhilfe.org)
.
.
7. Affentheater
Der Kardinal Melchior de Polignac soll zu dem im Jardin du Roi erstmalig gezeigten Orang-Utan gesagt haben: „Sprich – und ich taufe Dich!“ Die indigene Dayakbevölkerung auf Borneo behauptet, dass diese von ihnen „Waldmenschen“ genannten Affen nicht sprechen, weil sie sonst arbeiten müssten. Auch 300 Jahre nach dieser Taufofferte geht es darum, unsere nächsten Verwandten zum Sprechen zu bringen. Große Fortschritte brachte diesbezüglich die Einführung der amerikanischen Gebärdensprache ASL in den „Mensch-Affen-Dialog“. Dabei handelte es sich durchweg um in Gefangenschaft lebende Tiere. Bei frei lebenden erwiesen sich zum Einen die Frauen unter den Verhaltensforschern als erfolgreicher, wobei die zweite Forschergeneration sich feministisch inspirierte, und zum Anderen mußten sie erst einmal umgekehrt die „Affensprache“ lernen.
„Derjenige, der den Pavian versteht, würde mehr zur Metaphysik beitragen als Locke,“ meinte Charles Darwin 1838. Die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum brauchte Jahrzehnte mit einem geduldeten Aufenthalt unter Pavianen in Kenia, um sie einigermaßen zu verstehen. Auf einem Kongreß berichtete sie, dass in ihren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen sind sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das „wirklich nett“ – nicht zuletzt deswegen, „weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der ‚Nettigkeit’...Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.“
Hoffen wir nun, 18 Jahre später, dass die wie immer semiamerikanisierte Veranstaltung und Ausstellung im Haus der Kulturen: „Ape Culture / Kultur der Affen“ uns Neues über diesen zwischenartlichen „Dialog“ bringt, der wohl so lange anhalten wird, bis der letzte Affe tot ist. Die vier Menschenaffen Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse, Bonobo sind bereits gefährdete Arten. Man darf nicht vergessen, dass sie eigentlich nie was mit uns zu tun haben wollten – im Gegensatz zu Hunden z.B.. D.h. wenn sie etwa in einer durchschnittlichen amerikanischen Akademikerfamilie aufwachsen, mit Messer und Gabel essen lernen, sich Drinks selbst mixen können, vorm Fernseher Illustrierte durchblättern usw., dann ist spätestens mit der Pubertät Schluß – und der langsam gefährlich werdende Affe wird in einen Zoo oder ein Versuchslabor abgeschoben. Man kann solche zivilisierten Affen nicht auswildern, „weil das so wäre, als würde man ein zehnjähriges amerikanisches Mädchen nackt und hungrig in der Wildnis aussetzen und ihm verkünden, es werde jetzt zu seinen natürlichen Wurzeln zurückkehren,“ wie die Schimpansenforscherin Jane Goodall sich einmal über ein derartiges Ansinnen empörte. Außerdem sind die unter Menschen aufgewachsenen Affen nicht mehr scheu, im Gegenteil, so dass sie jedem Affenjäger/-wilderer freudig entgegengehen.
In der Ape-Ausstellung des HKW wird eine Reihe künstlerische Arbeiten und Dokumente gezeigt, „die das Verhältnis des Menschen zu den anderen Primaten betrachten“. Dazu gehört auch die berühmte Dokumentation „Primate“ von Frederick Wiseman über das „Yerkes Primate Research Center“ in Atlanta. Anschließend möchte man alle dort arbeitenden Weißkittel kaltblütig erschießen. Einmal suchte der Verhaltensforscher Roger Fouts nach einer Unterbringung für seine schwangere Schimpansin „Washoe“, die sehr gut ASL sprach und gut Englisch verstand, dabei sah er sich auch in dem Affenforschungszentrum um; in seiner „Washoe“-Biographie schrieb er: „Wenn Yerkes human war, wollte ich nicht wissen, was ein inhumanes Labor war.“ Es geht aber immer noch widerlicher: 2012 erteilte z.B. das Europäische Patentamt (EPA) der US Firma Altor ein Patent auf einen genveränderten Schimpansen – für Medikamenten-Tests. Über den „Dialog zwischen „Empathie und Objektivierung“ wird im HKW ein Künstlergespräch mit Marcus Coates und eine Performance von Ines Doujak geboten. Den State of Science erfahren wir dann von Christophe Boesch, der das Affenforschungslabor in Leipzig leitet, vom „Viadrina“-Kulturwissenschaftler Klaus Weber und dem französischen Philosophen Cord Riechelmann.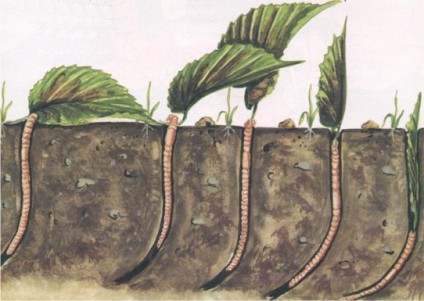
Affenforschung
.
Affenforscherin
.
Malender Affe (gemalt von Gabriel von Max)
.
.
8. „Occupy Biology!“
Diese Parole haben sich all jene zu eigen gemacht, die mit Lebewesen Gen-Experimente machen – zu Hause in ihrer Küche. Man nennt sie auch „Biohacker“. In Kalifornien gelang es z.B. zweien, das Darmbakterium E.coli so zu manipulieren, dass es bei seiner Teilung ein Lied mitvererbt: Sie kodierten den Text des Liedes „It’s a small world“ in DNA-Sequenzen, die sie in das Erbgut der Bakterien einschleusten. Jeder Buchstabe wurde über eine spezifische Abfolge von DNA-Basen kodiert. So erklärten die beiden ihr Werk, mit dem sie in die Weltpresse kamen.
Aber „Occupy Biology“, das heißt gar nicht, jeder kann nun Gen-Experimente machen (es gibt dafür inzwischen preisgünstige „Werkzeugkisten“ und Wettbewerbe sowie „Summerschools“ an den Unis). Die „Occupy“-Bewegung drang ja auch nicht darauf, an die Wallstreet-Computer und -Logarithmen rangelassen zu werden. Sie kämpfte nicht für den „Zugang“ (Passwords). Übrigens „geschehen“ auch die ganzen Gen-Experimente vor allem auf den Bildschirmen von Rechnern.
„Occupy Biology“, das kann im Gegenteil nur heißen, dem ganzen gentechnisch ausgerichteten Neodarwinismus als „Leitwissenschaft“ die Deutungshoheit zu entwinden. Halb wurde das bereits mit dem Konzept der „Epigenetik“ versucht, insofern diese experimentell abgesichert davon ausging, dass gewisse Umwelteinflüsse sich doch vererben, ohne genetische Spuren zu hinterlassen. Ebenso vorsichtig hatten zuvor schon russische Symbioseforscher (am Beispiel von Flechten) und dann um 1900 der Anarchist Kropotkin mit seinem Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ den Darwinschen „Kampf ums Dasein“ als Entwicklungsgesetz der Arten relativiert. In Rußland hielt man das „Konkurrenz“-Prinzip für englisches Insel- und Händlerdenken, das in der russischen Weite keine Gültigkeit habe. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte vor allem in Wien eine regelrechte Forschungswelle ein, die – oft in Arbeiterbildungseinrichtungen – „Genossenschaften in der Natur“ thematisierte. Aber schon in den Biologieseminaren an den DDR-Unis war dann selbst das Wort „Symbiose“ verpönt. Im Westen galten die kleinen Gruppen um die US-Mikrobiologin Lynn Margulis, die bei den Bakterien unverdrossen weitere Kooperationen suchten und fanden, als Abweichler. Aber mit der wachsenden Kritik am Neoliberalismus bekam dann nicht nur die Genossenschafts- bzw. Allmendeforscherin Elinor Ostrom als erste Frau einen (Wirtschafts-) Nobelpreis. Unter den Biologen in Ost und West, mindestens unter den Verhaltensforschern, kam gleichzeitig auch das Thema „Altruismus“ auf. Zwar gab es einige geharnischte Darwinisten, die alle beobachteten Beispiele – u.a. aus der Vogelwelt – sogleich zu einem darwinregelkonformen „Egoismus“ uminterpretierten, aber das waren vielleicht schon Rückzugsgefechte. Denn inzwischen macht es nicht nur die Unterwasser-Aufnahmetechnik und die Sequenziertechnik in den Labors möglich, ganze Lebensgemeinschaften und ihre miteinander sowie mit Bakterien verbundenen Stoffwechselprozesse quasi auf einmal zu analysieren. Man spricht dabei von „Holobionten“ und denkt dabei z.B. an den Mensch und seine Milliarden Bakterien, Pilze, Protisten in und an ihm und um ihn herum, ohne die er nicht leben kann, so dass man von einem „Individuum“ schlechterdings nicht mehr reden kann. Im biologischen Sinne gibt es kein Einzelwesen (mehr). Auch dieses Forschungskonzept ist nicht so neu, wie es sich ausgibt und ist zudem bereits in der „Ökologie“ angelegt. Als der Biologe Ernst Haeckel diesen Begriff 1866 „erfand“, stand es für die Erforschung der „Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können.“ Haeckel arbeitete selbst jedoch am Wenigsten ökologisch, denn er fing, untersuchte und zeichnete vor allem marine Kleinstlebewesen, u.a. „Radiolarien“, von denen er über 100 erstentdeckte – und benamte. Daran ist eher etwas Antiökologisches, insofern er „seine“ Meerestiere isolierte – und unter dem Mirkoskop „zu Tode kuckte,“ – wie er sagte, aber er brauchte unbedingt eine Professur, mithin ein regelmäßiges Gehalt, weil er seine Verlobte heiraten wollte. 1877 prägte der Biogeograph Karl August Möbius das Wort „Biozönose“. Darunter faßte er „eine Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich gegenseitig bedingen...“ Und Möbius meinte es ernst damit: Er erforschte die Lebewesen an und auf den Austernbänken an der deutschen Küste, wobei er prüfen sollte, ob man dort wie an der französischen Westküste künstliche Austernzuchten anlegen könnte – was er dann in seiner Schrift „Austern und Austernwirtschaft“ verneinte. Die Austernbänke ließen sich laut Möbius aufgrund der Bodenbeschaffenheit der Nord- und Ostsee nicht ausweiten. Ironischerweise haben sich heute die an Stelle der 1968 ausgerotteten Nordsee-Austern eingeführten US-Austern derart munter vermehrt, dass sie bereits die hiesigen Miesmuschelbänke überwuchern.
Erwähnt sei ferner, dass es sich schon bei den Verhaltensforschern, die erstmalig ganze Affengruppen beobachteten (und nicht bloß das stärkste Männchen und seine Rivalen), um Feministinnen handelte. Noch viel mehr jetzt bei der Erforschung der „Holobionten“. Für die Leiterin der Abteilung „Symbiose“ im Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen, Nicole Dubilier ist das kein Zufall: „Ist doch klar, es geht um Kooperation.“
Als Begründer der „Mikrobiologe“ gilt jedoch ein Mann: der Berliner Ökologe Christian Gottfried Ehrenberg. Er entdeckte 1848, dass sogar der Grund und Boden, auf dem Berlin steht, „aus diesen winzigen hartschaligen Tierchen besteht.“ Gemeint waren damit „Infusorien“ – amöbenähnliche sog. „Aufgußtierchen“. Die Berliner Hausbesitzer wollten daraufhin entsetzt wissen, ob damit nicht die Gefahr bestünde, dass sich ihre Häuser davonbewegen könnten. Ehrenberg beruhigte sie: „Das tun die so vorsichtig, dass Sie nicht begreifen, warum Ihr Haus eines Morgens an der Elbe steht.“
Leserbrief:
Sehr geehrter Herr Höge,
Sie wollen doch wohl nicht im Ernst behaupten, dass die maritime Mikrobiologie eine Domäne der Frauen ist. Dieser Eindruck ist doch rein der Ideologie des Gender-Mainstreaming geschuldet. Es ist doch vielmehr so: Wenn jetzt eben die hochdotierten Stellen von Quotenfrauen belegt sind, dann fehlen die noch höher qualifizierten Männer, die diese sich zur Paarung aussuchen müssten. Das heißt, die hochqualifizierten Möchtegernalphaweibchen sterben alle kinderlos aus. Es ist immerhin ein riesiges Glück, dass natürlich gebliebene, normal gebliebene Frauen noch immer das evolutionäre Erbe in sich tragen und sich den Alphamännchen zuwenden. Und sie sind die absolute Mehrheit, die von ihnen zitierten Frauen sind gewissermaßen biologische Ausreißer. So was hat es immer gegeben.
Hochachtungsvoll
Klaus-Dieter Heitkamp
.
Die Mikrobiologin Lynn Margulis in ihrem Labor
.
.
9. Spatzenkriege
Obwohl der Sperling als Singvogel offiziell ebenso geschützt ist wie die auch nicht gerade wegen ihres Gesangs berühmte Krähe, verschwindet er langsam aus den Städten, weil renovierte Häuser und Neubauten ihm keine Nistmöglichkeiten mehr bieten. Schon einmal, mit der Abschaffung der Pferde, litten die Spatzen plötzlich schwere Not. Dafür bürgerte man sie in Australien und Nordamerika, auf Java und Neuseeland ein, wie der Spatzenfreund Alfred Brehm schrieb. Auf Helgoland wurde die Brutpopulation durch den Zweiten Weltkrieg und die Evakuierung der Bevölkerung ausgelöscht, mit dem Wiederaufbau und der Rückkehr der Helgoländer kamen jedoch auch die Spatzen wieder auf die Insel: keine 24 Stunden später.
In früheren Zeiten hat man immer wieder versucht, sie ein für alle mal zu vernichten. In Preußen vor allem während der Trockenlegung des Oderbruchs und anderer Feuchtgebiete ab dem 18.Jahrhundert: Mit der Verwandlung von Sümpfen in Siedlungsland ging stets der Kampf gegen Schädlinge – vom Wolf über die Malariamücke und den Biber bis zu den Spatzen – einher. Der König von Preußen setzte Prämien dafür aus: Zwischen 1734 und 1767 wurden allein in den Grenzen der Alten Mark Brandenburg fast 12 Millionen Spatzen getötet.
Unter Maria Theresia tat es Österreich den Preußen nach – und begann ebenfalls einen Vernichtungsfeldzug gegen die Spatzen, die fortan als die allergrößten „Getreideschädlinge“ galten. Jedes Haus im Flachland hatte fortan fünf Spatzen-Köpfe jährlich abzuliefern und jedes Haus im Gebirge mindestens drei. Bei Unterschreitung des Abgabesolls an Köpfen drohten Geldbußen. 1761, im zwölften Jahr der Aktion, wurde das Soll landesweit um 22.200 unterschritten – indem 12.955 Spatzenköpfe abgeliefert wurden. Etwa gleichzeitig kamen Kochbücher auf den Markt – mit Rezepten zur Zubereitung von Spatzen und anderen Kleinvögeln. Der Linzer Historiker Georg Wacha hat ausgerechnet, dass der 14 Jahre dauernden Schädlingsbekämpfungsaktion in Österreich etwa 200.000 Spatzen zum Opfer fielen. Etwas anders sah es im damals noch autonomen Salzburger Land aus, wo bis zur Französischen Revolution das Fangen oder Schießen von Wildtieren und -vögeln, ausdrücklich auch von Spatzen, der Obrigkeit vorbehalten war und folglich als Wilderei galt.
1958 kam es im Rahmen des „Großen Sprungs nach vorne“ in China zu einer Hygienekampagne, die eine Ausrottung der „vier Übel“ – Ratten, Spatzen, Fliegen und Moskitos – zum Ziele hatte. Das Nachrichtenmagazin der ARD berichtete rückblickend: „Mao Tse tung will Ernteausfälle bekämpfen und ruft zum Krieg gegen die Schuldigen auf, die angeblich zu viel Getreide vertilgen. Zum Krieg gegen den Spatz! 600 Millionen Chinesen müssen gegen den gefiederten Volksfeind antreten. Sie veranstalten einen infernalischen Lärm, um die sensiblen Vögel so zu ängstigen, dass sie so lange in der Luft umherschwirren bis sie schließlich erschöpft oder tot zu Boden fallen. Am Ende haben die Chinesen an die zwei Milliarden Tiere erschlagen“. Weiter behauptete die ARD: „Aber Maos Spatzenkrieg gerät zum Desaster: Die Ernteausfälle steigen dramatisch an, eine große Hungersnot beginnt. Kein Wunder: Fressen doch Spatzen sehr gerne Getreideschädlinge! China muss nun Spatzen importieren – ausgerechnet vom ungeliebten Nachbarn Russland. Für Mao eine Riesen-Blamage. Bis heute aber ist der Spatz in China rar geblieben“. Dafür tourt der Chor „Die Ulmer Spatzen“ nun durch China!
Das mit dem Spatzenimport aus der UDSSR ist natürlich Unsinn. Es wurde 2014 von Frank Dikötter, einem in Hongkong lehrenden Antimaoisten, korrigiert. Zwar stimme es: „Mao verlor seinen Krieg gegen die Natur“, aber die „Opfer dieses Feldzugs“ waren die Menschen, denn von ihren Freßfeinden befreit verschlangen daraufhin die Heuschrecken Millionen Tonnen Getreide. Mao ließ sogar Getreide aufkaufen – mit der Begründung: „Wir lassen besser die Hälfte der Menschen sterben, damit die andere Hälfte genug zu essen hat.“ Und so geschah es dann angeblich auch. Laut Dikötter verhungerten 60 Millionen Menschen. Es will mit seinen Berechnungen die von Mao verursachte „Große Hungersnot“ ebenso bekannt machen wie die beiden vorangegangenen Großkatastrophen „Holocaust und Gulag“, meint der indische Schriftsteller Pankaj Mishra (in seinem neuen Buch über China und seine Nachbarn). Der Westen will da aber nicht so richtig mitziehen, weil er diese große Hungersnot schon in der Ukraine unter Stalin untergebracht hat – und sogar ein neues Wort dafür kreiert hat: „Holodomor“.
.
Leserbrief:
Na na,machen Sie sich da etwa noch schnell über die große ukrainische Hungersnot lustig?! Igor, Spandau
.
Junge Spatzen (kunstkreis- friedrichsdorf.de)
.
.
10. Zierfische Etikettieren
Es ist nicht uninteressant , zu kucken, wie Meeresbiologen und solche, die sich dafür hielten, bei ihren teuren und aufwendigen Exkursionen/Expeditionen zu tropischen Korallenriffen das Wissen fischten. Z.B. Ernst Haeckel (in Messina, Algerien, Ceylon), John Steinbeck (im Golf von Kalifornien), Irenäus Eibl-Eibesfeldt/mit Hans Haas (Malediven, Galapagos) und Jacques-Yves Cousteau (Malediven, Seychellen, Madagaskar)...Erst einmal angelten oder kescherten sie die Meerestiere, tauchten auch nach ihnen – harpunierten sie dann...photographierten bzw. filmten sie aber auch bald, mikroskopierten und zeichneten sie. Gleichzeitig engagierten sie jedoch auch Fischer bzw. „Enheimische“ und Jugendliche, die für sie gegen geringe Bezahlung alle möglichen Tiere sammelten, während sie mit dem wissenschaftlichen Bestimmen der letzten Fänge beschäftigt waren. Es kamen wahre Mengen zusammen – fast alle „Objekte“ waren bereits tot, bis auf die wenigen, die das Fangen überstanden hatten und in Glasgefäßen mit frischem Meereswasser noch so lange lebten, bis auch sie dran waren – unters Messer oder Mikroskop zu kommen. Bei der Bestimmung der Art (oder ist es nur eine Varietät, die laut Darwin erst eine Art werden soll?) braucht es den bisherigen Erkenntnisstand über sie. Wenn dann zweifelsfrei feststeht, dass sie bisher unbenamt im Meer lebte (höchstens den Einheimischen unter seltsamen Bezeichnungen bekannt, die man ignorieren konnte), bekam sie einen Namen, oft auch noch mit dem Orts- oder Schiffsnamen verbunden. Dabei wurde nicht selten ein Individuum für seine ganze Art genommen. Danach kam das Exemplar in ein Glas mit Spiritus und da drauf ein Etikett.
„All labelling is lethal!“ – jedenfalls für das betreffende Meerestier. Darwin hat bei seinen Galapagosfinken sogar die „Museumsetiketten“ selbst geschrieben – die noch heute im British Museum an den Füßen der Tiere hängen. Darwins „Vertreter“ in Deutschland, Ernst Haeckel, prägte zwar den Begriff „Ökologie“ 1868 (zur Erforschung der „Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können“), er selbst forschte jedoch so gut wie gar nicht in diese Richtung, sondern konzentrierte sich vielmehr als Physiologe und Künstler auf die Farben und Formen der Einzeltiere, die er isolierte und unter dem Mikroskop zu bestimmen versuchte, wobei er 101 neue Arten entdeckte – allein bei den Radiolarien (Strahlentierchen).
Um das Gegenteil bemüht sich die österreichische Fischverhaltensforscherin Ellen Thaler, die zeigen will, „dass bei all dem umfassenden Wissen über Technik und Systematik allzu oft etwas Wesentliches auf der Strecke bleibt: nämlich die Koralle, der Krebs hier, die Muschel dort und schon gar der Fisch, das Individuum also, an dem wir unsere helle Freude haben sollten!“ Dazu wurde sie sowohl Aquarianerin als auch Taucherin. Über ihre Verhaltensforschung unter Wasser vor den Malediven schrieb sie das Buch „Die Stunde des Chamäleons“. Es geht ihr darin um das komplexe Sozialverhalten von Riffbewohnern. Aber auch in ihren kleinen Riff-Aquarien zu Hause will sie „Verhalten sehen, ein Eckchen möglichst echter Ökologie im Minilebensraum.“ Zuletzt – 2004 – gab sie eine Ausgabe der Aquarianer-Zeitschrift „Koralle“ über „Doktorfische im Meerwasseraquarium“ heraus.
Der Leipziger Zoologe Günther Sterba blieb zwar Hobby-Aquarianer, aber seine Bücher über Aquariumsfische erreichten Millionenauflagen. Über ihre Benamung schrieb er: „Die Aquaristik wäre gut beraten, wenn sie nicht jede Namensänderung sofort aufgreifen, sondern abwarten würde, ob die Änderung allgemeine Anerkennung findet.“ Sein Biograph Klaus Breitfeld meint in einem Artikel auf der Internetseite des Aquariumsvereins „Nymphaea Leipzig“, dass Sterba wesentlich mit dazu beitrug, „dass die Aquaristik einen eigenen wissenschaftlich fruchtbaren Arbeitsstil entwickelt hat, durch den die Kluft zwischen aquaristischer und wissenschaftlicher Ichthyologie weitgehend beseitigt wird.“ Sterba schrieb u.a. eine Monographie über die Entwicklung einer bis dahin unbekannten Doppeltier-Art: ein parasitischer Meereswurm, der nur als Pärchen vorkommt, wobei die zwei Individuen kreuzweise verwachsen sind. Mehrere Fischarten wurden nach ihm benannt.
Leserbrief:
An die taz
Hiermit schicke ich Ihnen eine Illustration des Doppeltiers, damit man weiß, was die Natur sich da wieder geleistet hat [siehe unten]. Im übrigen darf ich Ihnen als Ostler sagen, dass Ihr Autor längst nicht alle Verdienste unseres ehemaligen DDR-Fischdoktors Sterba erwähnt hat, schade.
Ingeborg Dreher, Wismar
.
.
.
11. Naßforsche Mitforscher
Die Mitforscherbewegung – „Citizen Science“ – kommt aus Amerika, wo man überhaupt viel mehr als bei uns tut, um Forschungsergebnisse zu popularisieren. Als die Beziehungen zwischen den USA und der UDSSR mit Reagan und Thatcher langsam „vereisten“, entstand in Kalifornien zunächst eine „Citizen Diplomacy“ (Bürgerdiplomatie), die Beziehungen und Projekte zwischen den Bürgern beider Länder entwickelte – von unten also. Bei „Citizen Science“ geht es meist um Wissenschaftsprojekte, die wegen ihres z.B. flächenmäßigen Umfangs nicht von Professionellen allein bewältigt werden können. Es ist eine neue Art von „Big Science“. Die „The Trumpeter Swan Society“ z.B. kümmert sich seit 40 Jahren um Trompeterschwäne, u. a. indem sie die Tiere zwecks Identifikation „beringt“. Sie waren in den USA beinahe ausgerottet worden: 1937 gab es nur noch 73 Exemplare. In den letzten 10 Wintern sind jedoch laut TTSS wieder mehr als 2200 Trompeterschwäne an Bleivergiftung gestorben, weil sie auf ihren Rastplätzen Schrotkugeln verschluckten. Da sich die mit Jagdblei verseuchten Gebiete ausdehnen, bittet die „Trumpeter Swan Society“ um Unterstützung durch „Citizen Scientists“. Die Zoologen der Universität Melbourne wollten Genaueres über das Paarverhalten von Trauerschwänen wissen. Dazu untersuchten sie einige Jahre lang 250 von ihnen gekennzeichnete Vögel im „Albert Park Lake“. Heraus kam dabei: Eins von 20 Paaren trennt sich nach einiger Zeit wieder, unabhängig davon ist ihr Hang zur Untreue groß (etwa 15% aller jungen Schwäne werden unehelich geboren). Um weitere Erkenntnisse über die „Trauerschwäne“ zu gewinnen, bat das Trauerschwan-Forschungsprojekt um die Mitarbeit der Bevölkerung. Die schwarzen Schwäne führen ein weitgehend nomadisches Leben, damit man ihre Wege und Aufenthalte mindestens im Bundesstaat Victoria kennt, braucht das australische Projekt („myswan.org.au“) möglichst viele „Citizen Scientists“.
.
Am großen US-Projekt „eBird“ beteiligen sich bereits fünf Millionen „Birdwatcher“ weltweit, indem sie ihre Beobachtungen dort veröffentlichen. In Deutschland gibt es ein ähnliches Internetprojekt: „naturgucker.de“, zu dem bis jetzt 16.000 Menschen fast 5 Millionen Beobachtungen und 350.000 Naturbilder beisteuerten. Bei dem einen wie bei dem anderen „Citizen Science“-Projekt geht man von „etwa 2% unbrauchbaren Daten“ aus. „Ein solches Modell ist leistungsfähiger als jeder personengebundene Ansatz,“ versichert einer der NABU-Geschäftsführer – Stefan Munzinger. Und der Ökologe Josef Reichholf meint in seinem neuen Buch „Ornis“, dass man nicht Biologie studiert haben muß, um sich als Ornithologe zu betätigen. In den von Heiko Werning redigierten Zeitschriften Draco, Reptilia und Terraria, ebenso in dem im selben Verlag erscheinenden Aquarianer-Magazin „Koralle“ publizieren schon seit langem Fachleute und Amateure. Ohne die Laien, von denen nicht wenige tausende von Stunden vor ihren Fischbecken verbringen, sähen die Ichthyologen alt aus.
.
Der Wissenssoziologe Bruno Latour spricht von „Mitforschern“, die wir alle werden müssen. Nicht, weil die Wissenschaft sonst nicht vorankommt, sondern im Gegenteil: Weil die Wissenschafts- und Technik-Experimente längst über das Labor hinausgewachsen sind und uns alle mit einbezogen haben. Wir haben also bloß noch die Alternative, Forschungssubjekt oder -objekt zu sein. Wobei Latour mit seinem „Parlament der Dinge“ so weit geht, dass er sagt, auch z.B. die o.e. Trauer- und Trompeterschwäne sowie Heiko Wernings Reptilien und Amphibien und die von den „Koralle“-Autoren thematisierten Aquarientiere und -pflanzen müssen an den Verhandlungen beteiligt werden.
.
Es ist absurderweise noch nicht lange her, da wurden alle Nichtwissenschaftler aus der Forschung gedrängt: In den Botanischen Gärten nahmen z.B. die Gärtner keine eigenen Pflanzungen mehr vor, in den Diskussionen der Verhaltensforscher wurden die Tierpfleger nicht mehr beteiligt und heilkundigen Laien wurde von den Ärzten das Praktizieren verboten. Aber dann entstand mit der antiautoritären Studentenbewegung, mit „Jugend forscht“ und den „Genialen Dilletanten“ eine Gegenbewegung. Und so werden in manchen Kreuzberger Kneipen nun z.B. Dialoge wie der folgende geführt: „Machen wir noch eine Bierforschung oder eine Nachhausegehforschung?“ „Ich muß erst mal eine Dönerforschung machen.“ Inzwischen spricht schon jeder Künstler, wenn er auch bloß 10 Holzlatten zusammengenagelt hat, wie selbstverständlich von „Materialforschung“.
Lesermail:
Lieber Autor,
das war ich, der damals den Forschungsbegriff in Dimitris Fischbüro derart „stretchte“. Und an dem von dir zitierten Dialog war Susanne Barkomi beteiligt. Wir machten uns damit über die ganzen Künstler lustig, die ständig von Forschung reden. Das sagst du aber nicht, sondern schiebst diesen unseren Gedanken auf deine Seite...Na ja, ich überlaß ihn dir. Gruß Anke Weihmeier
.
.
.
.
.
12. Totila – Was nun?
Paul Schokemöhle, der einst zusammen mit Josef Neckermann „für Deutschland“ ritt, ist ein Münsterländer Eier-Großhändler, der ein nach ihm benanntes Gestüt besitzt und eine nach ihm benannte Spedition, die er mit dem Spruch bewirbt: „Schlüsselbegriffe wie ‚Just-in-time‘ oder ‚Outsourcing‘ stehen dabei im Vordergrund.“ Jetzt hat er seinen für 10 Millionen Euro gekauften Hengst „Totilo“ outgesourct; in dem Sinne, „dass sich der Hengst zurückzieht,“ wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, die uns jedoch beruhigt: „Schockemöhle kann das finanziell verschmerzen.“ Gleichzeitig erinnert die SZ aber daran, dass der berühmte „Springreiter“ als „Ausbilder und Geschäftsmann“ zwei Mal „vor Gericht“ stand: wegen Tierquälerei und Steuerhinterziehung.
Darum geht es aber gar nicht, sondern, ob Totila, der „Millionenhengst“, als „größter Tänzer der Dressur-Welt“ das alles verschmerzen kann? Man darf nicht vergessen, ein Pferdepfleger mit einer besonders feinen, zarten Hand hatte ihm bis vor kurzem noch täglich einen runtergeholt. Der aufgefangene Samen – gut für die Befruchtung von 200 Stuten in aller Welt – brachte Schockemöhle über 1,5 Millionen Euro jährlich ein. Die SZ spricht nun vom „Karriere-Aus“ des „Wunderpferds“ – wegen einer „mysteriösen Sport-Verletzung“: Aber deswegen kann der Hengst doch weiter Samen spenden! Auch mit einem verletzten Knie. Nein, kann er nicht: Das Geheimnis der Zoologie ist der Münsterländer Bauernadel – soll heißen: Die Pferdezüchter sind die größten Rassisten! Ein Verdacht, den bereits der schleswig-holsteinische Milchbauer Mathias Stührwoldt in einer taz-kolumne äußerte. Der Hengst muß permanent in „wichtigen Wettbewerben“ antanzen („Passion to Perform“ heißt dort sein Auftritt), weil seine Siege automatisch dem Samen zugute kommen, diesen quasi anreichern. Die Saudis waren immer ganz wild danach – obwohl „Darwin“ witzigerweise bei ihnen verboten ist.
Leserbriefe:
Lieber Höge,
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Pferdezüchterkreisen zu hören ist, soll aus Totila eine Tortilla werden. Edith Senker, Verden/Aller
.
An die taz:
Die „Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)“ in der Freiherr-von-Langen-Straße 13, 48231 Warendorf, beschreibt ihren Dumpfdarwinismus wie folgt – stolz: „In einem aufwändigen Zuchtwertschätzverfahren wird das genetische Vererbungspotenzial eines Hengstes anhand von Eigen- und Verwandtenleistung ermittelt. Im Herbst jeden Jahres werden die Integrierten Zuchtwerte für Deutschlands Hengste geschätzt. Die Qualität der genetischen Vererbung wird in einem Zuchtwert in den Disziplinen Dressur und Springen angegeben.“ Schockemöhle lag oft über Kreuz mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bzw dem „NRW Landgestüt“ in Warendorf, aber in dieser Hinsicht und sie sich einig: Die „Eigenleistungen“ gehen in die Ermittlung des „Zuchtwerts“ ein, nach diesem bemißt sich der Preis des Samens und danach der Versicherungswert des betreffenden Hengstes und die Aufmerksamkeit, die er in Münsterländischen Pferdeliebhaberkreisen und weit darüberhinaus „genießt“.
Die Stute aber, die mit seinem Samen befruchtet wird, dann das daraus resultierende Fohlen austrägt und bis zum „Absetzen“ pflegt, ist nur ein blödes Gefäß für in diesem Fall Totilas Nachwuchs – ein lebendes Transportmittel, das ihn auf den Markt bringt. Ins globale Warendorf! Die dortige Freiherr-von-Langen-Strasse ist übrigens nach dem SA-Sturmbannführer Carl-Friedrich von Langen benannt, der sich laut Wikipedia „ernergisch für eine Überführung der ländlichen Reit- und Fahrvereine in die SA einsetzte“. Der Rittmeister und Gutsbesitzer aus Parow bei Stralsung „begann 1920 eine sportliche Karriere. Acht Jahre später gewann er bei den ersten Olympischen Spielen, an denen Deutschland wieder teilnehmen durfte, zwei Goldmedaillen in der Dressur (Einzel und Mannschaft). Die Nazis verfilmten sein Leben 1941 mit dem Titel ‚...reitet für Deutschland‘ als arisch-heroisches Rührstück; das 1944 vom Reichspropagandaminister Goebbels als Film von ’nationaler Bedeutung‘ eingestuft wurde. Freiherr von Langen starb an den Folgen eines Sturzes bei einem Military-Wettkampf in Döberitz,“ wo es seit der unseligen Wiedervereinigung mehr Pferde als Menschen gibt, weil die Westberliner Pferdebetriebe dort sofort hinzogen. Dallgow-Döberitz hat im übrigen eine wichtige „militärgeschichtliche Bedeutung. Die Errichtung des Truppenübungsplatzes Döberitz unter Kaiser Wilhelm II. in den Jahren 1892–1895 hat die Entwicklung und das heutige Erscheinungsbild des Ortes“ laut Wikipedia „nachhaltig geprägt. So ist zum Beispiel die Heerstraße, welche als heutige B5 von Dallgow-Döberitz bis in die Mitte von Berlin führt, bereits damals als Aufmarschstraße bis Dallgow-Döberitz ausgebaut worden. Das ehemalige Truppenübungsplatzgelände ist heute ein Naturschutzgebiet.“ einen Großteil hat die Heinz-Sielmann Stiftung gekauft, die dort vom Aussterben bedrohte Tiere, u.a. Przewalski-Pferde, einhegte.
Die Stiftung benutzt dabei teilweise Gebäude der ehemaligen sowjetischen „Löwen-Kaserne“, noch während ihres Abzugs aus Deutschland klaute die Bundeswehr ihnen ihr Löwendenkmal, das neben dem Haupteingang zu den Kasernen stand; der Kommandantur gelang es jedoch nach zähen Verhandlungen und Drohungen, den Löwen wieder ausgehändigt zu bekommen, er wurde von ihnen mit nach Russland genommen.
Das „Przewalski-Pferd“ ist die einzige Wildpferdeart, die in ihrer Wildform bis heute überlebt hat – allerdings nur in zoologischen Gärten und Freigehegen, von wo aus die Jungtiere in alle Welt gehen und z.T. „ausgewildert“ werden. Einige holländische Przewalski-Pferde haben z.B. in einem Nationalpark der Mongolei eine „stabile Herde“ inzwischen gebildet. Ich habe sie mir einmal angesehen – aus 100 Meter Entfernung von einem Hügel aus: Sie paßten gut in die Landschaft und wollten nicht bei ihrem Tun beobachtet werden, deswegen bewegten sie sich langsam außer Sichtweite. „Das internationale Zuchtbuch wird in Prag geführt,“ schreibt Wikipedia. Weiter heißt es dort: „Przewalski-Pferde sind Kulturflüchter, die sich auf Grund der Bejagung durch den Menschen sowie eine zunehmende Nahrungskonkurrenz mit Haustieren auf immer kargere Standorte zurückzogen. So entspricht die Dschungarei, in der [die letzten wild geborenen] Przewalski-Pferde zuletzt gesichtet wurden, mit ihrem kargen Nahrungsangebot und ihren wenigen Wasserstellen nicht einem optimalen Wildpferdhabitat. Auch in diesem Refugium wurden Przewalski-Pferde jedoch zunehmend bedrängt. So begannen mongolische Hirten in den 1960er Jahren während des Sommers in den Gebirgstälern des Tachin-Schara-Nuru ihre Herden zu weiden. Entsprechend mieden Wildpferde diese Region und hielten sich während des Sommers in der dschungarischen Gobi auf. Erst während des Winters wechseln sie in die Tachin-Schara-Nuru.“
Gruß Rheinfried Wiemann, Passau
.
12a. Das Karlshorster Festival des Pferderennfilms
In Berlin gibt es eine Galopprennbahn – in Hoppegarten, und zwei Trabrennbahnen: Einmal die im Jugendstil 1913 erbaute Mariendorfer Anlage, wo 800 Pferde untergebracht werden können. „Und wenn ick dann am Ma’Damm steh, und all die Pferde loofen seh, dann weeß ick, da jehör ick hin!“ heißt es in dem berühmten Berliner Koffer-Lied. Ihr erster Vorsitzender war für lange Zeit der Verleger und Galerist Bruno Cassirer: „Er sprach mit Leuten der Sportpresse, mit seinem Trainer und Fahrer, kaufte Heu und Hafer und nannte die auf Grund eines eigenen Stallhumors gebildeten Namen der Rennpferde mit derselben Sicherheit, mit der er soeben Namen moderner Künstler ausgesprochen hatte,“ schreibt der ehemalige taz-Feuilletonchef Harry Nutt, der einige Jahre die Traberzeitung des Vereins redigierte und daneben gerne auf Pferde wettete, weil, so versicherte er mir, dies die einzige Wette sei, bei der es nicht nur auf das Glück ankommt: „Wenn man Ahnung von den Pferden, Jockeys und Rennställen hat, hat man eine gute Chance.“
Seine ehemalige Kollegin Sabine Vogel jedoch, bar jeder Ahnung, verließ sich an einem der Renntage rein auf die Magie der Pferdenamen, die an den Start gingen – und gewann ein kleines Vermögen. Während wir anderen, die teilweise sogar schon dicke Bücher über einzelne Pferde veröffentlicht hatten, unser ganzes Geld verwetteten. Harry Nutt kam zur taz, weil er versucht hatte, gegen den seiner Meinung nach zu großen und geschäftsschädigenden Einfluß der Gestütsbesitzer in Mariendorf zu putschen – und dabei gescheitert war. In der taz ließ er u.a. die Doktorarbeit „Ökonomie des Glücksspielmarktes in der BRD“ von Norman Albers rezensieren. Der war nicht nur oft auf der Mariendorfer Trabrennbahn, sondern kam aus einer Buchmacherfamilie, die sich auf das einzige nicht-staatlich dominierte Glückspiel geworfen hatte: Pferdewetten. Diese waren durch die Landespferdezuchten legitimiert worden – und dienten damit quasi höheren Zielen. Inzwischen wurde der Sportwettenmarkt allerdings liberalisiert, wofür sich auch schon Norman Albers in seiner Dissertation ausgesprochen hatte. Generell kam noch hinzu, dass seit der Wirtschaftskrise Ende der Zwainzigerjahre gilt: Je mieser die Jobaussichten, desto mehr wird gewettet. Auf den Pferderennbahnen befindet sich dann auch ein – gerade für kritische Kulturschaffende – interessantes Milieu: seltsamerweise im Westen wie im Osten.
Die Karlshorster Trabrennbahn entstand vor 120 Jahren. Als der Charlottenburger Verein für Hindernisrennen ein neues Gelände suchte, machte ihm die Gemeinde Karlshorst das günstigste Grundstücksangebot, woraus dann eine „Galopprennbahn für Hindernis- oder Jagdrennen“ wurde. Sie war nach der Eroberung Berlins durch die Rote Armee (deren Kommandantur sich bis 1993 in Karlshorst einquartierte) eines der ersten Kulturangebote nach dem Krieg, das der Berlinkommandant Nikolai Bersarin wieder herrichten und eröffnen ließ, verbunden mit einer Freilichtbühne. Die Berliner quittierten das dankbar und in Massen – bis das Fernsehen kam, wie die Karlshorster Geschichtswerkstatt in ihrem Erzählkreis meint. Immerhin wurden auf der Trabrennbahn zu DDR-Zeiten noch etliche Beiträge für die Kinowochenschau „Der Augenzeuge“ gedreht, daneben einige sozialkritische Dokumentationen und ein „Polizeiruf 110“-Krimi.
.
Nach der Wende fiel die Trabrennbahn in den Besitz der Treuhandanstalt, die sie an den „Trabrennverein“ Mariendorf verpachtete, der fortan wöchentlich zwei Rennen im Osten und zwei im Westen veranstaltete. Das Geschäft lief aber nicht sonderlich, obwohl die Tribünenhalle auch an Tagen ohne Rennen besucht wurde: Mit der Liberalisierung des Sportwettenmarktes konnte man dort auf ein über Monitore übertragenes Rennen irgendwo auf der Welt wetten. 2004 sollte das Karlshorster Rennbahngelände verkauft werden. Dem mithilfe der Bezirksregierung gegründeten Verein „Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V.“ gelang es eine Hälfte des Grundstücks zu „retten“, d.h. zu erwerben, die andere wurde als Bauland für Einfamilienhäuser verkauft – wozu einige Stallgebäude, das Casino und die Reithalle abgerissen werden mußten. Dennoch gibt es jetzt wieder „Renntage“ – und die Wettumsätze steigen wieder. Außerdem kann man Mitbesitzer von einem oder mehreren Rennpferden werden.
Der Verein verfolgt daneben kulturelle Ziele: Es gab im (brandneuen) Karlshorster Kulturhaus bereits zwei Ausstellungen: Eine über den TÖLT – eine Gangart des Islandpferdes, wobei es hier um Design zu dem Thema ging. Eine andere thematisierte die isländische Literatur – parallel zur „Islandpferde-Weltmeisterschaft“, die auf der Trabrennbahn stattfand. Auf einer weitereren Großveranstaltung wurde dort der Film „Ben Hur“ nach gespielt: mit 30 römischen Kampfwagen, Legionären usw.. Das wichtigste Rennen im Jahr ist das „Bersarin-Erinnerungsrennen“, die meistbesuchteste Veranstaltung sind die „Deutsch-Russischen Festtage“. Ich gehe am Liebsten zum Tag des Hundes dorthin, wo sich dann über 200 Hunde mit ihren Frauchen auf der Anlage tummeln, und auch rennen – aber nur aus Spaß. (*)
.
Am 22.Mai 2014 wurde ein 1. Festival des Pferderennfilms in Karlshorst eröffnet. Es läuft länger als das in Cannes, wie der stellvertretende Bezirksbürgermeister und Vorsitzende des „Pferdesportparks“ betonte. Er entschuldigte sich im übrigen für das Manko, das nicht nur der Rennbahn, sondern allen Umgangsweisen mit Pferden eignet: „Leider können wir nicht die Pferde fragen, wie sie den Pferdesport in Karlshorst finden.“ Dafür hatte sein Verein eine kompetente Filmhistorikerin, Nele Saß, engagiert, die die Filme zusammenstellte.
Am ersten Abend erklärte sie uns das Prinzip ihrer Auswahl anhand von Szenen aus den Filmen, die dort bis zum 19.Juni gezeigt werden: Beim Genre „Pferderennfilm“, der am Anfang der Filmgeschichte stand (indem vor 120 Jahren Eadweard Muybridge ein galoppierendes Pferd mit Reiter aufnahm), unterschied Nele Saß sechs Themen:
.
1. das kriminelle Milieu: Wettbetrüger, Taschendiebe, Doping usw., sie zeigte dazu einen Film von Stanley Kubrick, in dem es um einen Überfall auf die Wettkasse geht.
2. Stories um Superrennpferde. Eins aus Neuseeland war so schnell, dass man es vergiftete, weil es mit seinen fortwährenden Siegen das Wettsystem kaputt machte. Ein anderes, das schnellste Rennnpferd aller Zeiten, „Seabiscuit“, spielte die Hauptrolle in dem 2004 für mehrere Oscars nominierten Film über ein Außenseiterpferd, dessen Siegrennen 1938 über 40 Millionen Amerikaner am Radio verfolgt hatten: „Seabiscuit – Mit dem Willen zum Erfolg“. Dieser Film lief im „Racing-Club“. In ihrem Vortrag zeigte Nele Saß Ausschnitte aus dem Kitschfilm „Secretariat – Ein Pferd wird zur Legende“ (1989), dabei geht es um die Nummer Zwei der besten amerikanischen Rennpferde, das ein drei mal so großes Herz wie normale Pferde hatte. In der Tribünenhalle zeigte Nele Saß ferner den Babelsberger Animationsfilm darüber: „Rising Hope“ von Milen Vitanov.
3. Pferdeschindereien, bei denen es jedoch um höhere Werte geht: um Männerfreundschaften. In der Studiobühne des Kulturhauses laufen zu diesem Thema zwei Filme von Francis Ford Coppola – über einen schwarzen Hengst, der im gläubigen arabischen Reitermilieu spielt. Ich hatte in den Fünfzigerjahren bereits die Verfilmung des deutschen Kinderbuchs „Der weiße Hengst“ gesehen. Darin geht es um die Flucht eines Sklavenjungen mit seinem Lieblingspferd aus dem Gestüt eines hartherzigen arabischen Scheichs. Die Geschichte endet damit, dass die beiden am Strand des Mittelmeeres keinen Ausweg mehr sehen – und ins Wasser gehen. Dorthin – wo Pferde und kleine Jungs glücklich sind. Ein frühes Mittelmeer-Flüchtlingsdrama, das ein kindgemäß-irreales Happy-End hat.
Nele Saß erwähnte die US-Fernsehserie „Luck“, in der es um Pferdesport und Glücksspiel geht: Die Serie wurde abgebrochen, nachdem drei Pferde bei Dreharbeiten tödlich verunglückt waren. Ähnliches geschah bei den Kampfwagen-Szenen in „Ben Hur“, hier starb überdies auch der Filmproduzent – vor Aufregung.
Das Gegenteil davon – 4: „Tierschutzfilme“. Dazu fand Nele Saß den russischen Spielfilm „Kleine Leidenschaften“ von Kira Muratova passend, in dem die zwei Protagonistinnen das Problem empirisch durchdiskutieren, „Was ist artgerechter für ein auf schnelle Bewegung angewiesenes Fluchttier wie das Pferd: Zirkus (Dressurreiten) oder Rennbahn?“ Ein weiterer Film zeigt einen kurzen Auftritt des sowjetischen Dichters und Sängers Wladimir Wyssozki, der in einem Lied sein Leben mit dem eines Rennpferdes vergleicht, dass sich zu Tode galoppiert. Und so geschah es ihm dann wenig später auch tatsächlich. Darüberhinaus hätte man sicher noch einige wissenschaftliche Pferde-Filme zeigen können: z.B. aus der Verhaltensforschung, aus der Pferdezuchtgeschichte, wo es um die Vererbung von Eigenschaften geht, und aus der Pferdedressur, bei der es um verschiedene Methoden geht. Die taz hatte dazu einmal einen Text von dem in Berlin lebenden Roland-Barthes-Assistenten Makoto Ozaki veröffentlicht. Zuletzt erschien von dem holländischen Autor Frank Westermann eine aufwendige Studie über die Spanische Hofreitschule in Wien: „Das Schicksal der weißen Pferde – Eine andere Geschichte des 20.Jahrhunderts“.
5. „Lokale Rennbahnereignisse“ – Hierzu zeigt Nele Saß zusammen mit der Geschichtswerkstatt Filmmaterial über die Karlshorster Rennbahn – aus 100 Jahren Wochenschauen. Die Westberliner Trabrennbahn steht zwar nicht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Gedächtnis“ von Otto Sander und Bruno Ganz, aber einige Szenen ihrer Begegnung mit den Schauspielern Curt Bois und Bernhard Minetti spielen dort.
6. „Sozialistischer und kapitalistischer Realismus“ – unter diesem „Thema“ wird eine Defa-Dokumentation von Petra Tschörtner vorgeführt, in der vor allem eine Rentnerin zu Wort kommt, die am Wettschalter der Karlshorster Rennbahn sitzt, um sich ein bißchen Geld dazu zu verdienen. Sie sagt – über die Sucher des „Schnellen Glücks“: „Reich ist hier noch niemand geworden. Das Geld bringen ja die Außenseiter.“ In einer weiteren Dokumentation „Sieg oder Platz“ porträtierte Tanja Hamilton von der Filmakademie Baden-Württemberg Trainer, Besitzer, Wetter und Besucher auf der Rennbahn in Karlshorst. Auch Petra Tschörtner hat einige Besucher gefragt, warum sie dort hingehen. Einer meinte: „Das Fludium gefällt.“
.
Anmerkung:
.
(*) Die Hunde-Veranstaltung auf der Karlshorster Trabrennbahn war auch „ein Tag für glückliche Hunde“. Gesponsort vom Hundenahrungshersteller „Happy Dog“ bot das von zwei Hundetrainerinnen organisierte „Event“ den Hunden und ihren Besitzern „Quality Time“. Es fand auf einer kurzen Rennstrecke und einem „Fun Agility“-Parcours statt, darüberhinaus konnten die Hunde sich an „Dog-Dancing“, „-Racing“, „-Casting“ und -Frisbee“ beteiligen. Etwa 200 Hunde waren erschienen – begleitet zumeist von Frauen, denen die Idee, ihrem Hund zuliebe eine Veranstaltung zu besuchen, anscheinend näher lag als den männlichen Hundebesitzern. Sie wurden mit Verkaufsständen und Sonderangeboten gelockt. Darunter waren welche von Hundeporträtisten, Hundefriseuren, „Tier-TV“, Pferdefleisch in Dosen, Tierspielzeug, Hundegeschirr („Arbeitskleidung“ genannt), ferner Tierschutzvereine, eine Tierschutzpartei, die „Tiertafel Deutschland“, Hundeschulen und -Pensionen, „Lebenshilfe für verwaiste Hunde“, eine „Vermittlung von behinderten Hunden“ sowie auch von ausrangierten „Versuchstieren“, einen Werbestand des „Berliner Tierfriedhofs“ und zweier neuer Zeitungen: „Der Ruhrstreuner“ und „Reich mir die Pfote“ (darin ein Artikel über „Hunde mit Beruf“) sowie des altehrwürdigen Tierschutzmagazins „Berliner Tierfreund“. Außerdem Informationsstände – u. a. mit Büchern wie „Hundekekse selbst gemacht“ von Andrea Packulat und „Hier schreibt der Mops“ von Uschi Ackermann, verfaßt in der Ich-Form ihres Hundes „Sir Henry“. Die Besitzerin hatte den allzu geschäftstüchtigen Züchter ihres Mops, den er ihr krank verkauft hatte, auf Schadensersatz verklagt – und gewonnen. In einem Flugblatt, das neben dem Buch lag, war von einigen weiteren Mops-Krankheiten infolge von Überzüchtung die Rede. Sie hatte sich deswegen bereits mit dem MPRV, dem „Mops-Pekinesen-Rassehund-Verband“, überworfen und war dem AMV, dem „Altdeutschen Mopsverband“, beigetreten. Diese knappe Aufzählung des Angebots auf dem „Event 4 Happy Dogs“ verdeutlicht bereits, dass der Hund nicht nur ein Begleittier oder Arbeitstier ist, sondern auch und vor allem ein (immer wichtiger werdender) Konsument – als „Familienhund“. Er bekommt dabei immer mehr Menschenrechte eingeräumt. Auf diese Weise werden sich Herr und Hund zunehmend ähnlicher – letzterer gleichzeitig auch medientauglicher: immer mehr Tiere verdienen ihr Geld beim Film – oder werden darauf hintrainiert. Auf diese Weise dreht sich die ökonomische Abhängigkeit des „Nomber-One“-Begleittiers vom Menschen gelegentlich schon ins Gegenteil. Im Grunde war der Hundetag in Karlshorst bereits eine einzige Auftrittsschulung – für beide „Partner“.
.
P.S.: Der „Event 4 Happy Dogs“ tourt gerade durch Deutschland. Und in Karlshorst setzte Nele Saß in diesem Sommer ihr „Festival des Rennbahnfilms“ fort. Diesmal ging es weniger um das Rennpferd, sondern um „Die Rennbahn – in Wochenschau und Film“. U.a. zeigte sie den gerade fertig gewordenen Spielfilm „Wanja“ von Carolina Hellsgård, den sie auf der Karlshorster Rennbahn drehte. Er handelt von einer Frau, die aus der Haft entlassen wurde und ihre ersten Schritte in das sogenannte normale Leben unternimmt. Schwerpunkt des Festivals waren Kriegswochenschauen aus den 40er Jahren, die alle mit einem Bericht von der – stets gut besuchten – Rennbahn Karlshorst endeten. Damals gab es an den Fronten auch noch eine Kavallerie. Die Karlshorster Rennbahn war so etwas wie ihre Heimatfront. Aber militärtechnisch war der Übergang von den Pferden zu den Kettenfahrzeugen längst vollzogen. Bereits im 1. Weltkrieg waren aus den schnellsten, den berittenen Truppenteilen, die langsamsten geworden. Mobilisierung war fortan Motorisierung, wie der damalige Major Guderian urteilte. Als im Frühjahr 1918 für die „Große Schlacht“ gegen die Franzosen 1 400 000 deutsche Soldaten an die Front transportiert werden sollten, „verlud man als Notlösung schließlich das langsamste Glied der Kette, die Pferde, auf Omnibusse: Je Division 445 Pferde auf 150 Omnibusse,“ wie der Medienwissenschaftlers Peter Berz schreibt. Von der Roten Armee wurden auch im zweiten Weltkrieg noch massenhaft Pferde eingesetzt: Allein die Mongolei stellte ihr tausende Pferde zur Verfügung – so wie davor den chinesischen Herrschern und heute den Japanern (als Hundefutter in Dosen). Die mongolischen Pferde waren zwar klein, aber genügsam und kälteunempfindlich. Viele gelangten bis nach Berlin. Nicht wenige Rotarmisten schrieben Briefe in die Mongolei, indem sie sich für die Tiere bedankten und diese lobten: Sie hätten sich besser bewährt als alle Beutepferde. Ihre Briefe befinden sich heute im Nationalmuseum von Ulaanbataar. In den „Kriegstagebüchern 1941-45“ des sowjetischen Kriegsberichterstatters Wassilij Grossman heißt es an einer Stelle: “Viele Panzersoldaten kommen aus der Kavallerie. Aber zweitens sind sie auch Artilleristen und drittens müssen sie etwas von Fahrzeugen verstehen. Von der Kavallerie haben sie die Tapferkeit, von der Artillerie die technische Kultur.” Der faschistische Frontberichterstatter Curzio Malaparte sprach von den weichen Händen der sibirischen Panzerfahrer, die jahrhundertelang Pferde gepflegt hatten – und nun Kettenfahrzeuge.
Von deutscher Seite gibt es einen im Selbstverlag veröffentlichten Bericht über ein Rehazentrum für die verwundeten und zerschundenen Pferde der Wehrmacht in der Ukraine – geschrieben von einem Soldaten, der dort als Pferdepfleger eingesetzt war. Ich muß ihn irgendwo zu Hause liegen haben.
.
„Der schwarze Hengst“, Teil 1, USA 1979, Regie: Carroll Ballard
.
Pferderücken (Photo: Katrin Eissing)
.
.
13. Guppy-Forschung I
„Poecilia reticulata“, besser bekannt unter dem Namen Guppys – zu Ehren ihres englischen Erforschers R.J.L. Guppy, sind kleine lebendgebärende Süßwasserfische aus der Karibik, die sich in Aquarien leicht züchten lassen. Sowohl professionelle Züchter als auch Anfänger widmen sich seit vielen Jahrzehnten den Guppys, und heute existiert eine überwältigende Fülle an Farben, Mustern und Formen. Daneben dienen sie den Biologen als beliebte „Modellorganismen“ – und werden in der Entwicklungsbiologie, der Ökologie, der Verhaltensforschung, der Genetik, der Krebs- und der Fischereiforschung eingesetzt. Das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie berichtete: „Bunte Guppy-Männchen haben die besten Chancen bei der Fortpflanzung“ – auch bei der Selektion durch Aquarianer, die es bunt lieben, möchte man hinzufügen.
Englische Fischforscher beschäftigten sich mit der „sexuelle Belästigung“ von Guppyweibchen: „Wenn sich diese aus dem Weg gehen, untereinander bekämpfen und ‚rumzicken‘, sind die Männchen daran nicht unschuldig: Indem sie die Weibchen sexuell bedrängen, verändert sich das Sozialverhalten der Weibchen untereinander“, berichteten die Wissenschaftler in den ‚Biology Letters‘.“ Bei einer mit den Guppys verwandten Art – Poecilia mexicana – entscheidet sich das Weibchen angesichts zweier kämpfender Männchen anschließend eher für das „Verlierermännchen“, wie die Fischforscher David Bierbach und Martin Plath von der Goethe-Universität Frankfurt herausfanden. Besonders attraktiv fänden die Weibchen, homosexuelles Verhalten von Männchen. Wahrscheinlich, weil sie von diesen anschließend ebenfalls weniger aggressiv bedrängt werden.
.
Zwei Auricher Gymnasiasten, Trebesch und Broers, erforschten wild lebende Guppys auf Trinidad, indem sie einzelne Tiere markierten. Dabei fanden sie heraus: Je mehr ihr Platz eingeschränkt wurde, umso aggressiver wurden die Guppys; sie entwickelten regelrechte „Beißhierarchien“. Fisch Nummer 8, der bevorzugtes Opfer von „Macho-Guppys“ wurde, tat ihnen sogar „irgendwie leid“, was Broers und Trebesch damit erklärten, „dass man auch ein bißchen verrückt wird, wenn man sich so lange mit ihnen beschäftigt“.
In Moskau, wo die Aquarianer regelmäßig „Guppy-Wettbewerbe“ veranstalten, widmen sich einige Fischforscher neuerdings ausgewilderten Guppys: Sie untersuchten drei Populationen, die in der Moskwa leben – dort, wo eintretende Wärme von Heizkraftwerken für die nötigen Temperaturen sorgt. Jede der Populationen entwickelte besondere Eigenschaften. In Berlin erzählte mir ein Techniker des Kraftwerks Rummelsburg, dass er zu Hause ein Aquarium mit Guppys besaß. Als er in Urlaub fahren wollte, wußte er nicht, wohin damit und entsorgte die Fische kurzerhand im Kühlsystem des Kraftwerks. Jahre später mußte das System überholt werden – und dazu das Kühlwasser abgelassen werden, dabei kamen mehrere Zentner Guppys mit heraus.
.
Inspiriert von den LSD-Versuchen der Harvard-Psychologen und der Armeeführung in den USA wollte der Germanist Dirk Reich ebenfalls damit experimentieren, traute sich dann aber nicht und testete die Droge erst einmal bei Fischen. Er besaß ein Aquarium mit großen und kleinen Fischen. Die kleinen, Guppys, obwohl in der Überzahl, hatten unter den großen, Schwertfischen, gelegentlich zu leiden, vor allem fraßen sie ihnen regelmäßig den Nachwuchs auf. Nachdem er seinen LSD-Trip ins Wasser geworfen hatte, verkrochen sich die großen hinter Steinen und Pflanzen, während die kleinen sich zunächst oben an der Wasseroberfläche sammelten. Dann schwammen sie zu den großen – und attackierten sie – so lange, bis sie tot waren. Dieses Experiment kam mir wie ausgedacht vor. Aber dann las ich im „Spektrum der Wissenschaft“, dass zwei Zoologen der schwedischen Universität Umea die Wirkung von Medikamenten-Rückstände in Gewässern untersucht hatten, konkret: den Effekt des angstlösenden Wirkstoffs Oxazepam auf einheimische Flussbarsche (Perca fluviatilis). Sie beobachteten deren Verhalten vor und nach Zugabe von Oxazepam zum Wasser und stellten fest, dass die Fische durch das Präparat aktiver wurden, schneller fraßen und bereitwilliger neue Beckenbereiche erforschten. Die Barsche verbrachten außerdem weniger Zeit in der Gruppe. „Normalerweise sind Barsche scheu und jagen in Schwärmen. Das ist eine bewährte Überlebensstrategie. Doch diejenigen, die in Oxazepam schwimmen, sind wesentlich mutiger“, meinte einer der Forscher.
.
Guppyforschung II
In den Sechzigerjahren starteten amerikanische Fischforscher ein Experiment mit Guppys, dass die Frage der Überfischung im Modell klären sollte. Dazu richteten sie zwei Aquarien mit ähnlichen Guppypopulationen ein. Aus einem fischten sie regelmäßig einige ab. Die Fruchtbarkeit der Guppys konnte das lange Zeit ausgleichen, aber ab 50% „reichte die Vermehrungsfähigkeit nicht mehr aus,“ schreibt H.W.Stürzer, der sich als Chefreporter der „Nordse-Zeitung“ jahrzehntelang mit der Fischwirtschaft beschäftigt hat, in seinem Buch „Tatort Meer“ (2005). Es ging den Amerikanern bei ihrem Guppy-Experiment darum, den „sozialistischen Weg zum Reichtum der Fischgewässer zu widerlegen.“ Die Sowjetunion hatte zuvor nämlich 19 Millionen Ostseeheringe im schwach salzhaltigen Aralsee ausgesetzt und dieser relativ kleine Schwarm hatte sich schnell vermehrt, was die sowjetischen Fischforscher auf die größere Fresskonkurrenz in den dichten Schwärmen der Meere zurückführten. Sie folgerten daraus laut Stürzer: „Intensiver Fischfang halte die Schwärme kleiner und begünstige das Wachstum der Überlebenden. Überfischung war zu einem Prinzip des immerwährenden Reichtums geworden.“ Die amerikanischen Guppys hatten nun bewiesen, dass das ein Irrweg war, aber die Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg unterstützte die sowjetische Theorie weiterhin, indem sie 1963 verkündete, dass der Schollenbestand an der deutschen Nordseeküste eine jährliche Abfischrate von 70% klaglos überstehen würde.
.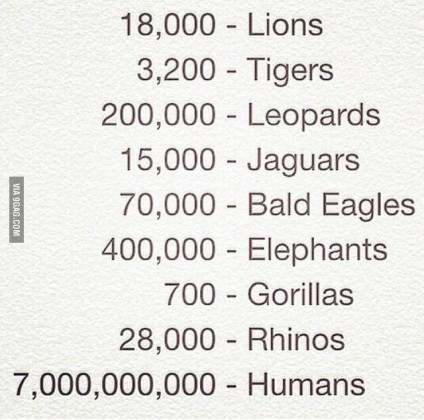
Die Bremerhavener „Nordsee-Zeitung“ schrieb daraufhin: „Eine optimale Ausnutzung des Meeres macht also eine recht intensive Befischung sogar notwendig.“ Dabei hatte schon die bisherige Ausnutzung dazu geführt, dass die Fänge immer mehr zurück gegangen waren und die gefangenen Fische immer kleiner wurden, von 20 westdeutschen Reedereien arbeiteten 18 bereits mit Verlust. Der Verband der Hochseefischerei forderte in dieser Situation: Zinsverbilligung für Neu- und Umbauten und eine staatliche Förderung der Suche nach neuen Fanggebieten. Nur so sei die Katastrophe zu verhindern. Alte Fanggebiete seien ausgefischt oder hinter vorgeschobenen Seegrenzen von Küstenstaaten nationalisiert (allein 140 Meerengen sollten Staatsgebiete werden. Die Sowjetunion machte es vor: „Sie entwickelte eine Flotillenfischerei nach Walfangmuster und ließen – in Kiel! – eine Serie von 24 mittelgroßen Heckfängern bauen, zudem in Leningrad einen Super-Fänger...Für dessen Besatzung waren 582 Kojen vorgesehen, davon 270 für Industriearbeiter. Sie sollten auf einer Reise 10.000 Tonnen Frostfisch oder 10 Millionen Fischkonserven produzieren.“
.
Stürzer titelte „Fischbestände schrumpfen – Flotte wächst“. Zur besseren Bewirtschaftung der Fischbestände fand 1971 eine Konferenz in Moskau statt. Die sowjetischen Fischereiexperten drehten dort ihre im Aralsee gewonnene Fang-Theorie um: „Durch Verminderung des Fischereiaufwands um die Hälfte könnten die Erträge von jährlich neun Millionen Tonnen im Nordostatlantik nicht nur erhalten, sondern noch gesteigert werden...Für Mindestmaschen sei es bereits zu spät, deshalb sollten Gesamtfangmengen und daraus Fangquoten für die einzelnen Länder festgelegt werden.“ Vier Jahre später luden amerikanische Fischereiexperten von der „National Oceanic and Armospheric Administration“ erfahrene Heringsspezialisten und ihre sowjetischen Kollegen, die Heringe in den Aralsee verpflanzt hatten, ein, an einer Expedition zur „Georges Bank“ vor dem Golf von Maine teil zu nehmen, um dort in 32 Meter Tiefe das Ablaichen von Heringen zu verfolgen. Dazu charterten sie vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht das Unterwasserlabor „Helgoland“. U.a. fanden sie dann heraus, dass es viele auch innerartliche „Larvenräuber“ gibt und dass die kommerziell genutzten Bestände an Kabeljau, Schellfisch und Plattfische zurückgehen, während die Zahl der Knorpelfische – Rochen und Hundshaie – zunahm. Diese fraßen die letzten Heringsschwärme: „Nur noch ein totaler Fangstopp wie in der Nordsee“ hätte laut Stürzer „die Heringe vielleicht retten können.“ Die Amerikaner zogen aus dem Forschungsergebnis jedoch den genau gegenteiligen Schluß: Sie motivierten ihre Fischerei mit zinsgünstigen Darlehen zum weiteren Ausbau ihrer Fangflotte.
.
Lesermail:
Die Hälfte des „Lebens“ in den Meeren und Flüssen wurde in den letzten 40 Jahren ausgerottet, die andere Hälfte kommt nun auch noch dran. Der WWF-Report vom September 2015 sagt es so: „Marine Species on ‚Brink of Collapse'“
Doris Lauterbach, Bielefeld
.
Guppyforschung III (Aquarianerinnen)
Dass es so wenig Frauen in den Aquarianer-Vereinen gibt, liegt vielleicht an den männer- und technikdominierten Vereinsgesprächen? Vermutete ich. In Berlin fragte ich eine Aquarianerin: Nicola Schwarzmaier, wie sie dazu kam, sich solch ein “Hobby” zuzulegen:
„
Ich wollte schon immer gerne Fische haben. Im Urlaub am Herault, einem französischen Fluß, haben wir z.B. kleine Fische gefangen und in einem Eimer gehalten. Aber für Fische in einem Aquarium zu Hause zu sorgen, dass hat man mir damals nicht zugetraut. Ich war da ja erst acht, erst mit Mitte zwanzig habe ich mir ein kleines, ich nenne es elektrisches Aquarium, gekauft, fast so schmal wie ein Flachbildschirm. Das hat mir aber nicht gefallen. 2014, zu meinem 32. Geburtstag hatte ich das Motto „Sushi“ ausgegeben, weil ich das so gerne esse. Alle hatten sich dementsprechend verkleidet. Ein Mitbewohner schenkte mir dann ein Sushi-Set zum Selbermachen. Als ich das Paket öffnete, befand sich darin 1 Beutel mit einem männlichen Zwergfadenfisch, 1 Beutel mit 2 Garnelen und 1 Beutel mit Wasserpflanzen. Dieses Geschenk löste sofort für den Rest der Party eine heftige Diskussion aus: Ob das nicht Tierquälerei sei? Und dass ich das Geschenk sofort zurückgeben müsse... Einer hielt dagegen: Das sei völlig in Ordnung, der Fisch würde zu den Labyrinthfischen gehören, sie können Sauerstoff aus der Luft atmen. Ich habe erst mal die Tiere und die Pflanzen in eine Glasvase getan. Die zwei Garnelen haben nicht lange gelebt. Den Zwergfadenfisch habe ich Klausi genannt. Und mir dann ein 20-Liter-Aquarium gekauft, dazu noch 7 Kardinalfische und etliche Garnelen. Dann ein 54-Liter-Becken, dann ein 160-Liter-Becken und zuletzt ein 330-Liter-Becken – alle für Süßwasser 20 Grad eingerichtet. Klausi lebt immer noch. Neben dem großen Aquarium habe ich noch drei andere Becken zum Züchten und für Quarantänefälle. Dann haben wir noch einen Garten mit einem Teich, in dem 5 Goldfische schwimmen. Und in meinem Büro steht ein 20-Liter-Kugelaquarium. Mit einem Kampffisch, zwei Schwertfische, etlichen Guppys und kleinen Garnelen aus eigener Zucht. Dazu natürlich Pflanzen – und Blasenschnecken, rote Posthornschnecken und Turmdeckelschnecken für den Boden. Ich kaufe meine Tiere nie in Zoologischen Handlungen, nur aus Privathaltungen.
In dem großen Becken zu Hause leben jetzt 8 Skalare, 4 Paare, die auch laichen, außerdem Guppys, deren Nachwuchs gefressen wird, zum Glück, die vermehren sich sonst zu stark, außerdem Ringelhandgarnelen mit Nachwuchs, die zu groß sind, um gefressen zu werden. 4 Zwergkugelfische, die sind etwas größer als Kichererbsen und essen Schnecken, ich fütter sie auch damit, aus meinem Schneckenzuchtbecken. Dann 3 Panzerwelse, 3 Pandawelse und 15 Antennenwelse – gelbe und schwarze, von denen einige jetzt auch Nachwuchs machen wollen. Schließlich noch Klausi, der Zwergfadenfisch, und 10 Dornaugen, die sehen wie kleine gestreifte Schlangen aus. Ich hatte auch mal 4 Muscheln, aber die Kugelfische haben sie gefressen.
Das 160-Liter-Becken hatte ich über Ebay gekauft, komplett: mit der ganzen Technik und Bepflanzung und mit sechs Diskusfischen – 2 blaue, 2 weiße und 2 geldorangene. Der Besitzer wollte ins Ausland gehen. Alle haben mir abgeraten: Es sei sehr schwierig, Diskusfische im Aquarium zu halten. Man muß z.B. einmal wöchentlich das Wasser wechseln. Es sind prächtige Fische, etwa so groß wie eine CD. Es ging dann ganz gut mit ihnen, aber ich hatte ständig Angst um sie und laufend hatten sie auch was. Schließlich dachte ich, das Becken sei zu klein für sie – und kaufte mir das 330-Liter-Aquarium. Beim Umzug ist aber was schief gegangen. Einer nach dem anderen wurde danach krank. Nachdem ich sie im Quarantänebecken mit Antibiotika behandelt hatte, bekamen sie die Lochkrankheit, das sind regelrechte kleine Löcher im Gesicht. Sie sahen schrecklich aus, ich habe ihnen Creme ins Gesicht geschmiert. Das war alles sehr teuer, fast 1500 Euro insgesamt. Als die ersten 3 starben, habe ich geweint, mein Mitbewohner hat sie begraben. Die anderen 3 wollte ich unbedingt los werden und habe sie übers Internet angeboten. Normalerweise kostet einer um die 100 Euro, ich habe sie alle drei für 25 Euro verkauft – an eine Russin, die sich gerade ein 800-Liter-Aquarium einrichtete, sie hatte noch vier kleine Kinder, wie die das alles geschafft hat...Mir sind meine Aquarien schon genug.
Im Aquarium-Verein bin ich nicht, zwei Mal habe ich bei denen angerufen – und bin gleich gerügt worden: „Was, du weißt deine Wasserwerte nicht? Die muß man bei Diskusfischen zwei Mal am Tag messen...“ Ich habs aber nicht so mit Chemie und Physik. Darum habe ich auch mit den anspruchsloseren Skalaren angefangen. Einmal habe ich ein Pärchen ins Laichbecken umgesetzt, da ist mir einer rausgesprungen, als wir ihn endlich fanden war er tot. In diesem Becken habe ich jetzt Kampffisch-Nachwuchs. Viele meiner Fische haben Namen. Das Tollste finde ich am Aquarium: Da ist nur eine Glaswand und dahinter eine ganz andere Welt, in dem ganz andere Gesetze als bei uns herrschen – fast wie im Weltraum.
Ein Meerwasser-Aquarium fände ich natürlich toll, ist mir aber zu viel Arbeit. Außerdem hätte ich zu viel Angst, das ich was falsch mache. Bei meinem Kugel-Aquarium im Büro muß ich gar nichts tun. Im großen Becken habe ich statt eines Saustoffsprudlers Oxydatoren, die funktionieren mit Wasserstoffperoxid, das kann ich wegen der rechten Bombenbauer nur mit Personalausweis kaufen. Das Schöne daran ist, die machen keinen Pumplärm, das Aquarium ist ganz leise. Stundenlang könnte ich davor sitzen, mein Hund ist schon ganz eifersüchtig auf die Fische.
Manchmal gehe ich in das Aquarium des Zoos, leider sieht man dort, dass es manchen Fischen nicht gut geht – den Haien z.B., die gehören da nicht hin. Das gilt auch für meine 2 Schwertträger im Kugelglas, sie brauchen viel Raum, die soll deswegen jetzt ein Kollege von mir nehmen. Schöner als die öffentlichen Aquarien ist das Schnorcheln, was man da alles für Tiere sieht...Ich mache deswegen immer Urlaub am Meer, getaucht habe ich bisher im Mittelmeer, in Thailand und auf La Réunion, wo ich ein Auslandssemester hatte. Jetzt sollen sich zu viele Haie in den Korallenriffs rumtreiben, so dass man dort besser nicht mehr taucht..
Manchmal verfolge ich im Internet die Eintragungen in den Aquarianer-Foren. Einige sind richtig verrückt: Die diskutieren da z.B., wie man einen unheilbar kranken Guppy am Humansten tötet. Eine Freundin von mir habe ich mit meiner Aquariumsleidenschaft angesteckt, die hat sich daraufhin auch ein Becken gekauft – mit vier an sich wenig anspruchsvollen Fischen: 2 Mollys, das sind lebendgebärende Zahnkarpfen, und 2 Platys, Spiegelkärpflinge aus der selben Familie. Aber die haben eine fast nicht heilbare Bauchwassersucht bekommen. Sie wollte die Fische aber nicht töten und hat sie dann in der Spree ausgesetzt. Ich war zuerst entsetzt, dass die vielleicht andere Fische anstecken, aber wahrscheinlich haben sie nicht lange in dem Flußwasser gelebt. Auch Guppys werden da manchmal ausgesetzt. Und im Brunnen nahe dem Dom lebt ein Krebs, den haben sie wahrscheinlich auch dort reingesetzt, ebenso wie die Wasserschildkröten im Engelbecken und im See des Thälmann-Parks.“
.
Guppys (Photo: wikimedia.org)
.
.
14. Gobibären – ihre Erforscher und Schützer
.
„Werdet selten!“ (F.Nietzsche)
Man weiß nicht, ob die Absicht der mongolischen Regierung, 2013 zum „Jahr des Gobibären“ zu erklären die internationale Gobibärforschung befördert hat oder ob es umgekehrt war. Fest steht, dass wir heuer mehr über den seltenen Gobibär wissen als noch vor einigen Jahren: U.a. dass es nur noch 20 bis 60 Exemplare dieses Tieres gibt, das von den Mongolen Mazaalai genannt wird. Sie leben in drei Gebirgszügen der westlichsten Ausläufer der Wüste Gobi – in der nahezu menschenleeren Umgebung der Oasen Baruun Tooroi und Shar Khulsny Bulag. Es handelt sich dabei um eine kleine Form des Braunbären, die heute den zentralasiatischen Isabellbären zugerechnet wird. Diese Bezeichnung bezieht sich auf ihr „isabellfarbenes“ Fell, was auf Isabella von Kastilien zurückgeht. Sie gelobte 1601, dass sie ihr weißes Hemd nicht eher wechseln wolle bis ihr Mann, Albrecht VII. von Habsburg, die Stadt Ostende, die er belagerte, erobert habe. Da die Belagerung drei Jahre, drei Monate und drei Tage dauerte, sah ihr Hemd entsprechend aus.
Auf „gobibaer.de“ heißt es, dass die „rotbraunen bis sandfarbenen“ Tiere erstmalig um 1900 von zwei russischen Botanikern entdeckt wurde, in ihrem „Feldtagebuch“ notierten sie: „Heute haben wir in den nördlichen Vorgebirgen des Cagan-Bogdo in einem trockenen und breiten Sajr... endlich einen Gobibären zu sehen bekommen. Er lief ohne Hast den Grund des Tales entlang, dunkelbraun, mit Fetzen von längerem und hellerem Haar, das nach dem Haarwechsel an dem dunkelbraunen Pelz hing. Der Bär beschnupperte etwas anscheinend auf der Suche nach Nahrung.“
1943 bestätigte ein mongolisch-sowjetisches Forschungsteam ihre Beobachtungen, 1953 gelang es lokalen Wissenschaftlern, ein Jagdverbot für den Gobibären durchzusetzen, 1975 wurde sein Verbreitungsgebiet in einer Größe von 52.000 Quadratkilometern zum Naturschutzgebiet erklärt: „Great Gobi Strictly Protected Area (GGSPA) heute genannt. Dass die kleine Population dennoch weiter abnahm, führen Gobibärforscher auf die Klimaerwärmung zurück, was die dort ohnehin sehr geringen Wasservorkommen weiter verringert. Vertreter der „National Commission for Conservation of Endangered Species“ der Mongolei erwägen eine regelmäßige Zufütterung sowie ihre Züchtung in Gefangenschaft. Der amerikanische Bärenforscher Harry Reynolds, der bereits 2005 zusammen mit kanadischen Biologen ein „Mongolian-American Gobi Bear Project research program“ initiierte, meint jedoch: „Das Wichtigste ist, sie in Ruhe zu lassen. Ihre Lebensweise ist derart prekär, dass die kleinste Störung ihr völliges Aussterben bewirken kann. Sie haben jedoch bewiesen, dass sie sich an extreme Lebensbedingungen anpassen können.“ Der ehemalige mongolische Umweltminister Damdin Tsogtbaatar sieht in den Anstrengungen zum Schutz des Gobibären, die ihren Ausdruck u.a. im „Jahr des Gobibären 2013“ finden, ein Beispiel für einen anderen Umgang mit Tierarten, die wir an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Das beinhaltet, dass es die Menschen (Jäger) waren, die die Gobibär-Population derart reduzierten. Der Umweltminister erinnerte in diesem Zusammenhang an die wilden Przewalski-Pferde, die in den Sechzigerjahren in der Mongolei ausgerottet wurden. Nur 12 überlebten – in europäischen Zoos, von wo aus ihre Nachkommen in den Neunzigerjahren wieder in der mongolischen Steppe ausgewildert wurden.
Beim Gobibär halten sich die direkten Beobachtungen bis heute in Grenzen. Es existieren nur wenige Fotos und seit 2004 ein bißchen Filmmaterial – als es gelang, Aufnahmen mit einer automatischen Kamera zu machen. Die sichersten Nachweise lieferte ein amerikanischer Genetiker in den achtziger Jahren, der durch das Auslegen von Drähten an vorher eingerichteten Futterstellen Haare gewinnen konnte. Leider war es aber auch damals nicht möglich, die Tiere direkt zu beobachten. Genetische Untersuchungen erbrachten jedoch einen Beweis dafür, dass es sich um eine eigene Tierart handelt. Zweifelsfrei konnten 13 verschiedene Individuen identifiziert werden.
Über die Lebensweise dieser Tiere ist noch immer so gut wie nichts bekannt. „Man weiß nicht zweifelsfrei, ob die Bären tag- oder nachtaktiv sind, wo sie überwintern, ob sie in Gruppen leben oder Einzelgänger sind. Selbst über die Ernährungsweise herrscht Uneinigkeit. Während russische Zoologen vom Pfeifhasenfresser sprechen, also von einem überwiegend sich von Fleisch ernährendem Tier, sehen mongolische Forscher den Gobibären als Pflanzenfresser, welcher als Hauptnahrung Bajuun-Wurzeln (dt. Kleiner Rhabarber, lat. Rheum nanum) im Frühjahr, ansonsten Beeren und andere Pflanzen zu sich nimmt.“ Dieser wilde Rhabarber war einst auch ein begehrtes Nahrungsmittel am Hof von Tamerlan in Samarkand.
Die Internetseite „gobibaer.de“ wird vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern geführt, dieser finanzierte auch ein „Schutz- und Informationszentrum für den Gobibären in der Mongolei“, das 2012 eröffnet wurde – zusammen mit der Nationalen Universität der Mongolei in Ulaanbaatar und der Schutzgebietsverwaltung des Großgobi-Naturschutzgebietes, Bayuntooroi.
„Von diesem Zentrum aus sollen konkrete Schutzmaßnahmen zum Erhalt des höchst bedrohten Gobibären gestartet werden.“ Im Vorfeld hatten die deutschen Gobibärschützer 2008 und 2009 bereits zwei „Expeditionen“ in das Verbreitungsgebiet des Gobibärs unternommen:
„Die Expeditionen haben klar gezeigt, dass eine dringende Notwendigkeit besteht, für den Gobibären etwas zu unternehmen. Wir konnten frische Spuren finden, was bedeutet, dass der Bär noch in der Transaltaigobi vorkommt. Wir konnten ferner eine hohe Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung und wichtiger Entscheidungsträger in der Mongolei erfahren. Das sind die Voraussetzungen vor Ort, um eine Station aufbauen zu können, die zum Überleben des Gobibären essentielle Voraussetzung sind.“
Bei der Konkretisierung des Projekts waren sich die deutschen und mongolischen Gobibärschützer nicht immer einig: „Wir haben in allen Gesprächen deutlich gemacht, dass es sich bei unserem Projekt um den Schutz des Gobibären in seinem Lebensraum handelt. Etwa 30 km von Bayantooroi entfernt hat eine mongolische Initiative einen anderen Weg zum Erhalt des Gobibären eingeschlagen. Es wurde eine Zuchtanlage gebaut, die aus engen Betonkäfigen bestehen und wo es gelingen soll den gefährdeten Gobibären zu züchten. Dazu sollen wilde Bären gefangen werden und hierher verbracht werden. Da nur wenig über die Biologie der Art überhaupt bekannt ist, die Populationen sehr klein sind und deshalb die Auswirkung von Wildfängen kaum vorhersehbar sind, wird dieses Vorhaben von uns strikt abgelehnt.“
Um weitere Gelder für das Gobibär-Zentrum zu acquirieren, produzierte der bayrische Landesbund für Vogelschutz e.V. einen Film über den Verlauf seiner zwei Expeditionen: „Mazaalai – Auf den Spuren des Gobibären“, man kann ihn als DVD für 25 Euro bestellen – beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. im „LBV-Naturshop“, 91161 Hilpoltstein.
.
Waschbären – ihre Feinde und Freunde
Mindestens seitdem der Strom der „Wirtschaftsflüchtlinge“ (heute „Refugees“ genannt), nach Lampedusa einsetzte, hat sich der Streit, ob Deutschland ein „Einwanderungsland“ ist oder sein sollte, auf Tiere und Pflanzen ausgedehnt, wenn nicht gar verlagert. Kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Massenmedium mit neuen „Erkenntnissen“ über „invasive Arten“ aufwartet und Ratschläge gibt für einen durchaus vernünftigen Umgang mit ihnen. Der TV-Sender Arte schickte mir neulich schon unaufgefordert seinen Film „Invasion der Pflanzen. Gefahr für Umwelt und Mensch“ zu. Das „Neue Deutschland“ veröffentlichte eine ausschließlich der Vernunft verpflichtete Zusammenfassung der Debatte über tierische und pflanzliche Ausländer: „Die Mehrheit der Wissenschaftler ist dabei einer Meinung: Invasive Arten sind in der Summe als kritisch für das Ökosystem anzusehen.“ Dazu scheint für den ND-Autor auch die Menschenwelt zu zählen – ja, vor allem sie, denn als Beispiele erwähnt er einige ausländische Pflanzen, die sich hier, einmal eingeschleppt, unglaublich vermehren – und „Allergien, Hautausschläge“ etc. hervorrufen. Es gibt inzwischen ganze Sondereinheiten – auf Basis von 1-Euro-Jobs, die mit Schutzanzügen anrücken und sie ausrotten. Die gleichen, für Menschen unangenehmen Pflanzen sind jedoch bei den Bienen äußerst beliebt, weswegen sie z.B. von den Imkern geschätzt werden: Sie protestieren.
Bei den Tieren werden u.a. die aus Amerika importierten und ab 1929 in Westdeutschland ausgewilderten bzw. 1945 aus einer zerbombten Zuchtfarm in Ostdeutschland entkommenen Waschbären erwähnt, die nicht mehr zu den Bären sondern den Hundeähnlichen gezählt werden: „Sie dezimieren die hier heimische Vogel- und Amphibienwelt.“ Ihnen treten die Jäger entgegen, indem sie regelmäßig eine sogenannte „Bestandsregulierung“ vornehmen. Der Waschbär darf hierzulande ganzjährig gejagt werden. Allerdings muß man jedes tote Tier amtlich registrieren lassen. 2013 wurden allein in Berlin und Brandenburg 20.300 Waschbären „erlegt“. Das Brandenburger Agrarministerium bilanzierte dies als eine Art Wirtschaftserfolg: „In nur vier Jahren verdoppelte sich die Strecke...“ Gemeint ist mit diesem Jägerdeutsch-Euphemismus die Zahl der erlegten Tiere, die nach dem Halali vermüllt werden, denn wer will heute noch mit so einer albernen Waschbärmütze mit Schwanz hintendran oder gar mit einem ganzen Waschbär-Pelzmantel herumlaufen? Ersteres trugen nach dem Krieg die verhinderten Trapper, letzteres die ungehinderten Zuhälter.
Auch in den anderen Bundesländern mußten 2013 zigtausende von Waschbären dran glauben. Dennoch warnte eine Schweizer Zeitung: „Waschbär ist auf dem Vormarsch Richtung Südostschweiz“. Die FAZ titelte: „Die Rasselbande zerstört alles“, der „Spiegel: „Randale unterm Dach“, und die „Welt“: „Terror-Waschbären richten immense Schäden an“. Die „Zeit“ pries gar die unsere Wälder von diesem Schädling befreienden Jäger als verantwortungsvolle Ökologen – mit der Überschrift: „Von wegen Spaß am Tiere-Töten.“ Im „Merkur“ priesen sich daraufhin die Jäger selbst so an: „Wir sind Naturschützer“. Darüberhinaus finden sich im Internet mittlerweile hunderte von Seiten über (technische) „Schutz- und Abwehrmaßnahmen“, so dass selbst Nichtbewaffnete gegen die Waschbären aktiv werden können. Daneben findet man aber auch anrührende Feuilletons – z.B. von Rentnern, bei denen eine Waschbärfamilie auf dem Dachboden oder im Kamin lebt.
Der „Anti-Jagdblog“ gibt unter der Überschrift „Jäger erlegen so viele Waschbären wie nie zuvor“ zu bedenken, dass noch einmal so viele alljährlich überfahren werden. Die Tierschützerin Marianne schreibt: „Ja, dieses Brandenburg ist landschaftlich schön, nur leider ist es das Land, mit der größten Dichte an Mördertürmen, Fallen, Kirrstellen, Ansitzen und Mörderpack. Am Rande von Berlin und Potsdam sind die Wälder gespickt mit Blutbader [Jägern] und trotzigen Bauwerken [Hochständen], die den Wildtieren den Garaus machen. Der Minister ist selbst Blutbader und Befürworter der Massentierhaltung. Leider sind die Brandenburger nicht sehr aufgeklärt, aber zum Glück werden die Jagdgegner immer mehr.“ Neben den Jägern sind es vor allem die Singvogel-Freunde und Besitzer von Obstbaumgärten, die etwas gegen Waschbären haben.
Auf der anderen Seite verhält es sich bei den Waschbär-Forschern so wie bei allen Erforschern von Tierarten: Sie sind von ihren im Grunde harmlosen und ebenso rührenden wie klugen Untersuchungsobjekten derart eingenommen, dass sie sich mit der Zeit gradezu zu ihren Sprechern, Waschbärensprechern, aufschwingen. Dies gilt z.B. für den Biologen Ulf Hohmann und den Tierphotographen Ingo Batussek. Für ihren Forschungsbericht „Der Waschbär“ (2011) beobachteten sie im Sollinger Forst bei Höxter jahrelang den nachtaktiven, gerne auf großen Eichen lebenden Kleinbären mit ihren Nachtsichtgeräten, sie fingen sich welche in Fallen und statteten sie mit Sendern aus oder ließen sie von Diplomstudentinnen großziehen, damit sie das Verhalten dieser zahm gewordenen Tiere später auch noch in Freiheit bequem, quasi von Nahem, studieren konnten. Diese Mischung aus Zoo- und Feldforschung wandte bereits Konrad Lorenz erfolgreich bei Graugänsen an, von denen eine, Martina, es sogar zur Berühmtheit brachte.
Den Göttinger Waschbärforschern wurde diese etwas aufwändige Methode von der NDR-Redaktion „Expeditionen ins Tierreich“ finanziert. Die Jungtiere dafür erwarben sie bei einem sauerländischen Waschbärzüchter. Ihre „handaufgezogenen“ Waschbären galten den Forschern schon bald als „Botschafter in eigener Sache“.
Im Internet werden heute jede Menge Waschbären angeboten: „albino, blonde, elfenbeinfarbene und naturfarbene“. Auf einer Internetseite fand ich den Hinweis: „Zuerst sollten Sie genau wissen, was Sie sich holen, wenn Sie einen Waschbär kaufen. Wussten Sie, dass ein Waschbär Ihr Anwesen zerstören kann, wenn Sie ihn nicht richtig pflegen? Zum Beispiel ist es bekannt, dass Waschbären Kabeldrähte ausgraben. Außerdem sind sie kaum zu zähmen...“ Das ist nicht unbedingt eine Werbung für den Waschbär als Haustier. Selbst die Waschbärliebhaber Hohmann und Bartussek geben unumwunden zu: „Der Waschbär ist kein Haustier und wird es nie werden. Daran ändern auch die Beteuerungen so mancher Tierhändler nichts.“ Das hält sie jedoch nicht davon ab, im letzten Kapitel ihres Buches „Tipps und Tricks zu Aufzucht und Haltung von Waschbären“ zu geben – und sich sogar zu fragen: „Doch als Haustier?“ Dazu heißt es: „Wenn man sich entschlossen hat, Waschbären im Haus zu halten, muss bedacht werden, dass wir für unseren Pflegling fortan seine ‚Waschbärgruppe‘ sind.“ Und das bedeutet u.a., dass wir als „Sparringpartner“ für seine wilden Beiß- und Kratz-Spiele herhalten müssen, dafür sind wir Menschen aber zu dünnhäutig: „Nur ein robuster, im Haus lebender Hund kann diese Aufgabe übernehmen.“ Mit dem Kauf eines Waschbären sollte man sich also am Besten auch noch gleich einen großen Hund anschaffen. Die beiden Waschbärenforscher haben das selbst ausprobiert – und können deswegen einige lustige Geschichten darüber erzählen. Einen kastrierten Waschbär namens Willi ließen sie fast ein Jahr lang Nachts raus, das sei in einem bewohnten Gebiet jedoch nicht zu empfehlen, meinen sie, denn „die Tierliebe und Toleranz sämtlicher Nachbarn wurde dabei auf eine harte Probe gestellt.“ Am Stadtrand von Berlin sehen dagegen viele Bewohner rot, wenn sie einen Waschbären in ihrem Garten erblicken: Sofort rufen sie einen Jäger an, der ihnen das Tier mit einer Falle wegfängt – und umbringt.
In meiner Familie hatten wir immer viele Tiere, dabei wurde kein großer Unterschied zwischen Mensch und Tier gemacht. Heute würde ich auch die Pflanzen da mit einbeziehen, der Vegetarismus ist also keine Option für mich. Beim Waschbären würde ich auch erst Mal – wie die beiden Waschbärenforscher – eine „Inklusion“ ins Auge fassen, wobei mir bewußt wäre, dass Waschbär nicht gleich Waschbär ist. Das Prinzip „Kennst du einen, kennst du alle“ gilt gerade bei Waschbären nicht: Jeder ist auf eine andere Art gewaschen.
Und im übrigen waschen sie ihre Nahrung gar nicht vorm Verspeisen, sondern suchen gerne unter Wasser nach Eßbarem (kleine Krebse z.B..). Dazu haben sie hypersensible Vorderpfoten: „Der Tastsinn ist die unumstrittene Geheimwaffe des Waschbären,“ schreiben Hohmann/Bartussek, „kein anderes Tier reserviert sich für die Interpretation der taktilen Reizimpulse aus den Handflächen so viel Hirnmasse wie der Waschbär.“ Er hat dafür genau „so viele graue Zellen, wie wir für die Reizverarbeitung unseres wichtigsten Sinnesorgans, des Auges, bereithalten.“ Mit der Folge: Wenn Waschbären im Wasser herumtasten „blicken sie ins Leere und wirken dabei merkwürdig abwesend.“ Neben ihrem Tastsinn ist aber auch ihr Geruchssinn „ausgezeichnet“: zwei Sinne, die wir eher vernachlässigen – seit einigen zigtausend Jahren schon. Ein Waschbär wäre in dieser Hinsicht also eine sinn-volle Ergänzung zu uns. Das wollte ich hier nur mal zu bedenken geben – an die Adresse der Waschbärverächter.
.
Leserbrief:
Man merkt, dass Sie kein Eigenheim und keinen Garten und wahrscheinlich nicht einmal Mülltonnen draußen stehen haben. Wir rufen jedenfalls sofort den Jäger, wenn wir einen Waschbären bei uns sehen, und der fängt ihn mit Fallen weg. Sonst werden wir unseres Lebens hier draußen nicht mehr froh.
Johann Höfer, Wittenberge an der Elbe
.
Eisbären
Vor ein paar Jahren ließ sich Wladimir Putin auf dem Archipel Franz-Joseph-Land im äußersten Norden der Arktis mit einem Eisbären – einem betäubten allerdings – photographieren. Obama will ebenfalls den Eisbärenschutz für seine „Umweltbilanz“ nutzen. Putin wollte in der Arktis demonstrieren, dass ihm das Überleben der Eisbären ein Anliegen ist. Eisbären sind beliebt. Man denke nur an den Rummel, den der Esbär „Knuth“ im Zoo Berlin hervorrief oder an die Endlos-Werbekampagne der Berliner Gaswerke, die immer wieder ein Eisbären-Motiv benutzen. Nun schmilzt jedoch das Packeis in der Arktis (nicht zuletzt durch die Versorgung der Haushalte durch die ganzen Gaswerke). „Ohne Packeis kann der von den Inuit verehrte und gejagte Eisbäre, den sie ‚Nanuk‘ nennen, aber nicht überleben,“ schreibt Le Monde Diplomatique. Daneben setzen den Eisbären Jäger, Wilderer und Umweltgifte zu. Ihre Population beträgt derzeit noch etwa 20- bis 25.000 Exemplare. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert war der Eisbär schon einmal gefährdet, als erst skandinavische und russische, aber dann auch holländische, dänische und britische Pelztierjäger hinter ihm her waren. Während des Kalten Krieges installierten die Amerikaner ein Frühwarnradarsystem gegen die Sowjetunion und einige Militärstützpunkte – u.a. in Churchill in der kanadischen Provinz Manitoba. Die amerikanischen und kanadischen Soldaten „vertrieben sich die Langeweile mit exzessiver Eisbärenjagd“. Besonders schlimm war es laut LMD um die Militärstützpunkte in Resolute Bay (Nunavut) und Thule (Grönland).
Die Sowjets veranstalteten etwa zur selben Zeit auf der Eisbäreninsel Nowaja Semlja Atombomben-Versuche. Auch die USA hinterließen in Grönland und Alaska, wo die US-Army zwei Atomkraftwerke betrieb, „Unmgen von radioaktiven Müll“. Wegen des damit verbundenen Rückgangs der Eisbär-Populationen wurde 1968 eine multinationale Eisbären-Spezialisten-Gruppe gegründet. 1973 traf man in Oslo ein Abkommen zum Schutz der Eisbären. Im danach gegründeten Arktischen Rat haben inzwischen auch Länder wie Singapur einen Beobachterstatus.
Einige Wissenschaftler schlagen vor, mehr Eisbären in Zoos zu halten, um sie dort als „Samenbanken“ zu nutzen. „Manche Zoos machen mit Eisbären tatsächlich gute Geschäfte,“ schreibt LMD. Trotz aller Unkenrufe und Rettungsideen sind die Eisbären erstaunlich widerstandsfähig: Einige Populationen vergrößern sich sogar. „Das muß allerdings nicht heißen, dass die Zukunft der Eisbären gesichert ist...Schließlich geht es um nichts weniger als die zukünftige Nutzung der arktischen Territrorien.“
„
Im Gewirr geopolitischer Spannungen spielt der Eisbär jedoch eine herausragende Rolle.“ Er genießt im „Artenschutzabkommen“ einen „hohen Schutz“. Russland und den USA reicht das jedoch noch nicht: Sie wollen jeglichen kommerziellen Handel mit seinem Fell verbieten. Einzig die Jagdquoten der kanadischen Inuit lassen sie gelten. Die Inuit verkaufen ihre Quoten (jährlich dürfen sie 400 – 600 erlegen) allerdings nicht selten an reiche Sportjäger.
Unterstützung finden die beiden Staaten von einer Reihe sogenannter „NGOs“, die sich speziell für den „Polar Bear“ einsetzen. Sie wollen ebenfalls die Inuit-Fangquoten nicht einschränken, weil damit die Wilderei zunehmen würde, wie sie sagen. Und Kanada unterstützt das, weil es den Inuit gewogen bleiben will. Während des Kalten Krieges wollte Kanada sich das letzte freie Land in der Arktis einverleiben – und setzte deswegen dort mehrere Inuit-Familien aus, von denen etliche starben, bevor sie sich wieder in die Lage versetzten, von der Jagd zu leben. 1999 wurde den Überlebenden Nunavut als „autonomes Territorium“ zugesprochen und Kanadier halten seitdem dort zusammen mit den Inuit Militärmanöver ab.
.
Lesermail:
Über Eisbären erfährt man leider nur wenig in Ihrem LMD-gestützten Text. Schade.
Jan Treulieb, Dessau
.
Russische Bären
.
Amerikanischer Bär
.
Rumänischer Bär (massiert gegen Rheuma)
.
.
15. Bio-Invasionen
Jetzt wird wieder vor dem Riesen-Bärenklau gewarnt,dessen Saft zu Fieber und Atemnot führen kann, auch wenn man der Pflanze nur nahe kommt. Es ist eine invasive Art. Dieses Thema ist inzwischen derart global geworden, dass es ein neues Fach: „Invasionsbiologie“ hervorgebracht hat. Auch in Berlin wird dazu geforscht. Die Zeitschrift „Siegessäule“ fragte sich kürzlich: „Gehört den Expets die Berliner Nacht?“ Bei den Expets handelt es sich um verwilderte Haustiere – z.B. Katzen, von denen es laut Auskunft des Tierschutzvereins 80.000 in Berlin geben soll. Im Rhein-Main-Gebiet sind es entflogene indische Halsbandsittiche, die sich dort derart vermehrt haben, dass sie z.B. die Düsseldorfer Flaniermeile „Kö“ vollscheißen. Man will sie nun vertreiben.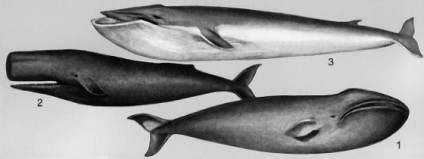
Die Globalisierung der Haustiere begann mit den (bäuerlichen) Auswanderern nach Amerika, Südafrika, Neuseeland und Australien: Sie brachten Pferde, Kühe, Ziegen, Schafe, Hunde und Bienen, aber auch die europäischen Bäume, Sträucher und Zierpflanzen in die Neue Heimat, wo diese nicht selten die dortige Flora und Fauna verdrängten. Oftmals nicht weniger brutal wie ihre weißen Besitzer mit den Ureinwohnern umgingen. Wobei diese zuvor bereits selbst einige Tier- und Pflanzen-Arten ausgerottet hatten.
In Europa geschah Ähnliches: Immer wieder wildern sich hier z.B. eingeführte Zierpflanzen und -bäume aus, was bisweilen Jahrzehnte dauern kann, bis sie sich akklimatisiert haben und alteingesessene Arten verdrängen. Bei der falschen Akazie (der nordamerikanischen Robinie) war das z.B. der Fall, aber auch beim japanischen Götterbaum, der sich hier 122 Jahre lang nicht vermehrte, aber im Frühjahr 1945, als alles in Trümmer lag, plötzlich heimisch fühlte. Besonders schlimm war es mit der amerikanischen Wasserpest, obwohl es hier nur weibliche Pflanzen gab, die männlichen waren in Amerika geblieben. Aber aus jedem abgebrochenen Stengel wuchs eine neue Wasserpest. Der Heidedichter Hermann Löns schrieb im Hannoverschen Tageblatt 1910: „Es erhub sich überall ein schreckliches Heulen und Zähneklappern, denn der Tag schien nicht mehr fern, da alle Binnengewässer Europas bis zum Rande mit dem Kraute gefüllt waren, so dass kein Schiff mehr fahren, kein Mensch mehr baden, keine Ente mehr gründeln und kein Fisch mehr schwimmen konnte.“ Das Heulen hielt noch bis in die Sechzigerjahre an, aber dann ging die Plage zurück – vielleicht „ganz ohne Grund,“ wie der Berliner Biologie Bernhard Kegel in seinem Buch über die „biologischen Invasionen: Die Ameise als Tramp“ (2013) vermutet. Jeder kennt das Beispiel Kaninchen, die man in Australien aussetzte. Mit allen Mitteln hat man dort seit 100 Jahren versucht, die Kaninchenplage einzudämmen, zuletzt mit dem Virus einer für Kaninchen tödlichen Krankheit. Aus dem Dokumentarfilm „Darwins Alptraum“ kennt man die Verheerung, die ein Dutzend Nilbarsche anrichteten, nachdem man sie im Viktoriasee ausgesetzt hatte: Sie vernichteten so gut wie alles Leben in diesem größten afrikanischen See – und damit auch ein Großteil der Lebensgrundlage der Menschen, die bis dahin vom See gelebt hatten. Auf den Galapagos-Inseln bedrohen die verwilderten Ziegen die einheimische Flora – und damit auch die Fauna. Auf Neuseeland sind es vor allem eingeschleppte Wespen, Ratten, Wiesel und der Kletterbeutler Fuchskusus, die die großteils flugunfähigen Vögel der Inselgruppe an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Auch die verwilderten Pferde sind den neu-seeländischen Naturschützern ein Dorn im Auge. Bernhard Kegel hat sich von ihnen für seine Studie, in der er vor allem die Situation in Deutschland und Neuseeland vergleicht, beeindrucken lassen, deswegen stimmt er deren „hässliche Notwendigkeit“ zu: „Ausrottung von Exoten,“ weil das aber fatal nach „Ausländer raus!“ klingt, spricht man dabei vornehm von „Neozoen“ bzw. „Neophyten“. Aber wie lange ist eine Pflanzen- oder Tierart ein Neuphyt/Neuzoon und ab wann ein Altphyt/Altzoon. Das fragte sich auch der Münchner Ökologe Josef Reichholf, wobei er zu dem selben Schluß wie sein Landsmann Karl Valentin kam: „Praktisch jede Art war irgendwo einmal fremd.“ Den auch von vielen Schweizer Naturschützern befürworteten Kampf gegen eingewanderte „Exoten“ hält Reichholf für einen Ausdruck von „konservativ-anthroponationalistischem Denken“.
Derzeit richtet sich der Bürgerzorn gegen den giftigen Riesen-Bärenklau aus dem Kaukasus und das von Allergikern gefürchtete Traubenkraut Ambrosia – beide gelangten bereits im 19.Jahrhundert als Zierpflanzen zu uns. Nun sind sie plötzlich eine Bedrohung: Es wurden Notruftelefone eingerichtet, damit man neue Vorkommen dieser Pflanzen meldet, den Imkern ist der Bärenklau jedoch als Bienenblume willkommen. Sie fürchten dafür die asiatische Riesenhornisse, die sich schon via Spanien bis nach Belgien ausgebreitet hat. Die hiesigen Bienen haben im Gegensatz zu den asiatischen (noch?) keine Widerstandsform gegen diese Hornissenart entwickelt – und sind ihnen erst einmal hilflos ausgeliefert. Ähnliches gilt für das „Falsche Weiße Stengelbecherchen“, eine aus Asien eingeschleppte Pilzart, die hier die Eschen tötet, während die asiatischen Eschen resistent dagegen sind oder geworden sind. Hier tötet er im übrigen auch Bodenbakterien und andere Mikroorganismen, so dass man hofft, ihn als neues Antibiotikum einsetzen zu können. Den europäischen Eschen hilft das allerdings nicht.
Die Invasionen finden vor allem unter Wasser statt: Immer wieder werden irgendwelche exotischen Fische, Krebse und Muscheln – bis hin zu Schnapppschildkräten in den hiesigen Gewässern ausgesetzt oder sie kommen an der Außenhaut von Überseeschiffen haftend hierher. Zudem erlauben es die mit Kanälen verbundenen europäischen Wasserstraßen sogar Organismen aus dem Schwarzen Meer, sich ohne fremde Hilfe bis nach Norddeutschland auszubreiten. Bernhard Kegel erwähnt daneben das Ballastwasser, das die Handelsschiffe aufnehmen, über den halben Erdball transportieren und dann irgendwo wieder ablassen: „Durchschnittliche Containerschiffe führen teilweise über 10.000 Tonnen Wasser mit sich“ – und darin schwimmen Millionen planktonische Larven. Ein Untersuchung der Ballastwasserproben von 159 japanischen Handelsschiffen ergab, dass sie 367 verschiedene Tier- und Pflanzenarten enthielten. Ausgehend von 35.000 Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, bedeutet dies, das „mehrere tausend Arten täglich an einer Schiffsreise“ teilnehmen – und sich dann anderswo ausbreiten.
Als einer der ersten, der die Globalisierung einer Tierart und ihre Folgen thematisierte, darf der tschechische Nationaldichter Karel Capek gelten. In seinem Roman „Der Krieg mit den Molchen“ geht es um den ostasiatischen Riesensalamander, denen ein Kapitän in ihrem letzten Rückzugsgebiet bei Sumatra half, sich gegen die Haie zu schützen, wofür diese „Molche“, die von Muscheln leben, sich mit Perlen bedankten. Nach und nach werden sie überall angesiedelt, wobei man sich ihrer auch beim Kanal- und Deichbau bedient. Schließlich sind sie so wehrhaft gemacht worden, dass die Staaten sie als Küstenschutztruppe in Dienst nehmen – und als Hilfstruppen aufeinander hetzen. Sie wenden sich jedoch vereint gegen die Menschen, nicht zuletzt, indem sie immer größere Stücke vom Binnenland in unterspülte Uferzonen verwandeln, weil sie wegen ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit (jedes Salamanderweibchen legt hunderte von Eier jährlich) ständig den Lebensraum erweitern müssen. Man weiß nicht, ob man sich als Leser dieser Kriegsschilderung auf die Seite der Menschen oder der Molche schlagen soll.
So geht es uns auch in Wirklichkeit bei den invasiven Tierarten: Weil z.B. die aus Amerika eingeschleppten Grauhörnchen die europäischen Eichhörnchen verdrängen, planten italienische Bioinvasionsexperten, die Ausländer auszurotten, etliche Tierschützer waren dagegen. Sie klagten vor Gericht – und bekamen Recht.
Anders in der Schweiz, wo man zwei Trauerschwan-Pärchen kuzerhand die Flügel stutzte, um sie zur Standorttreue, d. h. zu Boden, zu zwingen. Die Vögel hatten ihr Brutrevier vom Thunersee in den Wohlensee verlegt. „Anfang Februar ließen sich vier der zehn vom Kanton auf dem Thunersee bewilligten Schwarzschwäne am Wohlensee nieder“, berichtete die Berner Zeitung. Diese vier wurden daraufhin nachts mit Netzen eingefangen. Und nachdem man ihnen die Flügel gestutzt hatte, brachte man sie zum Tuhnersee zurück. Der Jagdaufseher wollte nicht, dass sich diese im Wohlensee nicht heimische Art verbreitet, seine Wildhüter müßten sonst immer wieder deren Gelege zerstören. Als „heimisch“ gelten Arten, die in ihren jeweiligen Habitaten bereits seit etwa 200 Jahre leben, was nicht nur bei Vögeln ziemlich schwachsinnig ist. Aber der Umgang der Schweizer Naturschützer mit den Trauerschwänen, die man dort 2012 sogar alle abschießen wollte, korrespondiert mit dem Schweizer Referendum, auch so gut wie keine menschlichen Ausländer mehr ins Land zu lassen.
.
Leserbrief:
Die Betrachtungsweise von Herrn Höge ist etwas schlicht (oder vielleicht auch nur überformt von Überlegungen, die mehr mit der menschlichen Gesellschaft zu tun haben als mit der Natur). Es ist die falsche Frage, nach wie langer Präsenz man aufhören sollte, eine Art als Neophyt oder Neozoe zu bezeichnen. Im Extremfall kann das auch für immer angemessen bleiben, denn ausschlaggebend ist ein anderer Aspekt, nämlich wie schnell die Art wie große Distanzen überwunden hat und v. a., wer sie dabei begleitet hat. Das Problem besteht schließlich nicht darin, dass eine Art irgendwo „fremd“ ist (ein rein menschlicher Begriff), sondern dass beschränkende Faktoren ihres Biotops nicht mehr vorhanden sind und sie sich darum übermäßig vermehrt, andere Arten verdrängt und dadurch die Biodiversität schädigt. Wenn die beschränkenden Faktoren, wie etwa Fressfeinde, die Reise mitmachen, entsteht dieser Effekt dadurch nicht. Natürlich haben auch die Fressfeinde wiederum beschränkende Faktoren, deren Abwesenheit eigene Probleme bergen kann, sodass man insgesamt sagen kann, je größere Teile des ursprünglichen Biotops mitwandern, desto geringer ist die Gefahr für die Biodiversität. Bei der natürlichen Wanderung von Arten ist es ja schließlich auch genau so: Das gesamte Biotop, oder zumindest sehr große Teile davon, wandern gemeinsam. Florian Suittenpointner/Köln
.
Bio-Invasor Höckerschwan
.
.
.
.
Der Autor auf der Schwanstation des ACC Weimar
.
Schwan auf der Krankenstation des Tierheims Berlin (Handyphoto)
.
1
6. Das koloniale Erbe als Jobmaschine
Das Humboldt-Schloß wird jede Menge Arbeit für Akademiker und Journalisten schaffen – keine Domestikenjobs diesmal. Alles, was dort hinkommt, jedes der 500.000 ethnologischen Objekte und etwa 1000 Schädel bzw. Knochen von Ostafrikanern, muß recherchiert werden: Ist das Teil fies erbeutet oder ordentlich erworben worden? Selbst beim kostbaren Perlenthron aus Kamerun, den der Sultan von Bamun dem Berliner Häuptling Wilhelm II. „schenkte“ (die Berliner Zeitung schrieb dieses Wort bereits in Anführungsstrichen), ist man sich unsicher, ob nicht Zwang dahinter stand. Die Deutschen hatten nach 1884 auf ihrem Unterwerfungsfeldzug durchs Land „etliche Ethnien massakriert, Dörfer verwüstet und Überlebende zur Sklavenarbeit verpflichtet.“ Um seinem Sultanat dieses Schicksal zu ersparen, stellte Ibrahim Njoya den Deutschen Soldaten für ihre „Strafexpeditionen“ zur Verfügung und trennte sich von seinem Thron, wobei er ein entsprechendes Gegengeschenk von Wilhelm II. erwartete. Er bekam jedoch nur eine Kürassier-Uniform und ein Orchestrion. Unter dem Aspekt des Warentauschs, bei dem es um Äquivalente geht, ein mindestens fragwürdiger Deal. Da der Sultan zudem unter Druck stand, liegt ein Vergleich mit den „preisgünstigen“ Arisierungen von jüdischem Eigentum nahe. Unter dem Aspekt des Geschenketauschs, der nur die Verpflichtung zur Erwiderung der empfangenen Gabe – womit auch immer – beinhaltet, geht dieser asymmetrische Austausch aber eventuell in Ordnung. Bei den meisten Objekten ist die Sachlage weniger verzwickt. So gehörte zum Troß des schädelsammelnden Herzogs von Mecklenburg auch der Ethnologe Hans Fischer; er hat geschildert, wie sie an ihre „Beute“ kamen: Sie gingen immer dann in die Dörfer, wenn die „Eingeborenen“ nicht da waren – ungeniert betraten sie deren Hütten und nahmen sich, was ihnen wertvoll erschien. Dafür hinterließen sie die üblichen europäischen „Gegengeschenke“ (Tabak, Eisennägel, kleine Spiegel). Die Schädel und Knochen buddelten sie aus den Gräbern aus. Der holländische Autor Frank Westermann erwähnt in seinem Buch „El Negro“ eine nach Europa verschleppte Afrikanerin, die so genannte „Hottentotten-Venus“ – Saartjie Sara Baartmann, die zuerst lebend auf Völkerschauen in Europa ausgestellt wurde und dann, nachdem sie in Paris gestorben war, der Wissenschaft diente.
Kein geringerer als der Begründer der Rassenanatomie George Cuvier, der eine Skala vom „geistig schwerfälligen Neger“ bis zum „innovativen“ weißen Europäer aufstellte, erwarb ihre Leiche – nicht zuletzt wegen ihres sensationell ausladenden Hinterteils und ihrer an den Beinen herunterhängenden Schamlippen. Letztere präsentierte er während eines Vortrags stolz in Spiritus konserviert: „Ich habe die Ehre,“ so schloß Cuvier seine Rede, „der Akademie der Wissenschaften die Genitalien dieser Frau anzubieten“. 2002 wurden Saras Überreste – Skelett, Geschlechtsteile und Gehirn – an Südafrika zurückgegeben und beigesetzt.
.
Leserbrief:
Müssen Sie immer so scheußliche Anekdoten veröffentlichen? Die taz ist doch sonst so durchweg positiv geworden. Sie tun ihr damit keinen Gefallen.
E.P. Berlin
.
.
.
17. Aus Scheiße Rosinen machen
„Die Exkremente der Konsumtion sind am wichtigsten für die Agrikultur.“ (K.Marx)
„Die Düngestoffe des Menschen, der überwiegend auf große Städte konzentriert ist, werden verbrannt, vernichtet, besonders aber durch Kanäle und Flüsse fortgespült,“ schrieb der Biosoph Ernst Fuhrmann 1912 in einer kleinen Schrift über die Menschen und ihre Scheiße. Damals wurden in Berlin die Abwässer in Kanäle geleitet und über 12 Pumpwerke auf Rieselfelder vor der Stadt verteilt, deren Wälle und Gräben man noch heute sieht. Sie wurden nach einer gewissen Zeit abschnittsweise bewirtschaftet – u.a. baute man dort Gemüse an. Fuhrmann erwähnt die damalige Kritik an dieser Form der Entsorgung: Die Pflanzen würden schlecht gedeihen und schlecht schmecken. Er gibt jedoch zu bedenken, dass dieses Verfahren noch keine Umwandlung von Dung in Humus ist. Als die Nazis die Schrift des inzwischen exilierten Autors raubdruckten, zeigten sie darin bereits den Fortschritt: einen Aufriß des 1931 gebauten Berliner Klärwerks in Stahnsdorf, das es noch heute gibt. Von den sechs Klärwerken der Stadt besitzt jedoch keine eine „Klärschlammvererdungsanlage“, so dass die Trockenmasse in den Faultürmen, wo sie zunächst mit bakterieller Hilfe Methan freisetzt, am Ende verbrannt wird, somit jedoch noch mal Strom liefert. Die Klärwerke decken dadurch zwar 50% ihres Eigenbedarfs, aber Humus wird aus der Scheiße nicht. Man sagt, dass sei auch nicht erwünscht, denn der Klärschlamm enthalte Schwermetalle, Medikamentenrückstände, unliebsame Keime...Neuerdings hat man sogar Gold darin entdeckt. Eine EU-Verordnung besagt: Wenn die Klärschlämme hinsichtlich des Schadstoffgehalts die Vorschriften erfüllen und hinsichtlich der Nährstoffgehalte den Vorgaben der Düngemittelverordnung entsprechen, dürfen sie auf die Äcker gebracht werden, auf Grünland und Gemüseanbauflächen dagegen nicht.
90 Prozent der weltweit anfallenden Scheiße wird ungeklärt in Gewässer geleitet. Allein in Indien sind das 26 Milliarden Liter täglich. Hinzu kommt noch, dass dort der wertvolle Kuhdung zum Heizen verwendet wird: 2 Millionen Tonnen täglich. Bis zu ihrer Elektrifizierung wurde im übrigen auch auf den friesischen Halligen mit getrockneten Kuhfladen (Ditten) geheizt.
Anders in China, Korea und Japan. Diese drei Agrarländer, deren Bevölkerung sich weitgehend vegetarisch ernährt, wandeln seit Jahrtausenden ihre Fäkalien wertschöpfend in „Muttererde“ um. Bis zur Revolution gab es in China Leute, die den Städten für viel Geld ihre Fäkalien abkauften. Sie wurden u.a. portionsweise auf Märkten verkauft. Auch auf dem Land wurde jeder Scheißhaufen aufgesammelt. Landarbeiter mußten sich verpflichten, die Latrine des Gutsbesitzers zu benutzen. „80 Jahre später hat sich nicht viel geändert,“ schreibt Werner Pieper in seinem umfangreichen „Scheiss-Buch“ (1987). Anfang der Fünfzigerjahre entstanden dort die ersten Biogasanlagen auf Basis von Fäkalien. Während der Kulturrevolution übernahmen „freiwillige Brigaden“ Transport und Verteilung. Wissenschaftler, die man damals aufs Land schickte, wurden von den Kommunen gelegentlich zum Scheiße sammeln auf den Landstrassen eingesetzt – eine Tätigkeit, die viele als besonders demütigend ansahen, was die Bauern als arrogant empfanden: Wer den Wert dieses kostbaren Düngers zu schätzen weiß, dem stinkt er nicht! Früher war der Landwirt mit dem größten Misthaufen auch hier noch stolz darauf, jetzt zwingen ihn die aufs Land gezogenen Städter, den Mist wegen des Gestanks und der Fliegen aufs Feld zu lagern. In Berlin regt man sich ewig über Hundescheiße auf.
Die modernen Bürger zahlen immer mehr für die Entsorgung ihrer Exkremente, schreibt der Berliner Autor Florian Werner in seiner „Geschichte der Scheiße: Dunkle Materie“ (2011): „Scham und Ekelgefühle setzten sich gegenüber den Geldinteressen durch – ein in der Geschichte der westlichen Zivilisation vielleicht einmaliger Vorgang.“ Dabei wußte man schon in der Antike, das der „Menschenkot“ ein hervorragender Dünger ist. Mit der Renaissance wurden dann auch her erneut Fäkalien zur Bodenverbesserung eingesetzt. Noch im 19. Jahrhundert versteigerte die Stadt Karlsruhe laut Werner ihre Fäkalien meistbietend an die örtlichen Landwirte. Pferdemist wurde auch später noch von Schrebergärtnern hoch geschätzt – aber dann verschwandn auch die letzten Brauereipferde.
In den USA war der Humusverlust in der industrialisierten Landwirtschaft und mit Rodung des Präriegrases um die Jahrhundertwende so weit fortgeschritten, dass die Bodenkundler des Landwirtschaftsministeriums 1909 eine Forschungsreise nach China, Korea und Japan unternahmen. Der Bericht ihres Leiters Franklin H. King: „4000 Jahre Landbau“ (er wurde auf Deutsch zuletzt 1984 veröffentlicht) ist inzwischen ein Klassiker: Die Autoren geben darin ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die amerikanische Landwirtschaft unbedingt von der in diesen Ländern praktizierten lernen muß: „In Amerika verbrennen wir ungeheure Mengen Stroh und Maisstrünke: weg damit! Kein Gedanke daran, dass damit wertvolle Pflanzennährstoffe in alle Winde zerstreut werden. Leichtsinnige Verschwendung bei uns, dagegen Fleiß und Bedächtigkeit, ja fast Ehrfurcht dort beim Sparen und Bewahren.“ Noch mehr gilt das für den Umgang mit Fäkalien. Er wird auf Schiffen zusammen mit Schlamm aus Kanälen transportiert, an Land gelagert, dann in Gruben an den Äckern geschüttet, wobei man dazwischen Lagen mit geschnittenem Klee packt und „das Ganze immer wieder mit Kanalwasser ansättigt. Dies läßt man nun 20 oder 30 Tage fermentieren, dann wird das mit Schlamm vergorene Material über den Acker verteilt.“ Die US-Agrarforscher halten die „landbaulichen Verfahren“ der Chinesen, Koreaner und Japaner, mit denen sie „jahrhundertelang, praktisch lückenlos, alle Abfälle gesammelt und in bewundernswerter Art zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erzeugung von Nahrungsmitteln verwertet haben, für die bedeutendste Leistung der drei Kulturvölker.“ Wenn man sie studieren will, „dann muß man auf das achten, was uns die Hauptsache zu sein scheint, dass nämlich unter den Bauern, die die dortigen dichten Bevölkerungen jetzt ernähren und früher ernährt haben, richtiges, klares und hartes Denken Brauch ist.“
Daran mangelt es hierzulande den letzten Hightech-Bauern anscheinend: Allein in Deutschland gehen in der Landwirtschaft im Durchschnitt pro Jahr und Hektar zehn Tonnen fruchtbarer Boden durch Erosion und Humusabbau verloren. Dem gegenüber steht ein jährlicher natürlicher Bodenzuwachs von nur etwa einer halben Tonne pro Hektar. Der Boden wird also rund 20-mal schneller zerstört, als er nachwächst, warnte die Naturschutzorganisation WWF zum Start des internationalen UN-„Jahr der Böden 2015“. Insgesamt gehen der deutschen Landwirtschaft damit 120 Millionen Tonnen fruchtbarer Boden pro Jahr verloren. Weltweit sind es mehr als 24 Milliarden Tonnen, die jährlich durch Erosion abgetragen werden.
Mancher Bauer denkt, Kuhdung statt Kunstdünger wäre schon Bio – der kurze Weg vom Dung zum Erhabenen. Zur „Humifizierung“ biologischer Abfälle gehört jedoch weitaus mehr, wie der Bodenforscher Siegfried Lübke im Vorwort zum „Handbuch des Bodenlebens“ der Mikrobiologin Annie Francé-Harrar meint; er erwähnt darin sein Entsetzen, „als 2003 eine Praktikantin berichtete, wie sie von dem Bodenleben ihrem landwirtschaftlichen Lehrer erzählte. Daraufhin schnauzte der sie an: ‚Was? Bakterien, was haben denn die im Boden zu tun?'“
Annie Francé-Harrar veröffentlichte ihre Forschungen über Bodenorganismen bereits in den Zwanzigerjahren. Neben einem „Handbuch des Bodenlebens“ publizierte sie 1950 „Die letzte Chance – für eine Zukunft ohne Not“. Beide Bücher wurden 2011 von der „Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität“ neu herausgegeben (letzteres kann man sich kostenlos runterladen). „Die letzte Chance“ – damit meint die Autorin: Wenn wir nicht schleunigst den Wald retten und die Humusschicht auf unseren Böden verbessern, dann ist es um das Leben auf der Erde geschehen: „Wir, unsere ganze Generation, stehen vor einem Abgrund, denn Humus war und ist nicht nur der Urernährer der ganzen Welt, sondern auch der alles Irdische umfassende Lebensraum, auf den alles Lebende angewiesen ist.“ Um den Humus zu erhalten, müssen wir die Mikroorganismen im Boden, die ihn schaffen und von denen die Pflanzen abhängen, von denen wiederum wir abhängen, studieren und kennen, um sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und nicht – wie jetzt noch – permanent behindern: „Seit Jahrhunderten haben wir unsere Böden kaputt gemacht.“
Während die Mikrobiologin die Ursache des zunehmenden Humusverlustes vor allem im Rückgang der Wälder und der damit zusammenhängenden Bodenerosion sah, hält die Tierärztin Anita Idel die Reduzierung von Weideland und damit die Zerstörung der Verbindung (der „Ko-Evolution“) von Gras und Wiederkäuer für die Ursache. Ein Schutz der Graslandschaften – Steppen, Savannen, Prärien, Tundren und Pampas – durch nachhaltige Beweidung erhalte deren noch weltweit größte CO2-Speicherkapazität und trage wesentlich zur Humusbildung bei, schreibt sie in ihrem Buch „Kühe sind keine Klimakiller“ (2010).
In China handelt man dem zwar zuwider, indem man sich heute bemüht, die Viehzucht zu industrialisieren, aber bei der Wiederaufforstung liegt das Land vorne: „Bei dem seit Mitte der 70er Jahre laufenden Programm wurden bereits Bäume auf einer Fläche entsprechend der von Großbritannien angepflanzt,“ meldete das Wissenschaftsmagazin „spektrum“. Das „waldwissen.net“ ergänzte: „Infolgedessen steigt die Waldfläche Chinas derzeit jährlich um 2,8 Millionen Hektar an.“
Im Westen weiß man seit Homer, dass und wie Arkadiens Wälder für den Schiffsbau vernichtet wurden. 400 Jahre später beschrieb Platon in seinem „Kritias“ die Folgen: durch Erosion und Humusschwund „übriggeblieben sind nun im Vergleich zu einst nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fort geflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb.“ Als Immer-noch-Griechen bekümmern wir uns lieber um den eigenen Körper: „Feuchtgebiete“ nannte Charlotte Roche ihren Roman, der u.a. von Analerotik und Exkrementophilie handelt; „Darm mit Charme“ hieß 2014 ein Bestseller von Giulia Enders, in dem es darum geht, dass der halbe Kreislauf vom Essen zur Scheisse funktioniert, die andere Hälfte, der unterbrochene Kreislauf von der Scheisse zum Essen, bleibt gewissermaßen außen vor. Daran hat auch Bunuel-Film „Das Gespenst der Freiheit“ (1974) nichts ändern können, in dem man schon mal gemeinsam scheisst, sich zum Essen aber auf ein „stilles Örtchen“ zurückzieht.
.
Leserinfo:
„
Ein Viertel der globalen Landoberfläche ist bereits durch menschliche Tätigkeit zerstört worden. Wie aus Untersuchungen des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam hervorgeht, gehen jährlich 24 Milliarden Tonnen Boden durch Erosion verloren. Daneben wird viel Boden durch den Bau von Häusern und Straßen vernichtet.
Europa sei von der Erosions-Problematik nicht ausgenommen, betonte IASS-Direktor Klaus Töpfer. Vom 27. bis 31. Oktober soll eine internationale Konferenz in Berlin Lösungswege suchen.“ (klimaretter.info)
.
Maulwurf – unter Bodenverlust leidend (Photo: Knofo)
.
.
18. Regenwürmer I
Ich wußte gar nicht, dass der Regenwurm ein so wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und immer wichtiger wird. Bis ins 19. Jahrhundert galt er als Schädling der Kulturpflanzen – und wurde vernichtet. Dabei besitzt er gar keine Mundwerkzeuge, um Pflanzenwurzeln abbeißen zu können. Der Biologe Jakob von Uexküll hat – wenig überzeugend – versucht, das Weltbild dieses Zwitters zu erahnen. Desungeachtet wissen wir inzwischen, dass ohne den Wurm in puncto Bodenfruchtbarkeit gar nichts geht – in der Erde. Er zieht organische Abfallstoffe in sich rein und scheißt quasi reinen Humus aus. Dieser wird dann nur noch von einigen Mikroorganismen vervollkommnet. Der Humus ist für uns lebenswichtig – er wird jedoch durch falsche Bodenbehandlung – chemische Düngung, Pestizide, Tiefpflügen, Umpflügen im Winter – immer weniger. „Allein in Deutschland gehen in der Landwirtschaft im Durchschnitt pro Jahr und Hektar zehn Tonnen fruchtbarer Boden durch Erosion und Humusabbau verloren. Dem gegenüber steht ein jährlicher natürlicher Bodenzuwachs von nur etwa einer halben Tonne pro Hektar. Der Boden wird also rund 20-mal schneller zerstört, als er nachwächst,“ warnte die Naturschutzorganisation WWF zum Start des internationalen UN-„Jahres der Böden 2015“.
Der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer eröffnete jüngst als Leiter des „Potsdamer Institute for Advanced Sustainibility Studies“ (IASS) eine „Globale Bodenwoche“, in deren Rahmen Bodenaufklärerisches und Kunst im Kreuzberger Park am Gleisdreieck geboten wurde. Auch der Regenwurm wurde dort gewürdigt. Er kann bis zu acht Jahre alt werden. In Deutschland leben 46 Arten. Wurm is also nicht gleich Wurm – vor allem, wenn man ihn in die kapitalistische Produktion einführt. Als direkter Wirtschaftsfaktor dient er u.a. den Anglern – als Köder. Sie ebenso wie die Kleingärtner, die damit ihre Böden verbessern, bevorzugen den „Tennessee Wiggler“, der hierzulande gezüchtet wird. Massenhaft beziehen Forschungsfirmen und Universitäten Regenwürmer für ihre Lehrveranstaltungen und Laborversuche. In der Umweltforschung und in der Medizin dient er als „Testorganismus“. Und auch an den Gymnasien gibt es zunehmend eine „Regenwurmforschung“. Wenn Klärwerke sich eine „Klärschlammvererdungsanlage“ leisten, brauchen sie ebenfalls viele Regenwürmer. Deren Produkt, die aus den Abwässern gewonnene Erde, wird an Landwirte verkauft. Eine EU-Verordnung besagt: „Wenn die Klärschlämme hinsichtlich des Schadstoffgehalts die Vorschriften erfüllen und hinsichtlich der Nährstoffgehalte den Vorgaben der Düngemittelverordnung entsprechen, dürfen sie auf die Äcker gebracht werden, auf Grünland und Gemüseanbauflächen dagegen nicht.“ Daneben arbeiten hier und da auch die Forstämter mit Regenwürmen (und Kalk), um Waldböden zu verbessern. Und schließlich werden die Würmer, da fast zur Gänze aus Proteinen, Fett und Kohlehydrate bestehend, als Viehfutter genutzt, zusammen mit weniger nahrhaftem Fischmehl. Dieses Futter darf seit dem „BSE-Skandal“ nicht an Wiederkäuer verfüttert werden, jedoch an Fische, Muscheln und Krebse in „Aquakulturen“, von denen es immer mehr gibt, seitdem die Meere leergefischt und die Flüsse „umgekippt“ sind. Agrarforscher raten den Milchbauern, sie sollen sich mit einer Aquakultur ein zweites Standbein schaffen – auf dem Rücken der Regenwürmer! Dabei hat dieser „Wirbellose“ gar keinen Rücken, sondern einen Hautmuskelschlauch.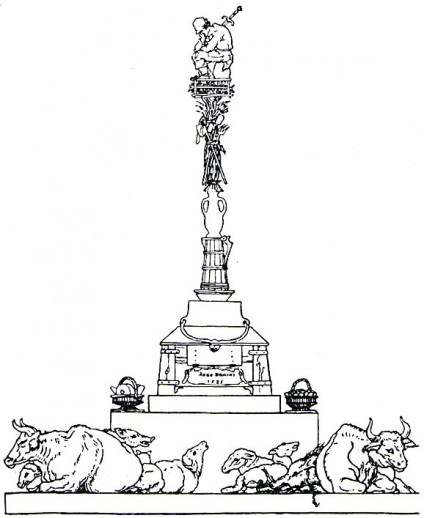
„Einen florierenden Wurmmarkt wie in Amerika, wo es Regenwurmzüchter gibt, die z.T. 10 Millionen und mehr Würmer pro Tag produzieren, gibt es bei uns jedoch noch nicht,“ schreibt der Biologe Walter Buch in seinem Standardwerk „Der Regenwurm“ (1986). Im Schöneberger Naturpark „Südgelände“ betreibt eine Schauspielerin, die sich Fräulein Brehms Tierleben nennt, „das einzige Theater weltweit für gefährdete Tierarten“. Ganz besonders hat es ihr dabei der Regenwurm (Lumbricus terrestris) angetan. Dass er noch immer oder schon wieder „gefährdet“ ist, war mir neu.
.
Regenwürmer II
Seit Darwins Regenwurmforschung, die er 1881 als letztes seiner Werke unter dem Titel „Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer“ veröffentlichte, wird vielerorts über diesen Wurm geforscht. Weltweit gibt es rund 3500 Regenwurmarten.
Bayrische Biologen meinen, der Regenwurm sei gut gegen Hochwasser, weil er die die Deiche wasserdurchlässiger macht; während US-Klimaforscher behaupten, dass seine Wühltätigkeit Treibhausgase im Boden freisetzt. Wiener Pedologen gehen davon aus, dass Regenwürmer den Pflanzen helfen, sich gegen die sich ausbreitenden Spanischen Wegschnecken zu schützen; und chinesische Forstangestellte entdeckten in der Provinz Yunnan Regenwürmer, die einen halben Meter lang werden. Umgekehrt fand man im Nationalpark Great Smoky Mountain zwei eingewanderte chinesische Regenwurmarten: Amynthas agrestis und Amynthas cortisis. Diese sind nun dabei, die Bodenbeschaffenheit und in der Folge die Zusammensetzung der Vegetation nachhaltig zu verändern, was von einigen US-Wurmpezialisten derzeit genauer erforscht wird.
Mit der Öko-Bewegung wird daneben auch das Geschäft mit Regenwürmern immer lohnender: Die Süddeutsche Zeitung porträtierte gerade die Firma „Superwurm“ des Ehepaars Langhoff in Düren, das Lebendwürmer – 10 Tonnen im Jahr – über das Internet verkauft – an Angler und Gartenbesitzer.
In diversen Internetforen wird währenddessen immer noch der uralten „Jugend-Forscht“-Frage nachgegangen, ob aus einem halbierten Regenwurm zwei ganze werden können.
Die Frager verwechseln Regenwürmer mit Plattwürmern. Kürzlich berichtete Jochen Rink vom Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik: „Wir können den Plattwurm – Schmidtea mediterranea – in 200 Teile zerschneiden, und aus jedem Schnipsel wächst wieder ein neuer Wurm“. Ein naher Verwandter, der Milchweiße Strudelwurm dagegen (Dendrocoelum lacteum) muss bei dieser Fähigkeit passen – zumindest wenn es um seine hintere Körperhälfte geht. Aus seinem Schwanzbereich wachsen einfach keine neuen Köpfe und die Wurmhälfte geht zugrunde. Um den Unterschied zwischen den Würmern herauszufinden, verglichen die Forscher ihre Genaktivität. Dann hemmten sie die Wirkung eines Proteins (ß-Catenin), das durch einen bestimmten Signalweg aktiviert wird. Schon wuchs aus der abgeschnittenen Schwanzspitze des Strudelwurms innerhalb von 21 Tagen ein neuer Kopf. Der Regenerationsdefekt habe sich einfach beheben lassen. „Wir dachten, wir müssten Hunderte Hebel in Bewegung setzen, um Regenerationsfähigkeit zu beeinflussen“, sagt Rink. „Nun haben wir gelernt, dass wenige Schaltstellen reichen, an denen man ansetzen muss.“
Der Biologe und Journalist Fredrik Sjöberg hat dem schwedischen Regenwurmforscher Gustaf Eisen (1847 – 1940) ein ganzes Buch, mit vielen interessanten Abschweifungen, gewidmet: „Der Rosinenkönig“.
.
Lesermail:
Danke, dass Du das Theater von Fräulein Brehms Tierleben erwähnst, auf dem letzten taz-Kongreß hat sie eines der schönsten Vorträge gehalten. Mein Mann, meine Kinder und ich waren begeistert. Leider ist er in dem Zelt auf dem Dach vom Haus der Kulturen der Welt etwas untergegangen. Sonja Dolittle, Marzahn
.
Regenwurm, der sich ein Blatt in die Erde zieht (Zeichnung: cosmiq.de)
.
.
19. Gentrifizierung aus der Luft
Seit dem „Fall der Mauer“ gibt es immer mehr Krähen in Berlin, dazu einige Turmfalken, Bussarde und Eulenvögel. Vor allem die Krähen haben die Tauben dezimiert: Man sieht kaum noch verletzte oder kranke. Jahrzehntelang hat man sie als „Plage“ bekämpft: Mit Verunglimpfungen, heimlichen Erschießungen und Vergiftungen, mit Nesträubereien, Gipseiern im Gelege, mit Drahtnetzen, Seilsystemen und „Taubenabwehrspikes“. Es gibt immer noch einige „Taubenabwehrshops“ in der Stadt, aber die „Taubenplage“ ist eigentlich kein Thema mehr, obwohl die tierschutzpolitischen Sprecher der Senatsfraktionen sie noch auf der Tagesordnung haben. Wenn die Krähen sich weiter so schnell ausbreiten, wird man sich noch Taubenschutzmaßnahmen überlegen müssen (oder die Krähenpopulation eindämmen – wie es die Bürger in einigen Städten und Dörfern Schleswig-Holsteins fordern).
Die „Stadt-“ oder „Straßentaube“ stammt von verwilderten „Haus-“ und „Brieftauben“ ab. Diese wurden einst aus der „Felsentaube“ gezüchtet, die an und auf den Klippen des Mittelmeeres lebt, sich aber durch Vermischung mit den Stadttauben fast über die ganze Erde ausbreitete. Daneben halten sich auch noch die scheuen Türkentauben – vor allem in Waldstreifen auf dem Land und in den Gärten am Stadtrand. Um diese Jahreszeit hört man hier und da das ausdauernd wiederhiolte „HuHuuuHuh“ der Männchen. In der Türkei lebten die Türkentauben vorwiegend von gebrochenem Mais. Als der auch in Nordeuropa geschätzt wurde, folgten sie den Eisenbahnschienen – und auf einmal waren sie da. Aber seitdem hier nur noch Silomais angebaut wird, müssen sie wieder zurück oder sich auf andere Nahrung umstellen. Ähnliches gilt für die immer seltener werdende Turteltaube, sie ist schlanker und gurrt nicht, sondern schnarrt eher. Den Menschen ist sie ein Glücks- und Liebessymbol“. So wie auch die speziell gezüchteten weißen Tauben, die zu bestimmten Events, wie z.B. Papstwahlen, „aufgelassen“ werden. In Berlin werden sie als „Hochzeitstauben“ angeboten, um statt der Braut jubelnd frei gelassen zu werden. Im Ostblock, der auf Bürgerkrieg und Klassenkampf statt auf Vernichtungs- und Eroberungskriege abonniert war, züchtete man sie massenhaft als „Friedenstauben“, die selbst bei Truppenparaden in Massen „aufgelassen“ wurden.
Neben den Flamingos sind die körnerfressenden Tauben für die Aufsucht ihrer Jungen nicht auf tierisches Eiweiß angewiesen, denn sie füttern sie mit „Kropfmilch“ (ein fettiges Sekret aus abgelösten Epithelzellen). Deswegen sind die fast mücken- und fliegenfreien Städte, die zudem wie Felsen aufragen und mit Imbißbuden durchsetzt sind, ideal für sie. Außerdem ist es dort wärmer als auf dem Land und auch nach Sonnenuntergang noch hell. Besonders in den gut beleuchteten Bahnhöfen treiben sie sich oft noch abends herum, sogar auf den untersten Bahnsteigen suchen sie zusammen mit Spatzen nach Brotkrümeln. Da trauen sich die Krähen (noch?) nicht hin, die Raubvögel erst recht nicht. Ihre Scheiße hinterläßt dort weiße Flecken – auch das nimmt die hygienisch überzüchteten Städter gegen sie ein.
Der in Berlin lebende japanische Philosoph Makoto Ozaki fand auf der Fußmatte vor der Tür seiner Wohnung im dritten Stock eine junge Taube – just an dem Tag, an dem er seinen Job an der Freien Universität verloren und seine Freundin ihn verlassen hatte. Das Täubchen schützte ihn vor der Verzweiflung – und er sie vor dem Hungertod. Es forderte viel Aufmerksamkeit und machte viel Dreck. Flügge geworden ließ er es aus dem Toilettenfenster frei. Es war ein Täuberich – er kam immer wieder zu Ozaki zurück. Im darauffolgenden Frühjahr mit einer Taube. Diese brütete dann auf einer kleinen Zwischendecke in der Toilette. Bald flogen mehrere Tauben bei Ozaki ein und aus. Die Toilette blieb jedoch Felsenhöhle seines Täuberichs.
Der Philosoph hatte ein Buch über „Dressur“ („Artikulationen“, Merve Berlin 1981) veröffentlicht – und deswegen einen Ruf zu verlieren, so dass er nicht gleich klein beigab, als sein Hausbesitzer ihm das Halten von Tauben („fliegende Ratten“) verbot. Als ihm zuletzt eine Kündigung drohte, mußte er jedoch einlenken – und sich von seinem Lebensretter auf Gegenseitigkeit trennen: indem er das Toilettenfenster verschloss. Eine traurige Taubengeschichte. Eine lustige erlebte ich neulich im Kaufhof. Ein Kunde nervte alle Verkäuferinnen mit einem ausgefallenen Mantel-Wunsch. Ich entschied mich schneller und ging vor die Tür, um eine zu rauchen. Als der Mann rauskam, hatte er den neuen Mantel an. Es dauerte keine Minute, da schiß ihm eine Taube auf die Schulter. Er fluchte und versuchte den Dreck weg zu wischen, aber ich wußte, dass der Fleck nicht mal in der Reinigung weg geht.
.
Leserbrief:
Dadurch dass die Tauben in der Stadt weniger werden, ändert sich – mindestens in Berlin – auch langsam der Umgang der Menschen mit ihnen. Neulich sah ich in Friedrichshain wie ein junger Mann und seine Freundin eine verletzte Taube fingen, sie in ein T-Shirt wickelten und mit zu sich nach Hause nahmen, um sie gesund zu pflegen, wie sie sagten. Mathias Erbe, Friedrichshain
.
Stadttaube (Photo: tierheim-ladeburg.de)
.
.
20. Naturnachrichten
1. Eine Beobachtung der Biologin Sarah Papworth und ihrer Kollegin vom Imperial College in Berkshire: Die beiden erforschten Wollaffen im südamerikanischen Regenwald. Dabei entdeckten sie, dass diese Tiere mittlerweile zwischen Wollaffen-Jägern und Wollaffen-Forschern unterscheiden können: Wenn sie die ersteren sehen, „gefährlich“, verstecken sich die Wollaffen ängstlich und still in den Baumkronen, bei den letzteren bleiben sie dagegen cool – „harmlos“. Die ersteren erkennen sie meist schon an ihren langen Pfeilrohren, die sich mit sich tragen, während letztere mit Filmkameras, Klemmblocks und Feldstecher ausgerüstet sind. Es kann aber auch sein, dass sie solche Unterscheidung im konkreten Fall noch mit einer zweiten vervollständigt haben: Erstere sind meist dunkelhaarige und -häutige Männer, letztere dagegen hellhaarige und -häutige Frauen. So sehe ich das jedenfalls, nachdem ich mir das Photo der englischen Wollaffenforscherin im Internet angekuckt habe, wobei ich stillschweigend davon ausging, dass ihre unbenamt gebliebene Kollegin nicht viel anders aussieht.
.
2. Im März 1917 meldete das Berliner Tageblatt des Mosse-Verlags, dass sich – kriegsbedingt – die Schwierigkeit ergab, die für die Zeitungsherstellung „nötigen Papiermassen“ täglich heranzuschaffen, deswegen habe man mit Herrn Hagenbeck ein „Abkommen“ getroffen, „wonach er uns vier seiner Elefanten mit den dazugehörigen indischen Führern zur Verfügung stellt.“ Und das hat dann auch sehr gut geklappt: „Die Elefanten haben ihren Dienst brav und fleißig verrichtet – und mehrere mit Papierrollen hoch bepackte Wagen vom Anhalter Bahnhof zu unserer Druckerei gebracht, was in den Straßen natürlich sehr viel Aufsehen und Interesse erregte.“ Karl Kraus fügte dieser Meldung im nämlichen Monat einen Kommentar hinzu: „Urwälder werden kahl geschlagen, damit der Geist der Menschheit zu Papier werde, und die obdachlosen Elefanten führen es ihr zu. Bei Goethe! Es ist der Augenblick, aus einer Parodie wieder ein großes Gedicht des Abschieds zu machen.“ Kraus bezieht sich dabei auf ein zuvor im „Berliner Tageblatt“ abgedrucktes Kriegsgedicht von Ludwig Riecker (München), das unter dem Titel „Lied des englischen Kapitäns“ den deutschen „U-Boot-Krieg“ thematisierte: „Unter allen Wassern ist – ‚U‘ Von Englands Flotte spürest du Kaum einen Hauch... Mein Schiff ward versenkt, daß es knallte – Warte nur, balde Versinkt deins auch!“
.
.
.
Kolonialdenkmal in Bremen
.
.
.
3. In der FAS von heute findet sich auf der Seite „Zur Zeit“ ein Interview mit dem Vorsitzenden des Berufsverbandes der Hundepsychologen, Thomas Riepe, in dem es um „Agility“ für Hunde geht, d.h. für den Hundepsychologen, dass der moderne Stadthund ebenso wie die Kinder von Termin zu Termin gehetzt, „gestresst“, wird, er hat auch einen richtigen „Terminkalender“. Es wäre jedoch besser, so Thomas Riepe, „wenn Hunde einen ganz normalen Tagesablauf hätten. Ich habe Straßenhunde in Indien und Afrika beobachtet, Wölfe und Wildhunde, und die führten eigentlich alle das gleiche Leben...In erster Linie durchwandern die ihr Revier. Sie hetzen nicht herum, wie wir ihnen das aufzwingen, wenn wir sie z.B. ans Fahrrad hängen. Sie schnüffeln. Das Gehirn wird stark angestrengt, gar nicht mal so der Körper....Mit den Hunden Agility machen wir, weil wir uns wohl fühlen wollen auf Kosten des Hundes. Der Hund hat das Problem, dass er bei uns lebt. Wir pushen ihn ständig...Dabei möchte der Hund ein gemütliches Leben haben...“ (Interessanter Gedanke!)
.
4. Das Naturkundemuseum teilt mit: „Die Spinne, die vorgestern in Berlin eine Blumenverkäuferin gebissen und für große Aufregung gesorgt hat, wurde heute vom Spinnen-Experten des Berliner Naturkundemuseums, Dr. Jason Dunlop, beurteilt. Es handelt sich nicht (wie ursprünglich gedacht) um eine Riesenkrabbenspinne, sondern höchstwahrscheinlich um einen Vertreter der sogenannten Raubspinnen (Pisauridae). Diese Raubspinnen kommen normalerweise nicht in Deutschland vor so dass die Vermutung nahe liegt, dass es sich hier um eine Tropische Art aus Kenia oder Paraguay handelt, den Ländern, aus denen die Blumen bezogen wurden. Das Tier hat eine Körperlänge von ca. 1,5 cm und eine Beinspanne von ca. 5 cm, also insgesamt einen Durchmesser von 6,5 cm. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen werden erfolgen, um das Tier näher zu bestimmen. Weltweit gibt es ca. 500 Arten von Raubspinnen, unter anderem einige Vertreter hier in Deutschland. Obwohl fast alle Spinnen Gift haben, sind Raubspinnen nicht für Menschen gefährlich.“
.
5. Frieder vom Buchladen Schwarze Risse teilte mir mit: Er habe da ein sonderbares Buch, das mich vielleicht interessiert: Die Biographie einer Weißen, die als Fünfjährige in den amazonischen Dschungel entführt und ausgesetzt wurde. Sie überlebte dank einer Kapuziner-Affen-Horde, der sie sich immer mehr anschloß, auch sprachlich und körperlich, d.h. sie lernte auch, bei Gefahr auf Bäume zu klettern. Einer Indianer-Horde in der Nähe schloß sie sich nicht an. Schließlich landete sie als Putzfrau mit 11 in einem Bordell, geriet dann als Putzfrau in eine Familie und lebte danach als Straßenkind in einer Kleinstadt-Gang. Kam ins Kloster – und von da aus nach Bogota, wo das Buch endet. Aus den Photos im Buch erkennt man jedoch, dass sie dann einen Engländer heiratete und mit ihm in England zwei Kinder bekam, von denen eins inzwischen selbst ein Kind hat. Ihr jüngste Tochter hat sich ihr Leben auf Tonband sprechen lassen und eine englische Ghostwriterin hat das Material zu einem Buch verarbeitet, das soeben bei Rowohlt erschien. Ein seltsames Buch, um das mindeste zu sagen, ich habe heute nacht drin gelesen: Marina Chapman: „Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam. Eine Kindheit unter Affen“. Auf Youtube gibt es einen 5-Minuten-Clip über sie: „Woman Claims She Was Raised By Monkeys“ Die Huffington Post schreibt: „While the story sounds almost unreal, cases of ‚feral children‘ raised by animals have been reported before with orphan John Ssabunnya claiming he was raised by monkeys in Africa.“
.
6. Die FAZ berichtete 2012 über den „Wolfsmann“ Marcos Pantoja: Er hat als Kind unter Wölfen gelebt, zwölf Jahre lang. Aber später haben ihm die Menschen seine Geschichte nicht geglaubt. Ein Kinofilm sollte ihn rehabilitieren. Spuren lesen, Bienenwaben plündern, Rebhühner fangen – Marcos war als achtjähriger Junge auf sich gestellt, in der Wildnis. Im Spanien der Fünfziger Jahre – unter Diktator Franco – gab es noch die Leibeigenschaft, und teilweise mussten die Eltern ihre Kinder verkaufen. Wie Marcos sollen in Spanien über 100 Kinder aus der Zeit verwildert gewesen sein. Heute ist Marcos 65 und im Sommer ist ein Film über sein Leben erschienen. Weil sie ihm nie geglaubt hatten, haben sich inzwischen einige Nachbarn bei Marcos entschuldigen müssen. Die Welt läßt ihn selbst zu Wort kommen: „Eines Tages habe ich diesen kleinen Wolf gesehen. Ich näherte mich ihm, weil ich dachte, er sei ein Hund. Ich wollte mit ihm spielen.“ Von da ab wird „Lobito“, der kleine Wolf, Marcos‘ treuester Begleiter. Doch Lobito gehört zu seinem Rudel, und die Mutter wacht über ihr Junges, sie ist eine Gefahr für das Menschenkind. „Ich bin Lobito in eine Höhle gefolgt. Plötzlich kam die Wölfin hinein. Sie schlug mit einer Tatze nach mir, ich flüchtete mich in den hintersten Winkel. Dann kam sie wieder näher, in ihrer Schnauze ein Stück Fleisch, ich hatte riesige Angst. Doch sie ließ die Beute vor mich fallen, ich stopfte mir ein Stück in den Mund. Sie kam noch näher – und plötzlich begann sie, mein Gesicht abzulecken. So war ich mit einem Mal Teil des Wolfsrudels.“
Marcos jagt mit den Wölfen, er spielt mit ihnen, schläft bei ihnen, heult mit ihnen. „Wenn ich in Gefahr war, kamen sie und holten mich.“ Er stößt dreimal nacheinander ein kurzes, sirenenartiges Wolfsgeheul aus. „Das bedeutet Gefahr“, erklärt er. Angst, sagt er noch einmal, kannte er nicht. „Nur vor dem Wildschwein muss man sich fürchten. Es hat keine Freunde, und darum ist es unberechenbar.“ Mit seinen Wölfen jagt Marcos sogar Rehe und Hirsche. Die Wölfe treiben das Wild auf den Fluss zu, bis das Tier panikartig in das tiefe Wasser springt, wo Marcos darauf wartet, es mit einem Messer zu töten. Aus dem Fell macht sich „El Salvaje de la Sierra Morena“, der „Wilde aus der Sierra Morena“, wie man ihn später nennen wird, Fellumhänge. „Das war auch ein Grund, warum die Wölfe mich akzeptierten: Ich roch nicht mehr wie ein Mensch, in dessen Kleidern der Schweiß hängt.“ Nach so vielen Jahren unter Wölfen, die Haut sonnengegerbt, das Haar bis zu den Hüften und der eigenen Sprache kaum noch mächtig, wusste Marcos selbst nicht mehr, was er war. „Ich wusste nur, dass ich anders war als die Wölfe. Und sie wussten es auch, weil ich Sachen machen konnte, die sie nicht konnten.“ Er war glücklich in der Sierra. Aber der Guardia Civil, Francos kasernierter Volkspolizei, gefiel der wilde Mann in den Bergen nicht. „Eines Tages, ich hatte gerade gut gegessen, schrien meine Vögel. Das taten sie immer, wenn Gefahr drohte. Ich versuchte wegzulaufen – aber die Polizisten schossen auf mich, schlugen mich nieder. Mit Handschellen, geknebelt, an ein Pferd gefesselt, schleppten die Polizisten mich ins Dorf, nach Fuencaliente.“
Die Leute im Dorf hatten von ihm gehört, ihn jedoch zuvor nie zu Gesicht bekommen. Es war das Jahr 1965, Marcos 19 Jahre alt. Aus der Sierra ging es nach Madrid ins Kloster, dann musste der junge Mann seinen Militärdienst ableisten. Immer wieder flog er wegen Befehlsverweigerung hinaus, vagabundierte durch die Lande, schließlich verschlug es ihn nach Mallorca, wo er sich als Küchenhilfe und Maurer durchschlug. „Ich konnte gut kochen, aber weil ich weder das Lesen noch das Schreiben beherrschte, bekam ich nie einen richtigen Job.“ Er schaffte die Rückkehr in die Zivilisation nicht, bis heute ist ihm das nicht gelungen. „Ich war immer allein“, sagt Marcos. Er beginnt zu trinken, weiß immer noch nicht mit Geld umzugehen. Er zieht aufs Festland zurück, doch die Rückkehr in die Gesellschaft gelingt ihm nicht, zeitweise lebt er wieder in einer Höhle, in den Bergen nahe Málaga. Auf Mallorca lernte Marcos einen Anthropologen kennen, der seinen Fall aufzeichnete. Jahre später liest der Filmemacher Gerardo Olivares zufällig von Marcos, als die Zeitung „El País“ von Kindern berichtet, die allein in der Wildnis aufwuchsen. Olivares setzt einen Privatdetektiv an, der Marcos nicht wie erwartet in Andalusien, sondern im Nordwesten ausfindig macht. Dort lebt er auf der Finca von Manuel Barandela, in einem Dorf nahe der Stadt Orense in Galicien. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er für Manuel, die beiden Männer verbringen viel Zeit zusammen, obwohl Manuel sich lange darüber beschwerte, dass er mit Marcos kein vernünftiges Gespräch führen konnte. „Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass sein Vokabular einfach zu klein ist, er versteht viele Wörter nicht. Aber mittlerweile fragt er mich, wenn er etwas nicht versteht.“
Regisseur Olivares war sofort klar, was er aus Marcos‘ Geschichte machen musste. „Hombre, der Film ist das Beste, was mir im Leben passiert ist“, sagt Marcos mit seinem rauchigen andalusischen Akzent. Auch deshalb, weil er nach mehr als 40 Jahren wieder Wölfe sehen sollte, bei den Dreharbeiten in den Waldgebieten um Madrid. „Ich bin auf einen Felsen geklettert und habe wie ein Wolf geheult. Sie sind auf mich zugelaufen, da habe ich mich gleich auf den Boden geworfen, Bauch nach oben, Hände im Nacken. Damit sie wissen, dass ich mich unterordne. Dann kam die Wölfin, sie schnupperte an mir, ich habe sie angepustet – und schon hat sie mich abgeleckt.“ Kurz darauf aber kam auch das Männchen, knurrte Marcos zähnefletschend an. „Da habe ich ihm einfach meinen Arm in den Rachen gesteckt. Und ihn gestreichelt. Da waren wir gleich Freunde. Diablos, war das schön!“, freut sich Marcos. Momente des wahren Glücks.
Diese „Story“ könnte fast den roten Faden vorgegeben haben für die Geschichte von Marina Chapman – „Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam. Eine Kindheit unter Affen“. Ich habe darin leider nicht allzu viel über die Affen erfahren – aber das ist ja immer das Problem bei allzu teilnehmender Beobachtung, wenn es denn überhaupt eine war.
.
7. Neues über E.coli: Im Online Fachmagazin PNAS berichten britische Mikrobenforscher, dass sie E.Coli-Bakterien derart gentechnisch verändert haben, dass sie freie Fettsäuren als Grundstoff zu den Kohlenwasserstoffen verstoffwechseln aus denen Diesel-Kraftstoff besteht. Dieser ist mit herkömmlichen fossilen Brennstoffen chemisch identisch, so dass man ihn gleich in den Tank kippen kann... „Thomas Howard von der Uni Exeter und Kollegen von der Shell-Forschung schleusten dazu Gene verschiedener Mikroben in das Erbgut der Darmbakterien ein,“ heißt es über diese E.coli-Veränderung heute in der SZ. Der Studienleiter John Love meinte dazu: „Konventionellen Diesel in kommerziellen Mengen durch einen Kohlenstoff-neutralen Biokraftstoff zu ersetzen, wäre ein gewaltiger Schritt in Richtung unsere Ziels, die Treibhausemissionen bis 2050 um 80% zu reduzieren.“
.
8. Hier noch ein Bericht über Magenbakterien: Dem sauren Magensaft zum Trotz: Im menschlichen Magen herrscht Bakterienvielfalt. US-Mikrobiologen wiesen nun rund 120 Bakterien in der Magenschleimhaut nach, von denen einige noch unbekannt sind. Das Team um Elisabeth Bik der Stanford University School of Medicine entdeckte u.a. ein Bakterium, dessen nächster Verwandter auch unter extremen Umweltbedingungen bestens gedeiht, so etwa auf radioaktiven Abfallhalden. Ursprünglich gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Mikroorganismen im Magen auf Grund des hohen Säuregehalts nicht überleben würden. Vor rund 20 Jahren entdeckten dann die zwei Australier Barry J. Marshall und J. Robin Warren (Nobelpreisträger 2005) das Heliobacter pylori im Magen, einen potenziellen Erzeuger von Magengeschwüren. Bik und ihr Team analysierten nun Proben der Magenschleimhaut von 23 Probanden. Dabei entdeckten sie mindestens 128 verschiedene Bakterienarten. Hier noch etwas über Zwölffingerdarm-Bakterien: Auch hier lebt Heliobacter pylori. Prinzipiell ist das Untersuchungs-Verfahren der Forscher von der Universität Tokio bestechend einfach: Entnahme von Gas aus dem Magen oder Zwölffingerdarm und sofortige Analyse im Gaschromatographen. Finden sich Wasserstoff oder Methan ab einer bestimmten Konzentration, ist dies ein äußerst sicherer Hinweis auf die bakterielle Gärungs-Herstellung die er Gase vor Ort. Das Problem: Bislang gab es nur die Möglichkeit, diese Gase (vor allem Wasserstoff) in der Ausatemluft von Patienten zu bestimmen – ein ziemlich ungenaues Verfahren. Jetzt stehen jedoch neuartige Magenspiegel (Endoskope) zur Verfügung, mit denen eine Gasentnahme wärend der endoskopischen Untersuchung von Speisröhre, Magen oder Zwölffingerdarm möglich wird. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass die Gase entnommen werden, bevor das übliche „Aufblasen“ des Magens mit Gas stattfindet.
.
9.
Der
Stern
berichtete:
„Ich habe seit zwölf Jahre nicht geduscht“, sagt David Whitlock. Stattdessen besprüht sich der 60-Jährige zweimal täglich mit einem Spray. Darin enthalten: Bakterien, die sich vor allem im Boden finden. Im Boden von Pferdeställen zum Beispiel. Denn der Chemiker mit Abschluss am Institute of Technology (MIT) ist überzeugt, dass jene „schmutzigen“ Bakterien, die wir uns voller Eifer mit Seife und Shampoo vom Leibe waschen, eigentlich einen positiven Nutzen haben. Übertriebene Hygiene sieht er daher mit großer Skepsis: Schließlich gäbe es keine klinischen Tests an Menschen, die täglichen duschen, so Whitlock. „Woher also die Annahme, dass das gesund ist?“
Bei den verwendeten Bakterien handelt es sich um Nitrosomonas eutropha, die das streng riechende Ammoniak in unserem Schweiß zersetzen und in Nitrit und Nitrit-Oxide verwandeln. Dabei wird wiederum Energie frei, die unsere Hautzellen erneuert und aufbaut. Diese Ammonium-oxidierenden Bakterien (AOB) finden sich vor allem im Boden und naturbelassenen Gewässern. Einst haben sie sich womöglich aber auch auf unserer Haut zu Milliarden getummelt und uns dort gute Dienste geleistet: sie wirkten als Antitranspirant und entzündungshemmend gegen Hautausschlag. Bis wir anfingen, die natürlichen Reiniger durch chemische Reinigungsmittel, Deos und Shampoos zu ersetzen.“
In eine ähnliche Richtung argumentierten einige Bakteriologen, die herausfanden, dass Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen und viel mit „Dreck“ in Berührung kommen sowie mit Mist in den Ställen weniger krankheitsanfällig sind und vor allem resistenter gegen Allergien aller Art sind.
.
10. Eine Schlange verschluckte zwei Glühbirnen, alle drei konnten gerettet werden:
.
.
11. Eine Schlange kroch durch die Berliner Volksbühne, letztere konnte dadurch leider nicht gerettet werden:
.
.
12. Millionen Mäuse sterben in den Forschungslaboren weltweit. In Akademgorodok bei Nowosibirsk hat man ihnen ein Denkmal gesetzt:
.
.
13. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden
nächtens 34
Kaninchen aus der Kaninchenmassenhaltung des Kaninchenhof Langediers in 26340 Zetel Neuenburg befreit. In einem anonymen Schreiben, das beim Hamburger Verein die tierbefreier e.V. einging, bekennt sich die „Tierbefreiungsfront“ zu dieser Aktion:
.
.
14. Auf der Fraueninsel im Chiemsee fand kürzlich ein Symposion über „Verbinden und Trennen: Die Wende in die Praxis bei den Medienwissenschaften“ statt. Damit war der wissenschaftssoziologische Rat „Folge den Akteuren“ gemeint, oder auch eine von zwei Marburger Konferenzteilnehmern so genannte „Von-unten-nach-oben-Perspektive“. Konkret hatten sie dazu den Einsatz von Videokameras bei Snowboardern untersucht. Wobei sie im Ergebnis die diese „Praxis“ als neoliberale Verblödung abtuende Diagnose (aus der Perspektive einer „Von-oben-nach-unten“-Kulturkritik) widerlegten. Ihrer Einschätzung nach handelt es sich dabei nicht um eine individualistische „Selfie-Kultur“, sondern um dem Individualismus entgegengesetzte Vermittlungen von Körpern in coolen Posen und akrobatischen Manövern zur Hervorbringung von „communities of style“.
Dies entnahm ich dem Protokoll des Chiemsee-Symposions, das der Medienforscher Philipp Goll schrieb und wovon er mir eine Kopie schickte. Sein Protokolltext endet witzigerweise mit dem Zitat einer Teilnehmerin – eines ganz anderen Symposions: Es fand 1996 in Teresepolis nahe Rio de Janeiro statt und es ging dabei um Affen. Eingeladen waren Primatenforscher und Wissenschaftssoziologen. Was den Primatenforschern die Primaten sind für die Wissenschaftssoziologen die Primatenforscherinnen.
Organisiert wurde der Kongreß von zwei Feministinnen: die amerikanische Pavianforscherin Shirley Strum und die Hanuman-Langurenforscherin Linda Fedigan. Zu den Referenten gehörte die Pavianforscherin Thelma Rowell, ihr Vortragsthema lautete: „Einige sonderbare Schimpansen“ – und gleich zu Beginn entschuldigte sie sich mit den Worten: „Ich bin ja keine Affenforscherin mehr sondern erforsche Schafe. Aber dabei gehe ich davon aus, dass Schafe genauso klug wie Schimpansen sind. Denn wenn ich der Meinung wäre, dass Schafe blöd sind, dann könnte ich es gleich sein lassen. Indem ich sie aber auf eine Stufe mit den intelligenten Schimpansen stelle, gebe ich ihnen die Möglichkeit, unerwartete Verhaltensweisen zu zeigen und mir, diese auch zu bemerken. Je mehr ich daran arbeite, desto autonomen werden die Schafe.“
Das war genau der Marburger Medienansatz: Selfies knipsende Snowboarder sind nicht blöde, sondern sie beteiligen sich aktiv an der Herausbildung einer „Stilgemeinschaft“ – und zeigen damit intelligentes Verhalten.
Na ja, ich weiß nicht, werde das aber überprüfen, da ich demnächst ein kleines Buch über Schafe schreibe und mich vorher in ihrer „Scene“, zu der natürlich auch die Schäfer, die Schafforscher und die auf Schafe spezialisierten Tierärzte gehören, umtun muß. Der Schäfer der Herde der Longo-Mai-Kommune in Mecklenburg empfahl mir schon mal das große Handbuch über Schafe – von den Schafforschenr der Humboldt-Universität aus den Siebzigerjahren. Das sei das Beste, was es zum Thema „Schafe“ gäbe. Die von den Marburgern vollzogene Wende in der Snowboarder-Forschung bestand bei den Affenforschern zuvor darin, dass die Frauen sich damit durchsetzen konnten, dass sie die Bedeutung der weiblichen Tiere bzw. die Relevanz von sozialen Verhaltensweisen herauszustrichen, die nicht auf Aggression beruhten. Die männlichen Verhaltensforscher hatten sich zuvor jahrzehntelang auf dominante Männchen und ihre Auseinandersetzungen konzentriert.
Die von Thelma Rowell angestrebte Wende in der Schafforschung hatte vor ihr bereits der Tierbuchautor Eugene Linden ausgelotet. Er hatte erst Schimpansen studierte, die die amerikanische Taubstummensprache (ASL) lernten und dann US-Soldaten, die in Vietnam ihre Vorgesetzten erschossen. 2001 interviewte er für sein Buch „Tierisch klug“ eine Delphintrainerin: Sie arbeitete zwar mit der für das Militär entwickelten Methode der „operanten Konditionierung“, kannte jedoch deren Grenze: „So ist es beispielsweise erheblich einfacher, mit einem Delphin zu arbeiten, wenn man davon ausgeht, dass er ein intelligentes Wesen ist.“ Thelma Rowell lebt heute auf einer Farm in Kanada und hat 22 Schafe. Nach langjähriger Beobachtung und mittels kleinerer Experimente kam sie zu dem Schluß: „Schafe haben Meinungen!“
.
Türkischer Schafsmarkt
.
Türkischer Schafsbefreier
.
Selbstbefreiter Schafsbock (Photocollage: Gita Fuori)
.
Interview mit Gita Fuori:
„Innerlich wollte ich nie als Grafikdesignerin arbeiten. Zuerst dachte ich, dass die anthroposophische Landwirtschaft interessant wäre, ich las Rudolf Steiner und wollte in der Natur leben, habe auch Bilder über die Natur gemalt. Eine Bekannte brachte mich zur Marienhöhe bei Bad Saarow – ein Anthroposophenhof, auf dem 20 Leute leben und arbeiten. Da war gerade ein ,Möhren-Wochenende‘: Wir haben alle mit der Hacke Unkraut gejätet. Danach habe ich auf einem Anthroposophenhof in Mecklenburg gearbeitet, wo es sehr hektisch und stressig zuging: Ständig kamen Besuchergruppen, die bekocht werden wollten. Dort bin ich darauf gekommen, dass Schäferin das Richtige für mich wäre. Wenn man sechs Jahre als Schäferin arbeitet, bekommt man das als Lehre anerkannt. So bin ich auf einen Hof in die Lüneburger Heide gekommen. Sie hatten dort 2.000 Schafe und vier Schäferinnen, ich habe als Praktikantin den ganzen Tag ohne Pause im Stall arbeiten müssen und Stroh, Wasser und Kraftfutter rangeschleppt. Es war gerade Ablammzeit. Die Schäferinnen waren sehr verschlossen und hatten Angst, dass ihre Autorität ins Wanken geriet, wir haben wenig geredet.
Für drei Tage war ich dann bei einem anderen Schäfer beschäftigt. Der hat gesagt, die Schafe müssen im Winter einen Stall haben, das finde ich aber Quatsch, sie fühlen sich draußen in der Herde viel wohler. Danach habe ich in einer Schäferei in Röther bei Leipzig gearbeitet. Der Besitzer, seine Freundin, ein Lehrling und ich – wir haben 1.000 Schafe versorgt in ganzjähriger Hütehaltung ohne Stall, aber mit Zufütterung. Insbesondere die 400 Moorschnucken waren sehr nett. Ich bin sowieso meistens lieber mit Tieren als mit Menschen zusammen. Röther liegt in einem Naturschutzgebiet, aber in der Nähe ist eine Autobahn, die ständig Krach macht. Und wenn ich am Fluss gehütet habe, kamen ständig Spaziergänger oder Radfahrer vorbei, denen man Rede und Antwort stehen musste: ,Wie viel Schafe sind denn das?‘ Ich habe viel allein gelebt, eigentlich bin ich eine Peinlichkeit für Revolutionäre, weil ich gerne in meine Bilder abtauche und nie gelernt habe zu streiten. Die anthroposophische Landwirtschaft finde ich inzwischen zu sektenhaft, dafür kann ich mich immer noch für die utopische ,Phalanstère‘-Idee von Charles Fourier begeistern, wo man mal in dieser und mal in jener Kommune arbeitet. Ich befürchte jedoch, dass mein Wunsch, allein zu sein, dort zu kurz kommt.
Ich möchte auch nebenbei weiter Kunst machen – fotografieren. Von der Schäferei in Röther habe ich zehn Filme mitgebracht. Geschlachtet habe ich auch, das gehört dazu. Kennst du den Schäferwitz Nummer neun?: Es war einmal ein Schäfer, der einsam seine Schafe hütete. Plötzlich hielt neben ihm ein Cherokee Jeep. Der Fahrer war ein junger Mann in Brioni-Anzug, Cherutti-Schuhen und Ray-Ban-Sonnenbrille, er stieg aus und sagte zum Schäfer: ,Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins?‘ Der Schäfer überlegte kurz und sagte: ,In Ordnung‘. Der junge Mann nahm sein Notebook aus dem Jeep, verkabelte es mit seinem Handy, ging im Internet auf eine Nasa-Seite, scannte die Gegend mit dem GPS-Satellitennavigationssystem ein und öffnete eine Datenbank mit 60 Excel-Tabellen. Dann spuckte sein Minidrucker einen langen Bericht aus, den er durchlas. ,Sie haben hier 1.586 Schafe!‘ sagte er. Der Schäfer antwortete: ,Das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus‘. Der junge Mann packte sich ein Tier und lud es in seinen Jeep. Als er sich verabschieden wollte, sagte der Schäfer zu ihm: ,Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann das Schaf zurück?‘ ,Abgemacht‘, meinte der sportliche, junge Mann. Der Schäfer sagte: ,Sie sind ein Mc-Kinsey-Unternehmensberater !‘ – ,Das ist richtig, wie haben Sie das so schnell rausbekommen?‘ – ,Ganz einfach‘, erwiderte der Schäfer, ,erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat, zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß, und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache, denn Sie haben sich meinen Hund geschnappt.“
.
15. Unlängst fiel die in einer Pankower 5-Zimmerwohnung lebende Katze Lucie vom Balkon des 2. Stockwerks. Es ging ihr drei Tage schlecht, sie verkroch sich unter einen Stuhl und wurde umsorgt. Wahrscheinlich hatte sie eine Gehirnerschütterung, aber dann war sie wieder gesund und munter:
Lucie (Photo: Katrin Eissing)
.
15a: Jüngst wurde der Fall „Willi“ vor dem Berliner Verwaltungsgericht behandelt. Dem Kater der Rasse „Canadian Sphinx“ hatte man das Fell und die Tasthaare weggezüchtet. Und seine Besitzerin wollte ihn nun als Zuchtkater verwenden. Das Gericht verfügte jedoch, dass er kastriert werden muß, damit er nicht für noch mehr Nacktkatzen sorgt, denn mit seiner Existenz habe man bereits die „Grenzen züchterischer Liebhaberei“ überschritten – vor allem, weil er nicht nur nackt ist, sondern auch, weil die für ihn wichtigen „Vibrillen“ (Tasthaare) fehlen. Willis Besitzerin will das Urteil anfechten, schreibt die SZ auf Seite 1.
.
.
1
6
. Kürzlich verpaarte sich in Florenz ein Esel mit einem Zebra: „B
ei Ippo ist die Herkunft beider Eltern deutlich zu erkennen. In den Beinen des Fohlens schlagen eindeutig die Gene des gestreiften Papas durch, während Rumpf und Kopfpartie stark an die Esel-Mama erinnern.
I
ppos Vater lebte ursprünglich in einem Zoo, der insolvent ging. Im Tierpark in Florenz fand er ein neues Zuhause. Ippos Mutter gehört zu der bedrohten Art der Amiata-Esel. Für ihre Romanze überwanden die zwei Verliebten jedes Hindernis, denn ihre Gehege waren von einem Zaun getrennt,“
berichtete rp-online.de. Das Photo vom Esel-Zebra-Mischling wurde in allen möglichen Zeitungen veröffentlicht, hier zwei Photos von Volleseln:
.
Deutscher Esel
.
Chinesischer Esel
.
17. Der kleine Unterschied zwischen Natur und Kunst – am Beispiel des Tanzes:
.
.
18. Fisch-Größen und -Grüße
Ende 2015 kamen amerikanische Meeresforscher zu der alarmistischen Hochrechnung, dass es um 2048 keine Meeresfische mehr geben wird. Selbst ihre Tüchtigsten haben dann den Kampf ums Überleben verloren. Nun haben kanadische Fischforscher nachgelegt, indem sie bewiesen, dass in den letzten 60 Jahren viel mehr Fische gefangen wurden als angegeben. Im Jahr 1996 beispielsweise, zum Höhepunkt des Fischfangs, wurden nicht 86 Millionen Tonnen Fisch angelandet, sondern gut 130 Millionen Tonnen. „Der Fischfang sei von den offiziellen FAO-Statistiken, die auf den Meldungen der Mitgliedsländer beruhen, um gut 50 Prozent unterschätzt worden. Das liegt daran, dass Datenlücken vor allem bei Klein- und Freizeitfischern, was den unerwünschten Beifang und illegale Fischerei angeht, jeweils als null gewertet werden. Die Forscher haben statt der offiziellen Meldungen 100 Fischereiexperten in 50 Institutionen weltweit nach ihren Fangdaten und -schätzungen befragt,“ berichtete die FAZ, die auf der selben Seite darwinistisch jubelte: „Eine selten Haiart ist ins Netz gegangen.“
Der thüringische Schriftsteller Landolf Scherzer heuerte 1977 auf dem Fischfang-Trawler „ROS 703 Hans Fallada'“ als „Produktionsarbeiter“ an. Die Fahrt ging nach Labrador. Die DDR hatte von Lizenzhändlern eine kanadische Fanglizenz – mit Mengenbeschränkung – gekauft. Als sie im Fanggebiet ankamen, waren dort schon zwei andere DDR-Fischereischiffe, sowie zwei polnische, ein dänisches, ein bulgarisches, und vier westdeutsche. „Die Hochseefischerei ist wie die Hatz auf Hirsche oder Wildschweine kaum über das bloße Erbeuten hinausgekommen,“ schreibt Landolf Scherzer. Die Kabeljau-Beute der „Fallada“ war jedoch diesmal so gering, dass sie es in einem anderen kanadischen Fanggebiet mit Rotbarsch versuchten. Weil Scherzer die Verarbeitung der Fischmassen am Fließband nicht gleichgültig ließ, führte er manchmal Gespräche mit einem Kabeljau. Zuvor hatte er sich auch schon mit einem im sibirischen Baikalsee lebenden Omul (eine Lachsart) unterhalten. Merkwürdigerweise tat das zur selben Zeit auch ein westdeutscher Dichter, der der DKP nahe stand, beide berichteten anschließend darüber in ihren Reisebüchern. Damals hatte der „Fischfreund“ Breschnew gerade die Rettung des Sees verfügt, erklärte dazu der Dichter.
Der Rotbarsch wird tagsüber mit Grundschleppnetzen gefangen und nachts mit Schwimmschleppnetzen. Als sie nach Wochen noch immer keine großen Rotbarsch-Schwärme gefunden hatten, kam aus der Kombinatszentrale in Rostock die Anweisung: „Noch 4 Tage vor Labrador fischen, dann nach England dampfen und im Hafen von Falmouth Makrelen, die englische Fischer verkaufen, verarbeiten.“ Für ein Kilo zahlten sie dann 5 Mark. Auf der Weiterfahrt nach Rostock mußten die Fische an Bord noch sortiert, gewaschen, geköpft, filetiert und gefrostet werden. In den Läden kostete das Kilo dann 1 Mark 40. – Fast schon ein staatliches „Gastmahl“. Scherzers „Buch“ „Fänger und Gefangene“ wurde 1998 noch einmal verlegt – ergänzt um Interviews mit seinen ehemaligen Bordkollegen, die nach Abwicklung der DDR-Fischfangflotte fast alle arbeitslos geworden waren.
Neuerdings hat ein Dresdner Biologe, Michael Beleites, das Gespräch mit dem Kabeljau weiter geführt – ausgehend von einem Befund kanadischer Fischereiforscher, dass der Kabeljau immer kleiner werde. In Beleites Buch „Umwelt Resonanz – Grundzüge einer organismischen Biologie“ (2014), das sich gegen die darwinistische Selektion-Mutations-Formel richtet: „Nun ist gewiß kaum ein stärker selektierender Faktor vorstellbar, als ein Netz, das mit einer bestimmten Maschenweite ganze Fischpopulationen förmlich durchsiebt – und ab einer bestimmten Körpergröße ausnahmslos alle Individuen ausmerzt‘. Die Schleppnetze sind allerdings kein natürlicher‘ Selektionsfaktor, auch wenn die Selektion an wildlebenden Fischen stattfindet.“ Die Fische würden wahrscheinlich wieder älter und größer werden, wenn man die Intensivfischerei beendete. Es handelt sich hierbei also gerade „nicht um den Aufbau einer neuen Population durch eine positive Selektion von Anfang an genetisch frühreifer bzw. kleinwüchsiger Mutanten.“ Dieses Kabeljau-Beispiel ist nur eines von vielen mit denen Michael Beleites seine „Umwelt Resonanz“-Theorie entwickelt hat. Ob sie geeignet ist, dem Kabeljau zu helfen, wird sich wohl erst auf lange Sicht hin erweisen.
.
19. Ein paar Zahlen zum Schluß:
.





