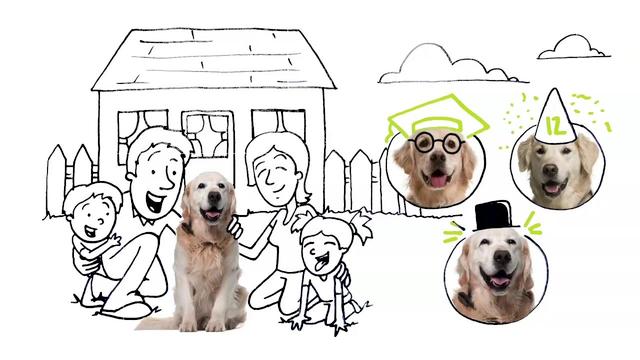«Auch ich wäre nicht froh darüber, auf Direktzahlungen zu verzichten. Am Gesamtumsatz machen Direktzahlungen bei uns neun Prozent aus, was rund 250'000 Franken entspricht», sagt Jacobsen. Die Forderung der Trinkwasserinitiative: Direktzahlungen sollen nur noch jene Bauern erhalten, die keine chemisch-synthetischen Pestizide einsetzen und einen Tierbestand halten, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann. Das heisst: Der Zukauf von Futter wäre verboten, um Direktzahlungen zu beziehen.
Es braucht mehrere Standbeine
Was sollen denn Berufskollegen machen, die nicht nach bio arbeiten und auf Import von Futtermittel angewiesen sind? «In der Landwirtschaft müssen wir langfristig grundlegend umdenken», sagt Jacobsen. Klar: Wer bisher einen grossen Saumastbetrieb habe und wegen der Anzahl Tiere eben viel Futter brauche, müsste sich nach Annahme der Trinkwasserinitiative einschränken. «Der kann dann nicht nur mit Schweinen sein Geld machen. Es braucht mehrere Standbeine. Die exzessive Landwirtschaft muss aufgebrochen werden.»
Die Bauern müssten wieder über den Preis der Produkte bezahlt werden und nicht wie bisher über ihre unrentablen Leistungen, die dann mit Direktzahlungen abgegolten werden müssen. «Das ist doch frustrierend. Wir sind sozusagen nur Subventionsempfänger und Hilfsarbeitskräfte des Ganzen vor- und nachgelagerten Handels und der Industrie», sagt Jacobsen. «Aufgesetzt wird dies mithilfe des Staates, der SVP und des Bauernverbandes.» Das bedeutet für Jacobsen: Die Konsumenten müssen faire Preise zahlen. «Es kann auch nicht sein, dass die Grossverteiler Billigprodukte-Linien anbieten und so Produkte zu Tiefpreisen unter ihrem wahren Entstehungspreis verramschen», betont Jacobsen.
Der Landwirt hat diesbezüglich eine klare Meinung: «Kunden haben für die Kaufentscheidung zu wenig Informationen, wenn wir nur auf den Preis im Laden schauen.» Ein Kopfsalat für einen Franken koste in Wirklichkeit viel mehr – 2.50 oder 3 Franken. Geerntet würden diese von Billiglöhnern, die auf Sozialhilfe angewiesen seien. Der Transport auf der Strasse verursache ebenfalls Kosten und auch die Beseitigung der im Gewässer entdeckten Pestizide und Nährstoffe nochmals. Der Preis wird durch Direktzahlungen, also Steuergelder, gestützt. Diese versteckten Kosten zahlten die Konsumenten durch die Hintertüre unbewusst mit.

Die Angst vom Verband Bio Suisse ist es, dass bei einem Ja zur Trinkwasserinitiative der Markt von Bio-Produkten über-schwemmt werde, was die Preise senken würden. Die Folge: Bio-Bauern würden weniger verdienen. Die Gegner der Trinkwasserinitiative erwarten einen anderen Effekt bei heimischen Produkten: Viele Bauern würden wegen der Auflagen nicht mehr produzieren, wodurch die Inlandproduktion sinke. Wegen des verknappten Angebots würden die Preise für Schweizer Produkte in die Höhe schnellen. Zusätzlich würde der Import an billigeren Produkten aus dem Ausland zunehmen.
«Das stimmt auf beiden Seiten. Die Bauern fordern seit Jahren, dass ihre Produkte höhere Preise erzielen. Das wäre nun der Fall», sagt Jacobsen. Für ihn ist klar: «Es gibt nur eine Lösung: Der Konsument muss sich bei jedem Kauf auch Gedanken machen können, was er damit auslöst.»
Direktzahlungen umlenken
Es sei aber heute schon so, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steige und man bereit sei, dafür mehr zu bezahlen. «Gesundes Essen muss für alle erschwinglich sein. Deshalb könnte der Staat Bedürftigen, die sich das nicht leisten könnten, mit Unterstützungsgeldern unter die Arme greifen.» Umgekehrt könnte man die Direktzahlungen umbauen: Da der Bauer in einem angepassten System sein Einkommen über den Preis am Markt erreiche, könnten die Direktzahlungen als Subvention in neue Kanäle fliessen. Auch in Forschung für nachhaltige Landwirtschaft.
David Jacobsen, der früher als Basketball-Co-Trainer bei den Schweizer Nationalmannschaften gearbeitet hat und später die bio-dynamische Ausbildung Schweiz absolviert hat, weiss – das ist ein neuer Ansatz, der Zeit braucht. Bei der Annahme der Trinkwasserinitiative sei ja auch eine achtjährige Übergangsfrist eingeplant. «Wir müssen umplanen. Die Menschen wollen längerfristig nicht für Produkte zahlen, die gleichzeitig ihre Welt zerstören. Und auch die Grosskonzerne haben erkannt, dass gesunde Böden die wichtigsten Ressourcen sind für ihre Produkte.