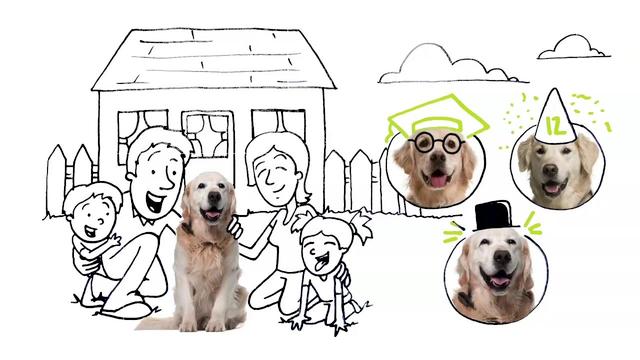Leserbriefe zu „Weniger Bedenken, mehr Taiwan“ von Boris Palmer
Im Artikel wird beschrieben, dass dem Staat bei der Pandemie ein wenig Vertrauen entgegenbringen soll, wenigstens soviel wie den Datenkonzernen. Ich sehe dies problematisch, da bspw. die Kontaktverfolgungsdaten teils auch für die Strafverfolgung genutzt werden. Weiterhin finde ich den Vergleich mit der Vorratsdatenspeicherung unsinnig, da diese europarechts- sowie grundgesetzwidrig ist, was bereits viele Gerichte festgestellt haben. Zwar sollten die von Herrn Palmer angeführten Nachverfolgungen umgesetzt werden, aber wie soll man einem Staat Vertrauen, der die Vorratsdatenspeicherung auf Biegen und Brechen umsetzen will. – René Karsubke
Fast eine ganze Seite bekommt der Tübinger Boris Palmer in der DIE ZEIT um abermals – und wie viele andere – davon zu faseln, dass wir uns doch nur an Taiwan und Südkorea orientieren müssten, um hier die technologische Kontaktnachverfolgung richtig hin zu bekommen. Dabei vergisst er aber wie so viele – und so viele wiesen schon darauf hin – dass die bloße Erwähnung der Länder sich nicht zum Vergleich eignet. Es lässt den Lesenden rätseln, ob Palmer es vermissen lässt die eingesetzte Technologie in den beiden Ländern näher zu beschreiben, weil er es nicht besser weiß oder weil er es genau weiß und daher auch eigentlich weiß, dass sie sich nicht zum Vergleich mit Deutschland eignet. Taiwan setzt weder eine Tracking noch eine Tracing-App ein.
Das Land überwacht die Einhaltung der Quarantäne mittels Ortung über das Mobilfunknetz. Außerdem stellt es unglaublich viele Informationen durch Daten zur Verfügung. Zum Beispiel, wo wie viele Masken verfügbar sind. CivicTech-Anwendungen, wie wir sie auch hier bei dem Wir-vs-Virus-Hackathon erstellt haben, aber dann leider nicht mehr wirklich beworben haben. Südkorea nutzt zur Tracking-App noch Daten aus Überwachungskameras und Finanztransaktionen. Wer dies als Vorbild hier in Deutschland fordert, der müsste – noch bevor eine Diskussion über Datenschutz überhaupt erst einsetzen kann – erst einmal sagen, wie diese Daten ob der geringen Anzahl an Überwachungskameras und dem weiterhin präferierten Zahlen mit Bargeld überhaupt generiert werden sollen. Aussagen darüber, wer die Daten dann auswerten sollen, wären sicherlich auch hilfreich.
Ob Gesundheitsämter diese Detektivarbeit noch leisten können, wo sie doch eigentlich wichtigeres zu tun haben, ist zu bezweifeln. Ebenso vergisst Palmer – auch darauf wurde mehrfach hingewiesen – dass Smartphones zwar diverse Daten sammeln können, das genutzte Framework von Apple und Google, also das Fundament der App, dies gar nicht zulässt. Es bräuchte also eine komplett neue App. Ebenso ist es wirklich erschreckend, dass Palmer sich vorstellen kann, die Vorratsdatenspeicherung aus der Mottenkiste zu holen. Die, gegen die nicht nur seine Grünen Parteikolleginnen und -kollegen zu Recht kämpfen, denn sie ist das Überwachungsinstrument par excellence. Sehr wahrscheinlich verfassungswidrig obendrein. Die bloße Forderung nach Daten wird weder die Pandemie und schon gar nicht das Virus bekämpfen!
Richtigerweise erwähnt Palmer, dass in den Gesundheitsämtern mehr passieren muss, dass diese immer noch faxen. Nur leider scheint er hier nicht wirklich den Finger in die Wunde zu legen. Obwohl doch gerade hier die meisten Effizienzen gehoben werden könnten! Wo doch hier das politische Versagen offensichtlich wird, schließlich gibt es die Plattform SORMAS, von der deutschen Helmholtz-Gesellschaft für pandemische Situationen entwickelt. Eigentlich für Länder Afrikas und Asiens, doch bereits im März stand eine Version für die deutschen Ämter zur Verfügung. Doch nichts passierte. Erst im Herbst – nach einem ungenutzten Sommer – erkennt die Politik plötzlich, dass man dieses System ja einführen könnte, dass dies den Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern die Arbeit erleichtern würde. Und versucht es nun parallel zu enorm gestiegenen Fallzahlen.
Wir brauchen nicht weniger Bedenken, wir brauchen kluges Denken, Wissen und den Willen Expertinnen und Experten zuzuhören – nicht nur im Bereich der Virologie. Und wir brauchen kluges Handeln. Das setzt voraus, dass man sich Gedanken darum macht, welche Daten es braucht, wie diese generiert und verarbeitet werden können und wo Technologie am effizientesten eingesetzt werden kann. Genau das macht Taiwan, genau daran hapert es bei uns. – Ann Cathrin Riedel
Herr Palmer stellt fest: „Nach zehn Tagen im Lockdown beginnen die Infektionszahlen wie erwartet zu sinken.“ Herr Palmer übersieht dabei offenbar einerseits, dass in Deutschland – ganz im Gegensatz zu den asiatischen Ländern – nur noch stichprobenhaft getestet wird, und andererseits nicht nur die Intensivstationen, sondern auch die Krematorien langsam über die Belastungsgrenze hinaus getrieben werden. Von einem Sinken der Infektionszahlen kann also gar keine Rede sein, stattdessen erkennen wir – im Gegensatz zu Taiwan! – nicht mehr so viele asymptomatische Fälle. Herr Palmer behauptet weiterhin, es setze sich die Erkenntnis durch, die Corona-Warn-App habe wegen der strengen Datenschutzvorkehrungen kaum einen Nutzen.
Richtig ist, dass in der Berichterstattung leider zu häufig Datenschutz und Pandemieschutz gegeneinander ausgespielt werden, ohne dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Richtig ist weiterhin, dass einerseits eine regelrechte Odyssee notwendig ist, um einen Test zu bekommen, und auf dieses Testergebnis dann in der Regel so lange gewartet werden muss, dass das positive Ergebnis des Tests von der Corona-Warn-App wieder verworfen wird. Die Corona-Warn-App verwirft nämlich alle Kontakte, die länger als 14 Tage zurückliegen, und so lange dauerte es in Berlin vor dem zweiten Lockdown, ein Testergebnis zu erhalten. Es existieren zwar „Selbsttests“: die hierfür notwendigen, sehr unangenehmen Nasen-Rachen-Abstriche werden von Laien aber in der Regel nicht fachgerecht durchgeführt werden und daher oftmals falsch negativ ausfallen.
Herr Palmer fordert ein Upgrade der Corona-Warn-App um eine Meldekette im Falle eines positiven Tests. Diese Überlegungen sind dadurch schon hinfällig, dass Labore und Gesundheitsämter schon vor Monaten an die Grenzen ihrer Kapazität gelangt sind. Zur Erinnerung: Auch in den Gesundheitsämtern und Intensivstationen gab und gibt es massiven Personalausfall aufgrund von Covid-19-Infektionen. Die Vorschläge von Herrn Palmer beschränken sich auf eine Ausweitung der Funktionen der Corona-Warn-App auf Kosten des Datenschutzes. Ich werde diese nicht kommentieren, da bereits die Prämisse falsch ist. Es dürfte aber nach den obigen Ausführungen klar sein, dass zum Beispiel die Aktivierung der Funkzellenortung ebenfalls keinen Sinn hat, wenn man 14 Tage auf ein Testergebnis warten muss. Die Warnung kommt zu spät bzw. gar nicht.
Das Virus verbreitet sich vor allem in geschlossenen Räumen in Situationen, in denen viel geredet wird. Überlegt man sich, welche Zusammenkünfte derzeit noch erlaubt sind, fällt auf, dass mit sehr viel Einsatz dafür gekämpft wird, vor allem zwei Bereiche offen zu halten: Schulen und (home-office-taugliche) Büroarbeitsstätten. Hinweise darauf, dass Schulen ein Pandemietreiber sein können, gab es aus Israel bereits im September. In Mexico wurde dies so gelöst, dass der Frontalunterricht im Fernsehen ausgestrahlt wird. Dies wäre eine Alternative zur oft genannten fehlenden oder ungenügenden digitalen Lehre, die auch in Deutschland möglich wäre – denn öffentlich-rechtliche Fernsehsender haben wir genug, und einen Fernseher hat in der Regel auch, wer keinen Internetanschluss, Tablet oder Computer besitzt. Hinweise darauf, dass Büros ein Pandemietreiber sein können, gibt es seit Beginn der Pandemie:
Zur Erinnerung: Einer der ersten Ausbrüche, nämlich der bei Webasto, hatte eine Dienstreise als Ursprung. Krankenhäuser, Gesundheitsämter und Labore waren bereits vor der Pandemie unterfinanziert. Hier muss nachgebessert werden. Richtig wäre folgendes Vorgehen: 1) Ausweitung der Kapazitäten der Labore und Gesundheitsämter. Vor allem die Testkapazitäten müssen erweitert werden, es müssen auch repräsentative Stichproben genommen werden. Hinweis: Hier gab es schon vor der Pandemie Engpässe. 2) Konsequente Anbindung aller Labore an die Infrastruktur der Corona-Warn-App. 3) Konsequente Verlagerung von schulischen und beruflichen Tätigkeiten in den Home-Office-Bereich. Die Corona-Warn-App muss dabei nicht verändert werden. – Andreas Brosche
Natürlich hat Herr Palmer völlig recht und es wird höchste Zeit, die Corona App endlich funktionsfähig zu machen. Bis dahin aber könnte man aber auch einfach die Regeln einhalten und damit die Zahlen drastisch senken. Denn die Regeln sind ja nun denkbar einfach: wer Symptome hat, lässt sich testen und geht bis zum Ergebnis in Quarantäne. Ist er positiv geht er bis zur Gesundung in Isolation, ist er negativ geht er wieder seiner Arbeit nach. Jeder, der Kontakt mit einem Infizierten hatte, lässt sich testen und geht bis zum Ergebnis in Quarantäne. Ebenso einfach zu begreifen sind die übrigen Verhaltensregeln: Hygiene, Abstand, Maske keine Grossveranstaltungen, auch Weihnachten und Sylvester nicht.
Das Ziel ist, dass die Zahlen überzeugend sinken und sich der bestehende Lock down in einen echten Lock down light umwandeln lässt und den man so lange erdulden kann bis die Impfungen durchgeführt wurden und gegriffen haben: Besuch von Restaurants, Theatern, Museen, Schulen Kindergärten etc. – alles ausgerichtet nach den Regeln der Pandemie mit guter Durchlüftung und Beachtung der Abstandsregeln. Wir haben es selbst in der Hand erfolgreich mit der Pandemie umzugehen! Wir müssen uns nur selbst dafür verantwortlich erklären und nicht auf Anweisungen des Staates warten, um diese dann unterlaufen zu können. Das wäre mehr Freiheit des Handelns als die von den Krakeelern geforderte vermeintliche Freiheit des Krakeelens. – Prof. em. Dr. med. Lutz von Laer
Freiheit muss manchmal durch kontrollierten und zeitlich begrenzten Freiheitsentzug gerettet werden. Darin ähnelt sie der Demokratie, die nur existieren kann, wenn sie sich manchmal undemokratisch gegen undemokratische Angriffe zur Wehr setzt. (Grundgesetz, z.B. Art 1. 1, 13.4, 20.4). Was ist daran so schwer zu verstehen? – Dr. Bernhard Benz
Das was Herr Palmer und die Zeit veröffentlichen, dürfen die das denn? Wir deutschen Besserwisser haben es wirklich nicht nötig vom Ausland etwas abzuschauen. – Friedrich Küspert
Wer schützt uns vor den Datenschützern? Ist der Datenschutz nach der EU-Datenschutzgrundverordnung schon bisher in manchen Bereichen( z.B. für die öffentlichen und freien Träger im Sozialleistungsbereich oder für Vereine) Bürokratiemonster gewesen, wird seine Handhabung durch die Datenschutzbeauftragten erst recht zum Ärgernis, wie sich bei den Widerständen gegen eine wirksame Corona App erweist. Die Datenschutzkontrolle wird wahrgenommen von den Datenschutzbeauftragten auf lokaler Ebene und außerdem von den überörtlichen Aufsichtsbehörden durch die Landesbeauftragten und den Bundesbeauftragten. Deren Aufgaben und Befugnisse sind in Art. 51 bis 62 EU-DSGVO geregelt ; in Art. 57 Abs.1 buchstäblich von A bis Z ,nämlich von a) bis v). Hinzu kommen die Regelungen in den Landesdatenschutzgesetzen ( z.B. §§ 20 bis 27 LDSG BW).
Art.52 Abs.4 DSGVO garantiert eine üppige personelle, finanzielle und technische Ausstattung der Behörde. Damit werden die Datenschützer gleichsam zur“ vierten Gewalt „im Staate – zumindest fühlen sich manche so. Quis custodiet custodes? Eine wirksame Corona App hätte nicht am Datenschutz scheitern müssen, weil der Datenschutz als Grundrecht ( wenn auch nur abgeleitet aus Art. 1 Abs.1 i.V.m.Art.2 Abs.1 GG) bei einer Kollision mit einem anderen Grundrecht (auf Leben und Gesundheit in Art. 2 Abs.2 GG) Einschränkungen unterliegt (sog. praktische Konkordanz). Außerdem lässt Art. 6 Abs.1 d) DSGV0 die Datenverarbeitung zu bei lebenswichtigen Interessen. Auch die Einwilligung in die Datenverarbeitung könnte genutzt werden, worauf Palmer zu recht hinweist. – Prof. em. Peter-Christian Kunkel
Den intelligenten und überzeugenden Argumenten von Boris Palmer zu den verpassten Chancen durch eine verbesserte Corona Warn App schließe ich mich voll und ganz an. Es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet ein schwäbischer (sorry!) Oberbürgermeister – und Grüner obendrein – uns erklären muss, dass man in der akuten Situation den Schutz der Menschen (und des an die Grenzen kommenden Gesundheitssystems) über den persönlichen Datenschutz stellen sollte, zumindest zeitlich begrenzt. Dieses kluge Argument hätte ich von den Medizinern und Ethikern erwartet.
Ebenso kritikwürdig ist die Tatsache, dass – entgegen allen Beteuerungen der Politik – man bis heute nicht (ausreichend) Intelligenz und Ressourcen in den Schutz der gefährdetsten Mitbürger gesteckt hat. Stichwort: FFP2 Masken für alle in Pflegeheimen, Temperaturmessungen und obligatorische Schnelltests für alle Beschäftigten und jeden Besucher. Wenn hier mehr Hirnschmalz investiert worden wäre (wie es Herr Palmer in Tübingen ja vormacht), dann hätte sich der panische Fokus auf die Infektionszahlen erübrigt.
Und hätte man nicht alles daran setzen müssen, dass man mit der Freigabe des ersten verfügbaren Impfstoffes zumindest so viele Impfdosen verfügbar hat, damit man die Gruppe der am Hochgefährdeten ohne Verzug impfen kann? Danach könnte man gelassener sein und die Maßnahmen des Lockdowns für alle systematisch zurücknehmen. Die Chance hat man verpasst. – Peter Breuninger
Vielleicht wissen Sie es nicht und vielleicht wissen Sie es und verschweigen es absichtlich: in Taiwan werden die Mobiltelefone der mit Corona infizierten Personen und deren Kontakten 24/7 zwangsweise, ohne richterlichen Beschluss und auch ohne Zustimmung der Personen hinsichtlich des Ortes der Personen überwacht. Jedes Verlassen der Wohnung während der Quarantäne und der Isolation wird durch die Ordnungskräfte ohne richterlichen Spruch sofort und empfindlich bestraft. Taiwan gibt vor eine Demokratie und ein Rechtsstaat zu sein !?
Vielleicht hat Xi durchaus Recht, wenn er Taiwan als nur eine weitere Provinz von Mainland China bezeichnet? Wenn Ihnen diese Tatsache bekannt ist und Sie diese Tatsache in ihrem Artikel verschweigen, dann bezeichne ich sie als Scharlatan, ja als Demagogen und auch als Populisten. Schande über Sie! Wenn Ihnen diese Tatsache nicht bekannt ist, dann empfehle ich ihnen demütig, keine weiteren Artikel über ihre Unwissenheit zu verfassen. – R. Märkl
Endlich hat Boris Palmer, der ja (nicht immer gerne) Gehör bekommt, ein Thema aufgegriffen, auf das ich schon seit Monaten warte: Unsere Gesundheitsämter arbeiten noch im analogen Mittelalter. Ein Inzidenzwert von 50 ist für unsere Politik ein unumstößlicher Wert. Darüberliegend befinden wir uns anscheinend im Blindflug der Corona-Geschehnisse. Boris Palmer weist zu Recht auf die naheliegende vorhandene(!) Lösung hin. Ich würde noch einen deutlichen Schritt weiter gehen. Dann wären wir spätestens gleichauf mit Taiwan: Wenn Corona „Staatsfeind Nr 1“ ist, warum ist dann unser Datenschutz immer noch wichtiger? Was spricht tatsächlich dagegen, wenn die deutsche Corona-App die Bewegungsdaten zentral meldet? Ein Weg zum Überwachungsstaat? – Die Möglichkeit besteht, aber bei vernünftiger und überwachter zentraler Handhabung wäre der Datenschutz nicht schlechter gestellt als heute.
Zum einen könnte man, wie im Artikel beschrieben, zeitnah alle Kontaktpersonen eines Vorfalls ermitteln und diese den deutlich entlasteten Gesundheitsämtern melden (zur Not auch als Fax in gedruckter Form...). Des Weiteren hätten wir endlich eine fortlaufende zentrale Datenbasis. Man könnte in Deutschland digital(!) mit Methoden aus „BigData/Data Science“ – ja, das kann man in Deutschland studieren, wir haben hier Experten, Auswertungen auf Basis der nun anonymisierten Daten erstellen und wichtige Fragen beantworten: Wie hoch ist das Risiko in Theatern, Kinos, Bussen, Sportstätten, Einzelhandel etc. im Allgemeinen, aber auch im Speziellen? D.h. Warum kam es in einem bestimmten Kino zu Ausbrüchen?
Da sollte man vielleicht mal gezielt nachfassen. Warum Techniken, die die großen Konzerne wie Google, Amazon etc. schon lange nutzen, nicht auch im positiven Sinne für die Gesellschaft nutzen? Warum als Deutschland nicht Vorreiter spielen? Mag sein, dass die Corona-App wie beschrieben dann deutlich an Akzeptanz zunehmen würde. Aber was wäre schlimmer? Die Anordnung einer Ausgangssperre oder die Anordnung, dass jeder, der ein Smartphone besitzt und sich im Gebiet der Bundesrepublik aufhält – also auch andere Staatsbürger – die Corona-App installieren und sich registrieren muss? Das wäre meiner Meinung nach ein wichtiger Baustein für eine erste Strategie und weg von politischer Taktierei! – Rainer Eisele
Herr Palmer beginnt seinen Beitrag mit der Aussage, dass nach 10 Tagen im Lockdown die Infektionszahlen zu sinken beginnen. Das klingt ein bisschen nach „Na, geht doch...“. Viele denken und reden so. Aber nein, es geht nicht. Vielmehr scheint das Risiko zu wachsen. Was nicht berücksichtigt wird, ist die Zahl der Tests, welche zu den berichteten Infektionszahlen führen. Auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI), deren Statistiken vielfach die Kalenderwoche (KW) als Zeiteinheit haben, liest sich das so: In KW 51 (der Woche vor Weihnachten, zu deren Beginn der harte Lockdown startete) gab es 171.262 Neuinfizierte bei 1.578.209 durchgeführten Tests.
Der vom RKI bequemerweise mitgelieferte Prozentsatz positiver Tests aus der Gesamttestzahl betrug 11,67% . In der KW 52 sank die Zahl der Neuinfizierten tatsächlich deutlich, nämlich um rd. 20% auf 136.998. Zu den Ursachen gehörte aber sicherlich nicht nur die lobenswerterweise gesteigerte Selbstbeschränkung als Folge des Lockdown, sondern auch die – wohl wegen just der Weihnachtstage – deutlich geringere Zahl von Tests: Sie sank auf 1.057.269, also um rund 500.000 bzw. ein Drittel weniger als in der Vorwoche. Warum fiel nicht auch die Neuinfektionszahl in gleichem Maße ab? Der Grund war der Infektionsprozentsatz: dieser stieg von 11,67 in KW51 auf 12,96 in KW52, also wenn man so will um über 10%.
Weniger Tests bringen also geringere Infektionszahlen, ändern aber nichts an ihrer steigenden Trefferquote. Übrigens: der Infektionsprozentsatz lag in der „Epidemieflaute“ zwischen Anfang Mai und Ende September unter 2%. Aber schon seit Ende August steigt er (mit einer Ausnahme in KW 46) wöchentlich, mal mehr, mal weniger. Teil- oder Voll-Lockdown hin oder her. Anmerkung für die Redaktion: die Testzahlen sowie die Infektionsprozentsätze habe ich der auf der hier genannten RKI-Seite im 1. Absatz verlinkten xls-Grafik entnommen https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Testzahl.html – Andreas Kaede
Ich kann Boris Palmer bezüglich einer bevorzugten Priorisierung der Corona-App gegenüber dem Datenschutz nur zustimmen. Die Datenschutzgrund VO ist nicht Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Schon als die Datenschutzverordnung eingeführt wurde, hat sie erhebliche volkswirtschaftliche Kosten verursacht, für kleine Einheiten wie z.B. Vereine, völlig unverhältnismäßig. Auch jetzt erscheint das Vorgehen unverhältnismäßig und es scheint völlig unverständlich, warum nicht Medien wie besonders Rundfunk und Fernsehen seit ein- oder zwei Monaten eine gesellschaftliche Diskussion angeregt haben, ob und wieweit Datenschutz zugunsten der Corona App eingeschränkt werden könnte.
Nach einer öffentlichen Diskussion hätte der Bundestag die Argumente aufgreifen, debattieren und dann darüber entscheiden können. Mit einer solchen Entscheidung Ende Dezember hätte man die App jetzt erneuern können und wir wären bald alle sicherer vor Corona. Vielleicht würden mehr Leute die Warn-App installieren, wenn diese effizienter wäre. Hat man schon eine Umfrage gemacht, wer sie bei höherer Effizienz installieren würde? Ich überlege ernsthaft, sie zu deinstallieren, weil sie offenbar kaum etwas bewirkt, außer dass ich dauernd wegen dem eingeschalteten GPS gefragt werde, wie es mir an Orten, an denen ich war, gefallen hat. – Reinhard Döhnel
Wieso erhält der Bürgermeister einer Stadt mit nicht einmal 100.000 Einwohner*innen wiederkehrend eine Bühne für seine provokativen Ausfälle in einer bundesweit erscheinenden Wochenzeitung? Wenn ich die kruden Ansichten eines unbedeutenden Lokalpolitikers lesen möchte, kann ich eine beliebige Lokalzeitung lesen. Von der Zeit erwarte ich mir etwas anderes. Es gibt in Deutschland mehr als 80 Städte mit einer höheren Einwohner*innenzahl als Tübingen. Bekommen deren Oberbürgermeister*innen jetzt auch zweimal im Monat eine ganze Seite in der Zeit? Oder bietet die Zeit nur den Populist*innen unter ihnen eine Plattform? In der Hoffnung auf ein Palmer-freies Jahr 2021 – Lennart Marquard
Es ist das größte Versäumnis unserer politischen Führung in den vergangenen 6 Monaten, daß sie kein Konzept gegen die Pandemie entwickelt hat: daß die AHA-Regeln im Winter bei weitem nicht ausreichen, dürften die Fachleute gewußt/geahnt haben; daß der Lock-down kein Konzept ist, wurde im Dezember sogar offiziell kleinlaut eingestanden; und daß uns das Impfen bis zum Frühsommer auch nicht helfen wird war an einer Hand abzuzählen. Boris Palmer ist zuzustimmen: als einzige Gegenmaßnahme bleibt das effektive Tracking. Natürlich muß (und kann) man die Fernostinstrumente und -methoden nicht einfach kopieren, aber ich bin fest davon überzeugt, daß es technisch und organisatorisch möglich ist, ein Trackingtool für Deutschland auf die Beine zu stellen, das sowohl effizient und weitgehend automatisch funktioniert, als auch alle Anforderungen des Datenschutzes erfüllt.
Leider hatte man im Frühjahr den Eindruck, als die Handy-Warn-App Gestalt annahm, daß hinter der Bühne bereits wieder versucht wurde, zu mauscheln und zu tricksen. Anstatt eine Transparenzoffensive zu starten und Vertrauen zu schaffen, um in einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung ein schlankes Tool zu entwickeln, das ausschließlich der Pandemiebekämpfung dient, das alle verstehen und das alle mittragen. Eigentlich wäre Merkel doch dafür prädestiniert gewesen... Die „Verriegelung“ des ganzen Landes ist die mit Abstand teuerste Lösung und gleicht eher einer Kapitulation. – Wolfgang Heckl
Boris Palmer hat völlig Recht: die Corona-App ist durch den Datenschutz untauglich gemacht worden. Und ich fürchte, dass in einigen Monaten Wissenschaftler ausrechnen werden, wieviel Tote uns dieser Umstand zusätzlich beschert hat. Dann allerspätestens wäre es Zeit, hier in Deutschland den Datenschutz ethisch neu zu bewerten: kann es denn richtig sein, den Datenschutz über den Gesundheitsschutz zu stellen?
Man sieht das Dilemma bei der Entwicklung der elektronischen Patientenkarte/akte (Zyniker sagen, der BER unseres Gesundheitswesens): aus meiner Sicht ist diese absolut sinnvoll, da mit deren Hilfe und richtiger und motivierter Nutzung von Patienten und Ärzten die gesunde Lebenszeit der Bürger im Mittel gesteigert wird, einmal ganz abgesehen von zu erwartenden Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen.
Aber durch die mißtrauische Grundhaltung gegenüber unserem Staat fehlt es an Motivation bei vielen (den meisten?) Aktiven im Gesundheitswesen als auch bei vielen Bürgern. Wenn sich dann noch der Bundesdatenschutzbeauftragte wie vor ein paar Tagen gegen den Bundesgesundheitsminister stellt, man solle die Patientenkarte nicht in vollem Umfang nutzen, dann wird damit dokumentiert, dass in der vorbereitenden Kommunikation für ein solches Projekt viel schief gelaufen ist. Wir sollten uns alle einmal selbst anhand folgender Hypothese prüfen: wenn eine voll taugliche Corona-App zwingend mit WhatsApp verknüpft wäre, würden wir dann auf WhatsApp verzichten? – Dietrich Junker
Sie haben recht, wir tun zu wenig um Lockdowns im Vorfeld zu verhindern und wir wägen zu wenig ab. Z.B. wollt Ihr einen Lockdown, der jeden von Euch X-tausende Euro kostet, oder ein befristetes Aussetzen von gewissen Datenschutzregeln? Man könnte mit der Corona-App auch noch weiter gehen: bestimmte Aktivitäten sind nur möglich, wenn die App eingeschaltet ist, z.B. ÖPNV-Benutzung, Einkaufen,... Ggf Smart phones an Bedürftige zu verteilen ist sicherlich billiger als ein Lockdown. Aus München kann ich auch andere Punkte nennen die als Vorbereitung auf die 2. Welle leider nicht beachtet wurden.
– Zugangsbeschränkungen zu Bahnhöfen der S- und U-Bahn und zu den Zügen. – versetzter Schulbeginn (was nützen die Massnahmen in den Schulen, wenn sich die Kinder auf dem Schulweg im ÖPNV drängeln) – Schutz der Risikogruppen: ab eines gewissen Alters Verbot zu Zeiten des Berufs- und Schülerverkehrs ÖPNV zu benutzen oder Geschäfte zu betreten. Bestimmte Uhrzeiten definieren, wo allein Ältere einkaufen dürfen. – Schutz der älteren Heimbewohner, Zutritt nur mit negativem Schnelltest, für Mitarbeiter und Besucher.
– Kontrolle der Massnahmen, Verstösse ahnden. Wenn sich nicht alle dran halten, bringt es wenig. Und etliche tun es leider nicht von allein. Zusätzliches Kontroll-Personal liesse sich sogar durch die Geldstrafen finazieren. Alles Dinge, die nicht schön sind und auch Geld kosten, aber alles besser als Lockdown und auch billiger. Ich wünsche mir mehr Stimmen aus der Politik, die eine breite, sachliche und faktenbasierte Diskussion anstossen, den Blick weit ausrichten und auf Tabu’s und Angstmacherei verzichten. Insofern gefallen mir auch Ihre Beiträge zu Corona (und übrigens früher auch die Flüchtlingsdebatte) – Christian Voss
Na endlich! Boris Palmer beschreibt in dem herausragenden Artikel nicht mehr und nicht weniger als einen gangbaren und effizienten „Plan B“ dessen rasche Umsetzung neben dem „Plan A“, einer möglichst umfangreichen Durchimpfung zunächst von medizinischen und funktionalen Risikogruppen mit allen seinen noch immer und auch wohl weiterhin bestehenden Unwägbarkeiten einen wirklich erwartbaren Erfolg bei der Bekämpfung des wohl auch weiterhin mutierenden COVID Viruses erwarten lässt. Wirklich effiziente und rasche Identifizierung der prozentual sehr wenigen jeweils aktuell COVID Infizierten und die Durchsetzung deren befristeten Quantäne ist eine weit geringere Einschränkung gegenüber einer notwendigerweise lückenhaften und regional auch sehr unterschiedlichen quasi Quarantäne fast der gesamten Bevölkerung mit allen Auswirkungen auf das wirtschaftliche und vor Allem soziale Leben, ebenso wie auf Bildung und das kulturelle Leben.
Und dies nur zum Preis einer vorübergehenden Einschränkung des Datenschutzes für Gesundheitsämter, also staatliche und damit legislativ kontrollierbare Organe der staatlichen Verwaltung. Wobei ohnehin nur die Wenigsten wirklich wissen was diese zu schützende „Daten“ eigentlich sind und wer sie wo und wie bisher bereits meist völlig legal nutzt und verwendet. Datenschutz ist kein verfassungsmässig verbürgtes Menschenrecht. Der Schutz von Leben und Gesundheit aber schon. Es ist sogar das Wichtigste. – Uli Schmid
Den Inhalt des Artikels von Herrn Palmer unterstütze ich voll und ganz. Es ist geradezu irrwitzig, wie eine Minderheit von Datenschützern panisch den Einsatz hoch effektiver Datentechnik für den Gesundheitsschutz verhindert. Sie nehmen lieber Tod und Krankheit von Menschen in Kauf, als technische Möglichkeiten für den Schutz der Menschen einzusetzen. Wie Herr Palmer richtig ausgeführt hat geben die Menschen bei der Nutzung sogenannter sozialer Medien, beim Onlinehandel und mehr oder weniger nützlicher Apps ihre Daten preis, weil sie sonst nicht in den Segen derer Anwendung kämen. Wenn aber der Staat auf anonymisierte Standortdaten zugreifen will, bricht die orwell ́sche Götterdämmerung herein.( In Verbindung mit der Strafverfolgung ist Ähnliches zu beobachten.)
Und so komme ich auf die Verbindung zu dem Artikel „Keine Zeit zum Rumprobieren“ der Vorwoche, in dem Frau Schürmann sich damit brüstet, durch ihre datenschutzrechtlichen Eingriffe der App zu großer Akzeptanz verholfen zu haben. Woher weiß sie das? Mit wem hat sie darüber gesprochen? Mit ihrer Blase am Prenzlauer Berg? Kann es nicht ebenso richtig sein, dass eine „Taiwanesische App“ zu viel mehr Akzeptanz geführt hätte, weil sie viel erfolgversprechender gewesen wäre? Ist das Erreichen von Akzeptanz nicht auch das Ergebnis positiver Kommunikation? Leider wurde die App aber von Anfang an von Bedenkenträgern zerredet.
Und noch ein letzter Punkt. Ich gehöre zu den 23,8 Millionen, die die App heruntergeladen haben, Sogar zweimal. Beim ersten Mal habe ich nämlich angenommen, ich hätte einen Fehler gemacht, weil sie sich nicht öffnen ließ. Hatte ich aber nicht, mein mobiles Endgerät ist mit seinen sechs Jahren einfach zu alt um die App anzuwenden. Die Bundesregierung hat sich nämlich von Apple, Google und co. über den Tisch ziehen lassen, weil die App unterhalb einer bestimmten Betriebssystemversion nicht läuft. So sind also rund 25% der Endgerätenutzer von der Anwendung der App von vornherein ausgeschlossen.
Da es gerade die Alten sind, die sich nicht ständig mit neuen Geräten versorgen, weil die vorhandenen das was man mit ihnen tun will problemlos leisten, ist durch diese Nutzungseinschränkung gerade eine große Risikogruppe von der Nutzung der App ausgeschlossen. Aber andererseits war es wohl ein gutes Konjunkturprogramm für Apple und co. So hat Alles auch seine guten Seiten, wenn auch nicht für die Richtigen. – Henning Glaser
JA, genau so! Seit Wochen/Monaten diskutieren und analysieren wir an Küchen-/Esstisch die Situation und insbesondere die Wirkungslosigkeit der Warnapp. Hoffentlich stößt dieser Artikel die notwendigen Erweiterungen/Änderungen schnell an. Der letzte Satz über das größere Vertrauen unserer Gesellschaft in die großen US-Konzerne im Vergleich zu unserem Staat ist vielleicht das Kernproblem; traurig aber leider wohl wahr. – Thomas Wenske
Ich finde es einen Skandal, dass Deutschland bei dem Thema Corona-Fall-Verfolgung agiert wie vor 20 Jahren. Die John Hopkins Universität schafft es, Coronadaten aus der ganzen Welt zu organisieren – tagesaktuell. Und wir verzetteln uns mit Email, Fax und der Beantragung von Codes, die dann manuell eingegeben werden müssen. Während gleichzeit jeden Monat Milliarden für Lockdowns ausgegeben werden.
Immer wieder Lockdown halten wir auf Dauer nicht durch – fällt uns denn nichts anderes ein? Man muss nicht alles gut finden, was Boris Palmer macht. Aber sein Vorschlag, die Corona App zu einem wirklich wichtigen Werkzeug in der Pandemiebekämpfung weiterzuentwickeln, scheint mir fundiert durchdacht. Wenn der Staat dann noch darauf verzichtet, die Daten zur Strafverfolgung einzusetzen, sollte es eine sehr breite Akzeptanz dafür geben. Wie lange dauert es noch, bis der Vorschlag umgesetzt wird? – Hartmut Haubrich
Ich kann Ihren Ausführung nur voll und ganz zustimmen und begrüße es, dass Sie das Thema in der Zeit publik gemacht haben. Offenbar misst die hohe Politik Masken- und Abstands, sowie Ein- und Ausreiseregeln mehr Wichtigkeit zu als eine IT Lösung voranzutreiben. Und wenn sich unsere Väter und Mütter im hohen Alter mit Themen wie Installation, Test eingeben oder Ergebnisse analysieren schwertun, dann sollen sie das eben ihren Neffen übertragen. Die haben damit kein Problem und freuen sich bestimmt auf die größeren Freiheiten, die ihnen damit zuteil werden könnten. – Dr.-Ing. Stefan Ring
Leserbriefe zu „Bürger an die Macht!“ von Hanno Rauterberg
Vielen Dank für das Spezial zum Thema: Was wird aus der Stadt? Absolut lesenswert. Seit Jahren sind die Entwicklungen den Innenstädten schwierig, weil das jahrtausendalte Konzept eines belebten Handelsplatzes durch den Online-Handel in die Krise gekommen ist. Leerstand, Verödung, mangelnde Aufenthaltsqualität bis hin zu Schwierigkeiten mit Sicherheitslage. Es war eben immer so, dass sich Menschen getroffen haben um miteinander Handel zu treiben. Diese Prämisse verliert rasant an Kraft – Corona zeigt auch hier gnadenlos schon bestehende Schwächen auf. Es ist wohl ein der Bereiche, in dem die Digitalisierung einen kompletten Umbruch bringt. Berufe verschwinden, Märkte verlagern sich.
Und jetzt, alles ohne Hoffnung? Alle müssen „Stadt“ neu denken: Kunden, Händler, Immobilienbesitzer und -Entwickler, Stadtplaner und Politik. Die Stadt wird sich entwickeln, muss neue Wege finden – Einzelhandel wird nicht mehr das zentrale Thema sein. Aber es gibt Nischen für Ideen, die persönlich sind, zugewandt, die das Erlebnis bringen. Wohnen in die Erdgeschosslagen holen. Attraktiv sein für junge Menschen. Das erfordert Risikobereitschaft, Mut, Einsatz von Ressourcen. Die Idee der Stadt darf nicht sterben. Sie ist zu schön. – Constanze Kraus
Ein Wirtschaftsteil über die Stadt und Ideen, wie sie lebenswert bleibt, entfaltet zwischen dem Primat der Kultur und der Politik, zwischen einem Beitrag von Hanno Rauterberg und einem von Martin Marchowecz. „Bürger an die Macht!“ – „Unser Revolutionspalast“. Zum Wechsel in das Jahr 2021 ein deutliches Statement für ein demokratisches Bauen (ohne dass dieser Begriff auftaucht). Die Frage „Wie wollen wir leben?“ (ohne dass sie ausdrücklich gestellt wird) wird damit als Kernfrage für unsere 20er Jahre postuliert.
Kein Manifest ist dieser Wirtschaftsteil. Eine Ideensammlung aber, die es in sich hat. In den Städten wird sich zeigen, wie der Klimawandel (ohne dass er genannt wird) gelingt, mit welchen neuen Ideen von Leben, Wohnen und Arbeiten, von Lebensmittelproduktion, von Mobilität. Mit welchen neuen Konzepten der Bereitstellung von Boden, der Entwicklung und Umsetzung von Projekten, des Umgangs mit dem Bestand. Ein überzeugender Aufruf für mutige Stadtpolitik, für kreative Stadtplanung, für engagierte Projektentwickler, Architekten und Bürger. Hoffentlich springt der Funke an vielen Stellen über. – Reinhard Koine
Was für ein hohler Beitrag zu so einem wichtigen Thema! Das Thema zumal an so promineter Stelle hätte sachliche Information und ggf. auch mehr Recherche verdient. Im Einzelnen: Der Aufmacher, das Titelbild. Die Ansicht einer Terrassenbebauung. Was zeigt das, was nicht schon in den 50ern in der Siedlung Halen vom Atelier 5 realisiert wurde? Nichts. Und was hat das mit dem Titel zu tun? Das ist vieleicht eher eine Frage an Ihren Ressortleiter. Toyota Ein Autokonzern engagiert sich für Stadtentwicklung? Aus Altruismus? Wo ist das wirtschaftliche Motiv? Kann Immobilienverwertung in Folge von brachfallender brown field Nutzung eine Rolle spielen? Dazu braucht man Nutzungskonzepte. Das kann öffentlichwirksamme Quartiersentwicklung sein. Wer investiert? Wer kauft die Grundstücke?
Ist der öffentliche Raum und die öffentliche Infrastruktur in Privatbesitz? Wie sind die Renditeaussichten.Wo ist da Ihre Recherche? Sie schreiben von „global vermarktbarer Urbanität“. Ist das vieleicht ein Widerspruch zur am Ende des Beitrags formulierten „Lust am Ungezügelten“? Trennung von Funktionen Die Trennung von einander störenden Funktion ist städtebauliches Handwerkszeug und rührt aus den Missständen der frühen Industiealisierung einhergehend mit der Wanderung der Landbevölkerung zu den Arbeitsplätzen in die Städte. Die einvernehmliche Mischung von Funktionen ist planerische und politische Kunst. Ich empfehle den Besuch eine Ratsitzung, in der ein Bebauungsplan kontrovers dikutiert wird.
Wir haben seit kurzem in Deutschland ein Planungsrecht, was urbane Quartiere noch besser ermöglicht. Landwirtschaft in der Stadt Das ist mE aus wirtschaftlichen Gründen Liebhaberei. Dazu gehören auch die Kräuter und Tomatenstauden auf meinem Balkon sowie das Foliengewächshaus auf dem Dach meiner Garage. Paris Inwieweit haben globale Konzerne Macht über Paris? Trennung und Mischung von Funktionen Eine digitale Moderne, die emittierendes produzierendes Gewerbe oder grossflächigen Handel und Logistik negiert, deren Leitbild für Wertschöpfung und Wohlstand also aus Dienstleistungen und quartiersbezogenen Manufakturen besteht, ist romantisch und damit zukunftsfeindlich.
Partizipation Partizipation an der Bauleitplanung ist im Bauplanungsrecht kodifiziert. Partizipation an der Objektplanung wird in Baugemeinschaften, meist im Rahmen der Planung und Erstellung eines Wohnobjektes aufgeteilt in Eigentumswohnungen praktiziert. Für die Finanzierung und den Abstimmungsprozess sind erhebliche Kapazitäten und Kompetenzen der Beteiligten erorderlich. Wie gross ist der Anteil, der das Leisten kann? Bodenpolitik Und hier geht es ans Eingemachte. Hier wäre eine Chance, die Auswirkungen der Kontrollrechte (Eigentum) auf Grund und Boden so zu erklären, wie Herr Drosten Sars Cov 19 erklärt. Und was lese ich? Schlagworte: Profitgier und überhöhte Mieten. Schade. – Heinrich Esslinger
Es ist ein Traum: Da gibt es zwei Bürgermeisterinnen, die sich ernsthaft daran machen, ihre Stadt umzuformen als lebens- und liebenswerte Stadt für die Menschen, die darin wohnen und arbeiten wollen – die nicht die Investoren machen lassen, die gewachsene Viertel zerklotzen – angeblich um Wohnraum zu schaffen, phantasielos und kalt, Betongold halt. Ich wünsche den Bürgermeisterinnen Erfolg und viele Nachahmer*innen! – Dr. Ursula Augener
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ihr Appell klingt wie ein schönes Märchen. Derweil stellen Architekten ihre exaltierten Gesten ins Internet. Unvergessen Notre-Dame. Oder Beispiel Theaterneubau Frankfurt. Da setzen sich besorgte Bürger an einen Tisch und entwerfen den neuen Theaterbau der Zukunft, der sich ́im Alten nisten soll ́. Sie wehren sich gegen die Visualisierungen von Stararchitekten und deren utopische Entwürfe. Schlimm, was daraus geworden ist. Vor Wut verpasste ein ́Bürger ́ dem Direktor des Deutschen Architekturmuseums DAM Frankfurt unlängst eine Ohrfeige. Weil er die Bürger anlässlich einer Online-Diskussion zum Theaterneubau außen vor ließ, der Mann nichtsdestotrotz mitsamt Kameramann durch die Hintertür kam und von Wärtern und dem Hausherrn rausgeworfen wurde.
„Die Ohrfeige von Frankfurt“ titulierte Deutschlandradio und hob den Wutbürger gar in die Sphäre von Architekten, die sich schon vor dem Entstehen des Bauhauses nichts geschenkt hätten. Nun also die erste Ohrfeige in der Geschichte der Architektur. Gemeint war nicht der arme Direktor, der dem in einer Frankfurter Initiative engagierten Bürger in die Quere kam, sondern stellvertretend der Modernismus, der Frankfurts anonymes gläsernes Opernfoyer partout erhalten will. Jetzt wurde es auch noch unter Denkmalschutz gestellt und das Neue kann nur noch im Neuen nisten. Nichts mit Wäldchen, Holzbauweise und modernem Theater in wieder aufgebauten Jugendstilmauern aus Stein. Mehrspurige Straßen umbrausen und Hochhäuser umstellen die Theaterdoppelanlage, die so marode ist, dass der Stadtrat beschloss, sie abzureißen.
Bis eben auf das geschütze Glasfoyer, das die Stadt nicht mehr ohne triftigen Grund abbrechen darf. Ein kluger Schachzug der oberen hessischen Denkmalbehörde. Ich fände es schon wichtig, Sie würden über die Frankfurter Querelen berichten. Und darüber, was aus der „Macht von Bürgern“ werden kann. Als Architekt hatte ich bislang die Bürgerinitiative unterstützt, aber es ist sinnlos, an deren Rekonstruktionsplänen festzuhalten. Sie werden in Frankfurts Amtsstuben und Presseredaktionen einfach tot geritten.
Daher habe ich mich dem denkmalgeschützten Glasfoyer zu- und von der Utopie eines originalgetreuen Wiederaufbaus des Altens Schauspielhauses von 1902 abgewandt. Und eine – weniger ́exaltierte ́ – aber extravagante architektonische Geste entworfen, die ich in Kürze dem Oberbürgermeister vorschlagen werde. Wie bei den neuen spektakulären Opernhäusern Kopenhagen und Athen soll über über dem 120 Meter langen Glasfoyer von 1963 des Architekten Otto Apel ein frei kragendes Theaterdach schweben, das die beiden Bühnenstätten Oper und Schauspiel unter sich birgt. Es ist sinnlos, gegen die Mauern der Stadt anzulaufen, aber vielleicht ein Weg, unter dem neuen Dach die noch verbliebenen Fragmente des alten Theaterbaus des Architekten Heinrich Seeling zu retten.
Denn diese stehen, obwohl schutzwürdig, nicht unter Denkmalschutz. Auch die letzten Reste des Theaterbaus des Baumeisters der noch heute genutzten Opernhäuser von Nürnberg, Kiel, Freiburg, Halle und Aachen können geopfert werden. Womit das Märchen von der Macht und Mitwirkung der Bürger in der Mainmetropole schon ausgeträumt wäre. „Die Zukunft gehört der selbstbewußten Stadt“. Die Pandemie hat auf die modernistische Frankfurter Stadtpolitik hinsichtlich des Milliardenprojekts Theaterneubau jedenfalls keinen Einfluß. – Axel Spellenberg
Erstmal vielen dank für den ermutigenden Artikel von Hanno Rauterberg, den ich mit großem Interesse gelesen habe. Zu den Problemen in unseren Innenstädten möchte ich sagen: Es gibt für mich fast nichts Grauenhafteres als viele deutsche Fußgängerzonen! Wann immer es mir möglich ist, gehe ich dort nicht hin! Und Einkaufszentren mit austauschbaren, seelenlosen Geschäften brauche ich auch nicht! Ich habe kein Mitleid mit Marketingexperten, die mich nur als Konsumtier sehen. Deswegen kann jetzt alles nur besser werden.
Ich freue mich schon und bin dabei! Innenstädte sind nicht nur zum konsumieren da! Außerdem sind die Besitzer von Häusern mit Ladenenzeilen oft nur an der höchstmöglichen Miete interessiert und wohnen selbst ganz woanders. So entstehen Un-Orte, die keiner mag, die man aber manchmal gezwungenermaßen aufsuchen muss. Da kauf ich doch gerne online z.B. bei einem schönen Buchladen, den es aber in meiner Stadt nicht gibt. – Claudia Mucha
Zum Auftakt des Spezials Toyotas Vision der grünen Stadt der Zukunft und dann zum brennenden Thema Verkehr der Smart aus der Sicht eines Fahrers auf dem platten Land und ein radelnder Oberbürgermeister. Etwas mickrig und verzagt. Warum nicht so: Am Abend tippe ich ins Smartphone, dass ich am nächsten Morgen gegen 9:00 in der City eine neue Reisejacke erwerben will und gegen 14:00 einen 2-Tagestrip nach Paris plane. Antwort nach wenigen Sekunden mit einem Vorschlag für alle erforderlichen Verkehrverbindungen einschließlich Tickets, auch für die Metro in Paris, und Hotel-Buchung.
Algorithmen für solchen Service gibt es längst, die erforderlichen Fahrzeuge auch, nämlich Bahnen und Busse, nur viel enger getaktet als heute. Im ländlichen Umfeld gibt es traffic on demand: geräumige Taxis mit Verbennungsmotoren, betrieben mit Kraftstoffen aus Windenergie. Das erspart uns die Elektromobilität mit all ihren ungelösten Problemen. Das Geld dafür gibt es auch, denn ich brauche keinen eigenen PKW mehr, der 23 Stunden am Tag ungenutzt vor dem Haus steht, wenn da überhaupt noch ein Parkplatz frei ist. Und das ganze lässt sich Schritt für Schritt einführen, nicht mit einer plötzlichen Umstellung für alle.
Nur beginnen muss man damit. Das wirkliche, große Problem ist die Automobil-Industrie mit ihren Arbeitsplätzen und ihrer Wirtschaftskraft, derzeit beides unverzichtbar für Industriestaaten überall in der Welt. Was die dort arbeitenden Menschen betrifft, so stehen uns durch die Industrie 4.0 ohnehin große Veränderungen in der Arbeitswelt ins Haus. Weitblick ist da gefragt, warum nicht auch Visionen, aber auch damit muss man beginnen, ziemlich dringend. – Dr. Jürgen Schnakenberg
Das Titelbild zeigt eine Staddtarchitektur, die sich in Quadern und Rechtecken erschöpft. Soll sich der Formenreichtum in einer vermeintlich genialen Anordnung dieser „Vielfalt“ erschöpfen? Werden dort Menschen hingezogen, die auf Terassen Musik oder Essen geniesen, durch Arkaden lustwandeln, Kinderspielgetümmel lauschen, Ovales, Kurviges, Spitziges usw sehen wollen? Etwas Grün zwischen Einöde ändert nichts an der gegenwärtigen Tristesse. Gute Stadtarchitektur gibt es erst, wenn Reiseführer Touristen auch durch neue, moderne Stadtgebiete führen. – Siegfried Veile
Vielen Dank für das sehr gelungene Spezial zum Thema „Was wird aus der Stadt?“! Es hat mich ganz persönlich sehr gefreut, dass zum Jahresende 2020 nicht ein Rezessions- oder Corona-Lamento den Schwerpunkt des Zeit-Wirtschaftsteils bildet, sondern viele Beispiele, die Mut und Lust machen, die Entwicklung unserer Städte in die eigene Hand zu nehmen. Besonders freut ich mich natürlich über den ausführlichen Bericht über unser Schwester-Projekt aus Leipzig. Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Aufforderung von Seit 21 („Bürger an die Macht!“) zum Thema Wohnen und Stadtentwicklung auch 2021 weiter zu verfolgen.
Wir erleben mit unserem Quartiers-Projekt Alte Feuerwache in Weimar – gerade unter den Erschwernissen der Corona-Zeit – extrem viel (stadt)gesellschaftliches Interesse und auch überregionale Unterstützung. Ganz wesentlich liegt dies m. E. daran, dass wir einen Ort schaffen, der weit über eine reine Mieter*innen-Gemeinschaft hinaus geht und dessen öffentlich nutzbare Bereiche unter pro-aktiver Beteiligung aller Interessierten geplant wurden und werden.
Wir konnten dieses Jahr – erst mit einem Auto-Kino, dann mit einem pandemiesicheren Open-Air-Konzept für Achava Festspiele, Kunstfest Weimar u.a. – unser zentrales Anliegen, die ehemalige Hauptwache der Feuerwehr zu einem lebendigen Kultur- und Innovations-Zentrum für Beteiligung zu machen, bereits in einem Maße einlösen, wie wir es zu Anfang des ersten Lockdown nicht zu hoffen gewagt hätten. So etwas geht nur, wenn viele kreative und engagierte Menschen mit sozialem Verantwortungsgefühl an einem Strang ziehen: Wie Ihr Titel schon sagt, wenn alle Bürger*innen die Entwicklung Ihrer Stadt in die eigenen Hände nehmen können, gewinnen alle. – Jonas Janssen
Sehr gelungen fand ich ihren Artikel “Bürger an die Macht”! In präziser Weise legen Sie eindrucksvoll dar, dass es das Umfeld des Hauses ist, das die Zukunft ausmacht und nicht unser Drang in die Ferne und das Automobil .... Um so unverständlicher ist das, was an Leserecho dazu so erscheint, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Menschen sind, die die Artikel lesen oder ob es da um Präsentation vorgefasster Meinung geht.
Toyotas “woven city” habe ich versucht, auch in meiner Rolle als „Beirat für Unternehmensverantwortung” (eine wirklich unabhängige Rolle, ohne Beschäftigung durch den Konzern) bei Daimler dort als Vorbild zu präsentieren, naja, immerhin gab es Äußerungen wie “wir sind noch nicht so weit,,,,” Ich lege Ihnen auch mal (müssen Sie nicht lesen) mein aktuell überarbeitetes und als Sachbuch bei Springer/Nature erschienenes Büchlein “Urbanismus und Verkehr” an (pdf bitte nicht zur Weitergabe). Das letzte Kapitel ist völlig neu und vielleicht für den “schnellen Leser” interessant. – Prof. Dr.-Ing. Helmut Holzapfel
Leserbriefe zu „Das Machtbündnis“ von Matthias Krupa
Wie Sie sehen, bin ich schon mit Ihnen in Kontakt getreten. Ihr heutiger Artikel „Das Machtbündnis“ hat mir gefallen. Sie haben recht, die Erfolge der EU müssten mehr in den Vordergrund gestellt werden. Meistens hört man oder liest man nur das was nicht so gut geht. Mehr Selbstbewusstsein und Stolz würden den Europäern „gut zu Gesicht stehen“.(ich bin selbst als Deutsch-Franzose überzeugter, manchmal doch etwas enttäuschter Europäer)
Ich vermisse allerdings in Ihrem Artikel den Hinweis, dass wir weiter sein könnten. Gerade die Bundesregierung unter Frau Merkel hat zu viel mit dem Auge der Wirtschaft das Geschehen in Europa betrachtet und beeinflusst. Beispielhaft ist die Umweltpolitik: ständiges Bremsen bei der Automobilindustrie, Landwirtschaft die zu langsam reformiert wird, Tierhaltung die kaum verbessert wird usw... Damals in der erwähnten Sendung hatten Sie mir wirklich imponiert und seitdem lese ich Ihre Texte mit besonderem Interesse. Eine Prise Kritik ist sicher erlaubt... – Robert Camboni
Ich bedanke mich für die Einsicht, dass die Europäische Union gerne und vor allen von Europäern unterschätzt wird. Darf ich um die Ergänzung bitten, dass es sich dabei fast immer um Journalisten handelt. Der normale Bürger kann seine Meinungsbildung nur von diesem zwischen Politik und Presse verabredeten „Wertschöpfungsprozess“ herleiten. – Jürgen Dressler
Danke für diesen Kommentar. Er erinnert an die Aufgaben, die die EU zu erfüllen hat. Bei allen Erfolgen sollten wir aus meiner Sicht einige Dinge nicht vergessen. Die Frage der Rechtsstaatlichkeit sollte nicht zu einer ideologischen Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern führen. Das wäre zerstörerisch. Vielmehr kommt es darauf an, sich sachlich auf einen bereits definierten Standard zu beziehen. Ist dieser Begriff noch nicht instanzlich festgelegt, bleibt nur die Möglichkeit, in einer gesellschaftlichen Debatte mit den Mitgliedern der EU über eine allgemein-gültige Definition zu ringen. Besserwisserei und Deutungshoheit sollten dabei ausgeschlossen sein. – Schmolling
Vom Versagen der EU.Der Beitrag von Matthias Krupa klingt, als habe ihm Ursula von der Leyen die Feder geführt. Keine Rede vom Versagen der Europäischen Union bei der Bestellung des Covid19-Impfstoffs für die Europäer. Statt auf den Impfstoff von BioNTech-Pfizer zu setzen und genügend Dosen zu bestellen, vertraute die EU auf Impfstoffe, die noch gar nicht verfügbar sind bzw. im Zulassungsverfahren Mängel gezeigt haben. China impft innerhalb von vier Wochen 50 Millionen Menschen. In Europa wird es ein halbes Jahr dauern, bis dieselbe Population geimpft sein wird. Fatal ist, dass die Kommission während der Pandemie die Datenschutzbestimmungen nicht gelockert hat, damit Corona-Warn-Apps programmiert werden können, die ihren Namen wirklich verdienen. Die EU nimmt lieber hohe Todeszahlen in Kauf, als die Heilige Kuh Datenschutz in Frage zu stellen. Was ist das für eine Ethik?
Taiwan – eine Demokratie! – zeigt, wie die Zurückverfolgung der Infektionen gelingen kann, wenn man das Tracing per App erlaubt. Der „Rechtsstaatsmechanismus“ der EU, den Matthias Krupa lobt, ist ein stumpfes Schwert. Er gilt nur für Korruptionsfälle in Verbindung mit EU-Strukturhilfen. Gegenüber der systematischen Aushöhlung des Rechtsstaats aus reiner Machtpolitik, wie sie z.B. die polnische Regierung praktiziert, ist der Mechanismus machtlos. Das jüngst unterzeichnete Handelsabkommen zwischen der EU und China ist ebenfalls ein fragwürdiger Deal.
Der Verzicht auf Zwangsarbeit (man denke an die Uiguren) ist für die chinesische Führung nur ein Lippenbekenntnis. Der Passus, China werde „dauerhafte und nachhaltige Anstrengungen“ unternehmen, um Zwangsarbeit in chinesischen Fabriken zu unterbinden, ist nichts wert, solange ein wirksamer Prüf- und Sanktionsmechanismus fehlt. Die chinesischen Kommunisten sind Meister darin, anstößige Dinge einfach umzudeklarieren: Aus Straflagern werden dann Ausbildungsstätten und Bildungseinrichtungen. Wie naiv ist die EU-Führung, wenn sie dem chinesischen Diktator Xi so auf den Leim geht? – Rainer Werner
1. Krupa lobt eine EU, die keine Kraft hat wirklich Union zu werden, eine EU die eigentlich EWG geblieben ist. Bezeichnenderweise gibt es europaweit auch kaum einen Politiker und kaum eine politische Partei, die sich wirklich für eine Union einsetzen. Verbal sind alle natürlich die größten Europäer. Die deutsche Regierung lehnt Einigungsvorschläge Frankreichs ab. Eine gemeinsame Außen-, Verteidigungs- und Steuerpolitik findet nicht statt, eine europäische Wertegemeinschaft ist Illusion (Polen, Ungarn). Der Brexit lässt den Briten die meisten Rechte, die sie als EU-Mitglied schon hatten, jetzt sind die Briten nur unabhängiger.
(Wo ist eigentlich das in den Verhandlungen so herausgestellte Irlandproblem geblieben? Wieviele Milliarden zahlen die Briten denn nun mit dem Austritt an die EU? War das nur Diplomatentheater?) Es ist nicht ausgeschlossen, dass andere Staaten dem britischen Austritts-Beispiel folgen. Von einem Machtbündnis zu reden, wenn kein Interesse besteht, die nationalen Egoismen einzugrenzen, ist nicht überzeugend. M. Kruppa mogelt sich und uns um diese Wahrheit herum, wenn er nicht auf die kraftlosen Entscheidungen der EU verweist.
Schon nach Abschluss der Römischen Verträge vermittelten mir Schule und Elternhaus große Hoffnungen auf ein geeintes Europa als geopolitisches Äquivalent im Weltgeschehen. Ich habe daran geglaubt. Jetzt weiß ich, die Verantwortlichen sind dazu unfähig und ideenlos. Die Europäische Union als Machtbündnis gibt es nicht, die EU ist eher ein Trauerspiel als ein Machtbündnis. Glücklicherweise haben wir trotzdem Frieden und Wohlstand . Das war zu Zeiten der alten EWG mit viel geringerem Aufwand aber auch so. Brauchen wir dann die EU in ihrer heutigen Form? – Hans-Joachim Dietz
EU Subenstionen corona Hilfen? Ein Stoppfschild bei Auszahlungen für Ungarn und Polen? Bei der Kompromissbereitschaft der EU mit Sicherheit Nicht. Beispiele in Italien, Frankreich und Spanien gibt es genug,dass der Apparat nicht durchgreift. Allgemeinverschuldung der EU zum ersten Mal Ein Erfolg? Für wen? Diese Antwort fehlt,denn sie ist mit Sicherheit ein Weiterer Garant für Staaten, die nicht reformieren wollen und können. Denn Dass müsste mand die eigene Klientel verärgern. Wer macht das schon? Es gäbe noch mehr zum Artikel zu sagen, aber der Platz fehlt. – Manfred Mengewein
Es ist schon erstaunlich, wie kontrovers Entscheidungen beurteilt werden können. So sieht der Autor die Entscheidung über den Corona-Hilfsfond als Erfolg an. Man könnte auch sagen, dieser Fond ist ein vertragswidriger Eintritt in einen Schuldenfond – am Parlament vorbei. Oder die Anmerkung, die EU ist solidarischer geworden. Ist sie nicht. Die notwendige Einstimmigkeit bei vielen Entscheidungen führt zu oft zu Blockaden und lauen Kompromissen. Von einem ernst zu nehmenden Machtbündnis ist die EU leider noch weit entfernt. – Werner Koschorreck
Vielen Dank für den schönen Artikel über die EU. Das hat beim Lesen richtig gut getan. Im 3. Absatz beschreiben Sie die Arbeit der Unterhändler so plastisch, dass ich richtig Lust bekam, mehr über die Personen, die dahinter stecken, zu wissen. Das würde mir jedenfalls das Gebilde EU viel näher bringen. Vielleicht geht das anderen Menschen auch so? Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn das möglich wäre. – Uschia Bündgen
Leserbriefe zu „Stärke aus Demut“ von Robert Pausch
Danke für Ihren Artikel über die ZEITgemäße Betrachtung der Machtverschiebung von der Politik zur Wissenschaft. Auch ich halte jedoch die demokratische Legitimation hierfür nicht gegeben. Notwendig geworden für unsere Zukunft nach dieser ZEIT ist aber das Wissen und nicht die politische Ohnmacht. Wir alle sollten hierdurch optimistisch nach vorne schauen. – Bernd Ritter
Wissenschaftliche Methoden sind sicherlich andere als politische und es ist völlig legitim, auch bei politischen Entscheidungen wissenschaftlich basierte Fakten einzubeziehen. Von einer „Virologendiktatur“ unter der Corona- Pandemie zu reden, ist natürlich Unsinn, da stimme ich zu. Solche Sprüche können vorwiegend nur aus der Ecke derjenigen kommen, die lieber an „Fake-News“ glauben und von Verschwörungstheorien fabulieren. Vielleicht ist es einfacher für diese Leute, als sich mit der Realität auseinanderzusetzen.
Leider kann man diesen Un-Irrsinn nicht komplett ignorieren, denn dieser führt zu problematischen Verwerfungen und Spaltungen in der Gesellschaft. Das ist so offensichtlich, dass selbst die Bundeskanzlerin sich in ihrer Neujahrsansprache genötigt sah, darauf einzugehen. Wohl kaum einer kann von sich behaupten, nie Fehler zu machen. Richtig, Fehler einzugestehen und um Verzeihung zu bitten, ist eine menschliche Stärke. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Vermögen künftig in der Politik kultiviert wird und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil der Bevölkerung es zu schätzen wüsste. Ja, so kann man Vertrauen in die Politik schaffen. Genauso wichtig für das Vertrauen ist aber auch eine größtmögliche Transparenz im politischen Handeln.
Das gilt besonders, wenn unangenehme Entscheidungen und solche von großer Tragweite getroffen werden müssen; die Gründe und – ganz wichtig – die Folgen müssen klar benannt werden. Nur so kann eine seriöse und sachgerechte Politik aussehen und keine, die sich an den nächsten Wahrergebnissen oder am Machterhalt orientiert. Und nur so wird die Bevölkerung in die Lage versetzt werden, Entscheidungen richtig zu verstehen und dann weitestgehend mitzutragen. Darauf kommt es an. Wie wichtig das ist, zeigt sich gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. – Regina Stock
Stimme dem Kommentar von Robert Pausch durchaus mit Enthusiasmus zu. Weil Demut in der Tat nicht allein als christliche Tugend, sondern zudem als eine Tugend der Klugen und Starken zu betrachten ist. Überdies bin ich, ob nun mit oder ohne virale Ausnahmesituation, der festen Überzeugung, dass das Einzige, was das Leben einen aufgeklärten Menschen mit Gewissheit lehren kann, beständige Demut, das Gegenteil von Arroganz und Ignoranz also, sein muss. Viel überraschender indes erscheint mir – besonders unter dem „Brennglas“ der Pandemie – manch außerordentlich rege Einfalt und Eigensucht, mit der wir „kraft“ Conditio humana den maßgebenden Konditionen der Natur gemeinhin zu begegnen gedenken.
Der Versuch, Realität und Perspektive mit Vernunft und Verantwortungsbewusstsein zu erfassen, mithin Besonnenheit und Akzeptanz zu vermitteln, ist dabei zwar zuvorderst, jedoch keine exklusive Forderung an die Damen und Herren Politiker. In meine Beobachtung hiernach, dass Angela Merkel, die auch der werte Robert Pausch völlig zu recht lobend erwähnt, „nicht ganz zufällig“ als Bundeskanzlerin der deutschen Regierung vorsteht, mischen sich angesichts des kommenden Herbstes nicht zuletzt deshalb zunehmend Wehmut und Skepsis. Ihr Intellekt, Ihre Disziplin und Resilienz machen den Unterschied; sie wird der deutschen Politik zweifellos fehlen. – Matthias Bartsch
Gut, dass es Politiker gibt, die sich auf den Weg der Tugend machen und sich von Weisheit, Gerechtigkeit, Mut und Mäßigung leiten lassen. Robert Pausch nennt es Demut. Politik ist immer Gebrauch von Macht. Kommunikation in der Politik, selbst der Ausdruck von Zweifel, ist Machtkalkül. Politik aber, die sich im Kalkül erschöpft, ist abstoßend. Eine Kommunikation, die mit dem Politiker als Person und zugleich mit dem jeweiligen Anliegen spürbar eng verbunden ist, ist glaubwürdig. Glaubwürdigkeit in Kombination mit guten Argumenten überzeugt.
Glaubwürdigkeit schafft Vertrauen und Verbindung. Gerade Zweifel zeigen den Politiker als Menschen, der mit einer Sache ringt. Dies zeigen zu können, wo es wirklich angebracht ist (also nicht dauernd, eher selten), ist Stärke. Angela Merkel beherrscht dies wie sich selbst und wie sonst niemand. Hubert Woidke, Reiner Haseloff, Michael Kretschmer haben gezeigt, dass sie damit Wahlen gewinnen können. Stärke aus Demut: Das Motto für 2021, dem Jahr mit so vielen Unsicherheiten, so vielen Herausforderungen und so vielen Wahlen. – Reinhard Koine
Wird in der Wissenschaft ein Irrtum entdeckt, so setzt sich die „bessere“ Sichtweise in einem an-schließenden Prozess (eventuell über Jahre mit „Paradigmenwechsel“) durch. Führt jedoch der Irrtum in der Politik zum Machtverlust, dann ist keineswegs sichergestellt, dass die neue politische Kraft nicht ähnlichen Unsinn fortsetzt. Wenn dazu über die „asozialen Medien“ und WIKIPEDIA bei politisch heiklen Themen, die auch viele Politiker*innen nicht gut verstehen, vorrangig Unsinn oder Halbwissen verbreitet wird, hat der politische Prozess ein ernstes Problem. – Prof. Emeritus Dr. rer. pol. Wolfgang Ströbele
Politik bedeutet: Handeln zum Wohl des Souveräns, also des Volkes und nicht nur des Wahlvolkes (siehe die Eidesformel!). Wer Berufspolitiker wird, ob im Bund, den Ländern oder in den Kreisen und/oder Gemeinden wird in der Regel nicht dazu gezwungen. Wenn man genau hinschaut sind sehr viele dieser Berufspolitiker Juristen, Lehrer und eine Vielzahl aus dem öffentlichen Dienst. Daraus resultiert das Verständnis oder besser das Missverständnis zum „normalen“ Bürger. Nichtwissen und langatmige Erklärungen zu begangenen Fehlern ist keine Stärke aus Demut sondern jeweils der Versuch eigene Unzulänglichkeiten schön zu reden und möglichst die Fehler bzw. die Fehleinschätzungen bei anderen (vorwiegend im anderen politischen Lager) zu suchen. Wenn es wirklich so wäre, dass Politik keinem grossen Plan folgt und zu keiner ausgeklügelten Strategie fähig wäre dann ist es um unser Gemeinwohl sehr schlecht bestellt.
Planvolles Vorgehen und Zukunftsstrategien sind unverzichtbar. Wie sollen sonst Haushhaltspläne und mittel-bis langfristige Finanzplanungen entstehen; die wesentliche Eckpfeiler für plan-und sinnvolles Handeln sind (Infrastruktur etc. etc.). Im Prinzip ist das politische Handeln in Zeiten der Corona-Pandemie auch nicht viel anders zu bewerten. Auch hier müssen die richtigen Fachleute zu Wort kommen und der Erkenntnisgewinn muss zu entsprechende Maßnahmen führen. Auch auf die Gefahr hin, dass hierbei Fehler gemacht werden.
Hier müssen dann die Politiker die Chuzpe und/oder die Grösse haben Fehler zuzugeben und zu lernen damit umzugehen. Wenn Politiker aus ihren Fehlern lernen und Erkenntnisse teilen und dann so Vertrauen wachsen lassen und Vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen, die dann wirkungsvoll und überzeugend und überprüfbar daher kommen, können die jeweils Betroffenen damit leben (siehe Amtseid!) Im Übrigen sind Politiker auch nur Menschen (wie „Du“ und „Ich“!). – Felix Bicker
Robert Pauch behandelt ein wichtiges Thema: das «Verhältnis von Wissenschaft und Politik». Beide Bereiche haben etwas gemeinsam, sie werden vor allem vom Steuerzahler finanziert und haben eine gemeinsame Aufgabe: eine gute Zukunft für alle zu ermöglichen und dies durchs Lösen der anstehenden Probleme. Wissenschaft hat vor allem die Aufgabe Lösungen zu finden, bzw. die Grundlagen fürs Finden von Lösungen zu schaffen. Politik hat die Aufgabe, für die nötigen Lösungen die nötige Akzeptanz zu beschaffen und die nötigen Massnahmen durchzusetzen.
In der Politik geht es auch ums Einfordern von Opfern und Einschränkungen etwa auch für lokale und globale Solidarität. Beim Begründen dieser Forderungen muss die Wissenschaft helfen. Das ist nötig, da es dabei oft um Zielkonflikte geht. Dies betrifft Themen wie zum Beispiel weltweites solidarisches Handeln, lokales und globales Wirtschaftswachstum, Naturschutz, Begrenzen des Klimawandels, etc. Dabei geht es immer weniger um relativ einfache moralische Fragen sondern darum, die Zielkonflikte (etwa zwischen den Menschenrechten auf Lebensunterhalt und dem Menschenrecht auf Eigentum) zu lösen, im Interesse eines höheren gemeinsamen Ziels: eine gute Zukunft für alle.
Es geht dabei um Demut gegenüber der Tatsache, dass es einerseits nötig ist zu handeln, aber andererseits das Risiko der Überreaktion besteht. Zum Beispiel wurden fürs von der WHO empfohlene Einlagern von Medikamenten gegen die Vogelgrippe Milliarden ausgegeben, was sich im Nachhinein als Fehlinvestition erwies. Ein anderes Beispiel betrifft die Frage, wieweit Entwicklungshilfe auch Nachteile bewirken kann, durch Fördern von Korruption, Reduktion von Eigenverantwortung (z.B. bezüglich Demographie). Auch hier ist die Unterstützung der Politik durch die Wissenschaft gefordert. Schwierig kann es dann werden, wenn ein Wissenschaftler oder Politiker bezüglich seiner Karriere einem Zielkonflikt gegenübersteht und zwar dann wenn es darum geht, notwendige, unangenehme (eventuell auch mit Unsicherheit oder Risiken verbundene) Entscheidungen vorzuschlagen. – Dr. Gernot Gwehenberger
Leserbriefe zu „Wir sehen uns“ von Andreas Lebert
Danke fuer diesen begeisterten und begeisternden Beitrag zur Astronomie, insbesondere M13, an dem ich auch schon geforscht habe (https://www.eso.org/~smoehler/). Allerdings ist Ihnen dabei eine Verwechslung passiert: Der Ringnebel ist ein planetarischer Nebel und kein Supernova-Ueberrest wie z.B. der Krebsnebel (https://www.eso.org/public/images/eso9948f/), der leider nicht so ruhig aussieht. – Sabine Moehler
Ein Sternbild, ein heiliger Berg, bei mir selbst eine alte Eiche – für uns Menschen ganz besondere Freunde, denen wir stumm unsere Wünsche und Sorgen, unseren Kummer und unsere Freude erzählen; in der stillen Hoffnung, daß sie sie als Mittler und Boten dem für uns unerkennbaren und unbegreiflichen Schöpfer und Bewahrer des Alls, unserer Erde und Menschheit überbringen. Dabei hoffen wir auf einen Widerhall, den wir mit unseren Sinnen erkennen und begreifen können; auf „...das Unbeschreibliche, hier ist’s getan...“ – Dr. med. Ulrich Pietsch
Heute wurde ich beschenkt mit dem Artikel über die Sterne von Andreas Lebert. Also ein großes DANKESCHOEN zurück an ihn und die anderen brillanten ZEIT Autoren. Ich bin danach auch sofort illegal über die Grenze von Passau nach Wernstein gewandert, um meiner Freudin und Arbeitskollegin die Artikel über die Sterne zu bringen. (in Wernstein bekommt man die ZEIT nicht) da ihr Mann ein leidenschaftlicher Sternebeobachter ist. Meiner Freundin hatte ich mit whats app schon den Artikel kopiert und sie dachte, dass so etwas Schönes nur eine Frau schreiben könne und war erstaunt, dann den Namen eines Mannes als Verfasser zu lesen.
Heute wird ihr Mann Heinz-Walter sein Teleskop in den Kofferraum packen und auf einen klaren Sternenhimmel hoffen. Sie sehen, welche Aktivitäten so ein Artikel bewirkt! Wr beide Resi und ich , schämen uns sehr, weil wir bisher zu den Frauen gehörten, die über dieses Hobby der Männer schmunzelten. Dabei fehlt uns offensichtlich die Geduld, das Tanzen und Singen des Weltalls zu erspüren. Das wird sich jetzt ändern. Besonders gefallen hat mir die Passage über die Zeit, da wir ja immer die Vergangenheit mit unseren Fernrohren betrachten. Ich bin so froh, dass es ihre Zeitung schon so lange gibt und mich beeindruckt immer noch die so gründliche Recherche und die mit solcher Klarheit geschriebenen Artikel. – Astrid Liedl
Ihre Ausführungen zu M13 und überhaupt zum Sterneschauen haben mich als begeisterte Sternenguckerin sehr erfreut, zumal Sie neben Technischem das darüber hinaus Schöne und Bedeutsame im Kontakt mit den Sternen hervorheben. Ich kann bestätigen, dass man das über viele Jahre Erfahrene und Erlebte nicht mal eben auf die Schnelle vermitteln kann. Es ist durchaus mühsame Beziehungsarbeit, das Sternegucken. Und ein kostbarer Schatz, den es auch zu hüten gilt. Ich möchte Ihnen, der Sie vom Klang des Weltalls schreiben, das Buch und die Hör-CD NADA BRAHMA: Die Welt ist Klang von Joachim Ernst Behrendt nahelegen. Eine Bereicherung. Seinerzeit im SWR Radio eine Sensation. Die Welt könnte DAS jetzt durchaus brauchen.
Ich konnte mit einem Teleskop nie etwas anfangen, sehe daher nicht das, was Sie sehen. Aber ich bin zufrieden, meine Freunde, die Sterne, verläßlich immer wieder , je nach Jahreszeit die einen mehr als die anderen, wiederzufinden. Sie sind mir oft Trost, Verheißung, machen mich glücklich und Kummer wird kleiner in ihrem Angesicht. Auch ich habe einen Enkel, noch klein, erst 15 Monate alt, aber es ist in der Familie völlig klar: für seinen Zugang zu den Sternen werde ich zuständig sein. Darauf freue ich mich sehr. Ich danke Ihnen für diesen wunderbaren Artikel über M13, der letztlich mehr ist als das. Ich wünsche Ihnen einen guten Jahreswechsel mit freiem Blick auf das Wintersechseck mit Orion in der Mitte....allein dieser Anblick ist Reichtum. – Birgit Finken
Herzlichen Dank für diesen Artikel, in welchem der Autor so berührend seine Begeisterung für die eigene Beobachtung von Himmelsobjekten schildert. Ich selbst – Jahrgang 1959 – habe als junger Mann zwischen 15 und 30 viele Nächte an diversen Fernrohren zugebracht und genau die so geschilderten Erfahrungen und Eindrücke erlebt. Völlig analog ohne jegliche computergesteuerten Nachführungen habe auch ich mich von hellerem Stern zu schwächeren Sternen vorgestastet um schließlich beim erwünschten „Nebel“ aus dem Messier- oder NGC-Katalog zu landen. Der Preis für durchwachte Nächte und klamme Finger war dann öfters noch ein grandioses Vogelkonzert in Frühlingszeiten und ein innerer Abstand zu den alltäglichen Mühseligkeiten, der auch jetzt im Alter noch geblieben ist.
Immer hat mich dabei auch der Satz von Immanuel Kant begleitet.....die zwei Dinge welche das Gemüt immer neu erfüllen. („Das moralische Gesetz in mir und der gestirnte Himmel über mir.“) Wobei ich mit Blick auf die heutige Lage der Menschheit mittlerweile doch eher zu Einstein neige:“ Zwei Dinge sind unendlich – das Universum und die menschliche Dummheit – nur bei Ersterem bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ – Thomas Geiger
Eigentlich suche ich meine Freude lieber auf unserer schönen Erde als am Himmel. Die Mondlandung und sonstige Weltraummissionen haben mich ziemlich kalt gelassen. Aber jetzt, nachdem ich diesen hinreißenden Liebesbrief an die hunderttausend glühenden Sonnen des M 13 gelesen habe, schäme ich mich über soviel irdische Ignoranz. Was muss das für ein wunderbarer Freund sein, mit dem ein Mann seit drei Jahrzehnten über fünfundzwanzigtausend Lichtjahre hinweg seine Nächte teilt, ihm sein Herz in Freude und Leid ausschüttet. Trost und Inspiration aus dem Kosmos! Es muss erhebend sein, das Weltall singen zu hören (ich bin sicher, Ennio Morricone hat diese Klänge vernommen). Es muss schön sein, M 13 zum Freund zu haben, aber ich finde, er hätte einen schöneren Namen verdient. – Ludwig Engstler-Barocco
Selten hat mich ein Artikel so angerührt und mir aus dem Herzen gesprochen. Danke für die inspirierenden Worte und Geschichte! Für den Größenvergleich habe ich ein Lieblingslied von Monty Python bei der Organspende im „Sinn des Lebens.“ Schwarzer Humor hilft mir im Angesicht des Universums enorm, wenn auch das Staunen über eine sternklare Nacht niemals nachlässt. Und lachend staunen ist nicht der schlechteste Gemütszustand, in egal welchen Zeiten man lebt... – Anja Slowinski
Leserbriefe zu „Eine bodenlose Ungerechtigkeit?“ von Mark Schieritz
Der Beitrag „Eine bodenlose Ungerechtigkeit?“ von Mark Schieritz liefert einen sehr informativen Überblick über die Bodeneigentumsfrage und ihren historischen Hintergrund, enthält jedoch bezüglich den Lösungsansatz Bodenwertsteuer leider zwei Fehler und eine zumindest irreführende Aussage, auf die ich Sie und Herrn Schieritz hiermit gerne hinweisen möchte, verbunden mit der Bitte um Veröffentlichung.
Erstens heißt es in dem Beitrag, „der Besitzer eines Hochhauses würde genauso viel Steuern zahlen wie der Besitzer eines Einfamilienhauses mit der gleichen Grundstücksfläche“. In dieser vom Autor formulierten Allgemeingültigkeit ist die Aussage falsch und grob irreführend. Die rechtlich zulässige Bebaubarkeit eines Grundstücks (Art und Maß der möglichen baulichen Nutzung) zählt mit zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf den Bodenwert. Die Möglichkeit, auf einem Grundstück ein Hochhaus zu errichten, steigert den Bodenwert, vor allem verglichen mit einem Grundstück, auf dem zuvor nur ein Einfamilienhaus zulässig war.
Daher lastet, ceteris paribus, auf einem Hochhausgrundstück eine HÖHERE Bodenwertsteuer als auf einem Einfamilienhausgrundstück. Allgemein richtig gewesen wäre die vom Autor gewählte Formulierung einzig in einer Erläuterung über eine Steuer auf die reine Grundstücksfläche, ganz ohne Berücksichtigung des Bodenwertes, aber dann reden wir praktisch über das Gegenteil einer Bodenwertsteuer. Ihre Darstellung wäre ansonsten nur in einem extrem unwahrscheinlichen Spezialfall zutreffend mit Bezug zur Bodenwertsteuer, nämlich wenn auf dem Einfamilienhausgrundstück ein Hochhaus baurechtlich zulässig wäre, doch dieser entscheidende einschränkende Hinweis fehlt im Beitrag. Zweitens heißt es darin, die Bodenwertsteuer besteuere den Wertzuwachs des Bodens.
Auch dies ist falsch, denn die Bodenwertsteuer ist eine Steuer auf den (gesamten) Bodenwert, nicht bloß den Wertzuwachs. Das unterscheidet sie ganz wesentlich, etwa in Fragen der Wertermittlung, Praktikabilität, Gerechtigkeit und Wirkung, von einer Bodenwertzuwachssteuer. Beide Steuermodelle werden im politischen Raum diskutiert, doch Herr Schieritz vermengt sie leider in einem einzigen kurzen Satz. Die Bodenwertsteuer ist tatsächlich etwas völlig anderes als eine Bodenwertzuwachssteuer, vor allem ist Erstere einfacher zu erheben, gerechter in ihrer Verteilung und sinnvoller in ihrer Wirkung.
Drittens, schreibt Herr Schieritz, die Bodenwertsteuer „würde dafür sorgen, dass die Allgemeinheit von den steigenden Grundstückswerten profitiert“. Das ist zumindest irreführend, da dieser Effekt nur eintritt, wenn die Gemeinde nicht mittels Hebesatzabsenkung korrigierend eingreift. Tut sie dies aber, was mindestens wahrscheinlich ist, führen steigende Grundstückswerte mitnichten zu einem höheren Aufkommen an Bodenwertsteuer. – Dr. Ulrich Kriese
Wie Mark Schieritz bin ich der Überzeugung, dass die Möglichkeit des privaten Eigentums an Grund und Boden zu ungerechten Vermögenszuwächsen einerseits führt, aber andererseits die Hauptursache der Mietpreisverwerfungen in den Städten ist. Diesem mit einer Bodensteuer zu begegnen, halte ich allerdings für extrem bürokratisch, da ständig die Steuersätze der Wertentwicklung angepasst werden müssten. Außerdem wird damit ja nicht die Ursache des Dilemmas behoben, es ist sogar zu vermuten, dass die Eigentümer sich einfach über eine Mieterhöhung wieder von der Steuer entlasten. Ist es nicht denkbar, der Staat holte sich Grund und Boden wieder zurück?
Ein geeignetes Vehikel dafür wäre die Erbschaftssteuer: in den nächsten Jahrzehnten wird die zu entrichtende Erbschaftssteuer zunächst mit entsprechenden Anteilen an Grund und Boden gezahlt – falls Grund und Boden zur Erbmasse gehören. Das wäre zwar ein längerer Prozess, würde aber dauerhaft zu einer einfachen und nachhaltigen Lösung führen. Auch die Erbschaftsbesteuerung von Produktivvermögen wäre mit diesem Verfahren deutlich liquiditätsschonender. Der Staat als Alleineigentümer des gesamten Grund und Bodens der Bundesrepublik würde künftig über Erbpacht seinen Bürgern Grundstücke zur Verfügung stellen und könnte darüber sogar bestens deren Verwendungszweck sozialverträglich bzw produktiv steuern – Spekulationen und sonstige Fehlallokationen gehörten der Vergangenheit an. – Dietrich Junker
Geld und Energie können nicht erzeugt und nicht zerstört werden (Hauptsatz der Thermodynamik): die Miete die gezahlt wird, hat dann jemand anderes. Was ist daran ungerecht? Was ist ungerecht, wenn eine Witwe zu ihrer mickerigen BFA-Rente noch Mieteinnahmen zu ihren Lebensunterhalt einnimmt? Was ist ungerecht, wenn ein Mieter ausziehen muss? In Brandenburg gibt es riesige Gebiete mit spottbilligen Mieten. Ein Sozialhilfeempfänger hat Anrecht auf einen „angemessenen“ Lebensstandard, er hat keinen Anspruch auf einen 326 PS starken 3,0-Liter-Reihensechszylinder oder auf eine Wohnung im Prenzlauer Berg oder einen anderen Luxusartikel. Was ist daran ungerecht?
Kartoffeln sind teuer, wenn viele Leute Kartoffeln wollen, Kartoffeln sind billig, wenn viele Kartoffeln auf dem Stuttgarter Markt angeboten werden und wenige Leute Kartoffeln wollen. Das gilt auch für Wohnungen. Eigentlich sehr einfach. Was ist daran ungerecht? Der glücklichste Moment meines Lebens war der 25. Dezember 1991, das Ende des Kalten Krieges. Mit der Auflösung des weltgrößten sozialistischen Staates ging eine Ideologie zu Ende, die 67 Millionen Menschenleben gekostet hat. Wer sehnt sich diese Zeiten zurück? – Ulrich Bosshammer
Was Sie als Ungerechtigkeit bezeichnen, ist asozial. Ein demoliertes „Haus“ ist nicht reparabel. Ein Blick in die Geschichte zeigt, es gab nie wirklichen privaten Grundbesitz, nur Lehen. Es gibt auch keinen Privatbesitz an Wasser, Bodenschätzen, der Luft und der Biosphäre, also im weitesten Sinn an Flora und Fauna. Die Nutzung dieser Allgemeingüter kann nur die Allgemeinheit selbst, sprich der Staat als deren Vertreter regeln, also gewisse Nutzungsrechte gg Gebühr erteilen. Warum dann diese Ausnahme bei Grund und Boden? Überlegungen zu steuerlichen Gegenmaßnahmen führen in die Irre und die Täter könnten sich als Opfern darstellen.
Bodenwertzuwächse sind ein wundersames Vehikel des Kapitals die im wesentlichen vom Lohnsteuerzahler (Lohnsteuer ist für die meisten Kommunen die Haupteinnahmequelle) in den Kommunen geschaffen Werte mit ständigen Mieterhöhungen wieder abzuschöpfen. Es gibt hierfür sicher so viele Erklärungen, wie es Nutznießer dieses Systems gibt. Es bleibt schlicht und einfach Diebstahl an Gemeineigentum unter staatlicher Aufsicht. Entsprechend steigt ständig der Anteil am Nettoarbeitseinkommen, der für Miete auf zu wenden ist. In Großstädten kann sich kaum ein Normalverdiener mehr eine angemessene Wohnung leisten, zugleich sind viele Kommunen überschuldet und müssen Sozialleistungen kürzen, ein offenbar willkommener Nebeneffekt den Druck auf die Kleinen hoch zu halten.
Die Frage ist, warum lässt unser Staat das zu? Ist er nicht fähig oder nicht willig zur Abhilfe? Die starke Verflechtung von Staat und Kapital ist offensichtlich Hintergrund der staatlichen Untätigkeit. Wirklich hilft da nur eine Verstaatlichung von Grund und Boden. Es würde diese Abzocke beenden, den Lohnempfänger entlasten und der Staat könnte die bei kaum eingeschränkten Nutungsmöglichkeiten des Bodens diese sozial-und naturverträglicher direkt mitgestalten. Es gibt noch viele positive Nebeneffekte einer solchen Regelung. – H. Giller
Alles schon vor 40 Jahren diskutiert. Erbpacht taugt nichts. Selbst Immobilieneigentümer habe das immer abgelehnt. Ihr Autor Henning Sussebach wird auch bei anderen Hauseigentümer auf Granit stoßen. Der Staat hat bei jedem Eigentümerwechsel ohnehin die Hand im Spiel. Jede Bewegung muß der Staat absegnen. Ohne eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (so nennt man das in der Fachsprache) geht gar nichts. Das wird aber kaum ausgenutzt. Der Staat muß nämlich den Kaufvertrag mit all seinen Vor- und Nachteilen übernehmen. – Gunter Knauer
in Ihrem oben genannten Artikel erwähnen Sie eine Bodenwertsteuer, die eine Möglichkeit wäre, den „unverdienten Wertzuwachs“ abzuschöpfen und ganz nebenbei dadurch auch mehr Wohnraum zu schaffen. Dies mag für Bauherren eines Einfamilienhauses möglicherweise einen Anreiz bieten, aber wohl auch eher recht eingeschränkt. Denn wer ein Haus nur für die eigene Familie bauen will, denkt meist weniger an eine Ersparnis durch eine weitere Wohnung, sondern legt zumeist doch mehr Wert darauf, das Haus nicht mit anderen teilen zu müssen.
Eine Wohnungsbaugesellschaft hingegen legt solche Steuern auf die Betriebskosten um, wie es ja derzeit auch bei der Grundsteuer geschieht. Auch ist es eher wahrscheinlich, dass die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer modifiziert wird, als dass man eine neue Steuer einführt. Und selbst wenn eine solche Bodenwertsteuer Gesetz werden sollte, so werden es die Lobbyisten von LEG, Vonovia und Co. zu verhindern wissen, dass sie diese Abgabe selbst zahlen müssen; es wird auch diese wieder auf die Mieter umgelegt. Somit lachen sich die Grundherren wieder einmal ins Fäustchen. In diesem System werden stets die Besitzer von Grund und Boden ihre Wertsteigerungen ungebremst scheffeln. Denn dass der Staat auch nur die leiseste Chance bekommen könnte, bereits in Privatbesitz befindlichen Grund zu annehmbaren Preisen erstehen und dann mittels Erbbaurecht verleihen zu können, wird eine Illusion bleiben.
P.S.: Was die Betriebskostenabrechnungen der LEG angeht, so könnte ich Ihnen noch seitenweise von falschen Positionen in diesen Rechnungen schreiben, die dann zwar von Gerichten rechtskräftig kassiert wurden, nur kommt man dann noch immer nicht an seine überzahlten Beträge, und selbst wenn, dann tauchen die unrechtmäßigen Positionen teilweise in der nächsten Abrechnung wieder auf. Zahlt man diese dann nicht, bekommt man eine neue Klage seitens der LEG ins Haus, und so weiter und so fort. – Ich bin aus der Siedlung daher ausgezogen. – H. Peter Stock
Leserbriefe zu „Blühende Fantasie “ von Sebastian Kempkens
Haben Sie vielen Dank für diesen wunderbaren Beitrag in der ZEIT! Ich fühle mich durch Ihren Essay sehr inspiriert, da stecken wirklich viele großartige Gedanken und Ideen drin, die mir völlig neu waren. Auch toll finde ich es, nicht alles immer so schwarz zu malen, sondern Ihren Lesern zu helfen, in diesen schlimmen Zeiten den Frohmut zu behalten. – Peter Krüber
Improvisation kommt viel häufiger vor, als das Dossier von Sebastian Kempkens vermuten lässt. Ständig müssen oder dürfen wir mit Gegebenheiten, mit Situationen des Mangels und begrenzten Möglichkeiten umgehen, also improvisieren, kreativ werden. Kinder improvisieren, wenn sie frei spielen, ebenso Lehrer, wenn sie situativ und aufgreifend unterrichten. Wenn wir ein akutes Alltagsproblem lösen, ist unsere Fähigkeit zu improvisieren gefragt. In kreativen Berufen wird Improvisation permanent bewusst eingesetzt, auch in Handwerksberufen. In Heil- und Pflegeberufen. Selbstverständlich in der Kunst.
Das Leben ist eine Baustelle. Improvisation ist eine menschliche Konstante, eine Fähigkeit, die in uns angelegt ist und entfaltet und kultiviert werden kann. Wichtigste Voraussetzung: Freiheit. Keine Angst. Und: Können, ganzheitliche Wahrnehmung, Gefühl für Stimmigkeit. Es kommt immer mehr darauf an, frei zu sein, Visionen zu haben und gut zu improvisieren. Auch in der Politik. – Reinhard Koine
Herr Kempkens beschreibt in seinem anregenden Artikel „Blühende Phantasie“ die Fähigkeit zur Improvisation als Lösungs-Voraussetzung für außergewöhnliche Problemkonstellationen, für die keine Modelle bekannt sind. Er schildert an Hand von Musikern, dass zur Entwicklung guter Improvisationen Kenntnis und Beherrschung der bekannten Methoden, mehr noch, tiefstes Vertraut-Sein mit ihnen unerlässlich ist; dass dann aber darüber hinaus Mut zur Lösung von den bekannten Techniken, zum Vertrauen auf „das Bauchgefühl“ und zum Verfolgen ungewöhnlicher Ideen unerlässlich ist. Das erfordert zuzulassen, dass „jene Hirnregionen nahezu deaktiviert [werden], die für Selbstkontrolle verantwortlich sind. Das Gehirn [verfällt] in einen Zustand, vergleichbar mit derjenigen Schlafphase, in der wir so intensiv träumen, dass wir schmecken, riechen und fühlen können.“ So die Aussage des Neurowissenschaftlers, der Jazz-Musiker beim Improvisieren kernspintomographisch untersuchte.
Ich gehe davon aus, dass diese Beschreibung von Faktoren und Prozessen, die kreative Improvisation ermöglichen, ebenso auf die freie Assoziation zutreffen, mit der Psychoanalytiker und ihre Patienten als ein wesentliches Werkzeug arbeiten. In ihrer Kooperation suchen sie mit Hilfe ihres kognitiven Wissens, ihrer erlernten Fähigkeiten und im steten Wechsel mit freier Assoziation (der eigenen und der ihres Patienten) die hochkomplexen und individuellen Problemkonstellationen der Patienten ganzheitlich zu erfassen und bessere Interpretationen und Lösungsmöglichkeiten zu eröffnen, als bisher bekannt. Dieser weitere Schritt über das psychotherapeutische und neurowissenschaftliche Faktenwissen hinaus (auf Seiten des Therapeuten immer auch in kritischer Rückkoppelung zu diesem) unterscheidet die Psychoanalyse grundlegend von den manualisierten und digitalisierten Angeboten, die zunehmend mehr die Psychotherapie und ihren Markt prägen.
Mir fehlte in dem interessanten Artikel der Hinweis auf die Psychoanalyse, die sich im Gegensatz zu oben genannten Trend im therapeutischen Prozess ständig des Assoziativ-Improvisatorischen als Arbeitsmethode bedient. Implizit beschäftigt sich der Zeit-Beitrag ja mit den psychischen Voraussetzungen zur kreativen und progressiven Bewältigung von Krisen und schließt mit Worten, die auch für die Psychoanalyse zutreffen könnten: „..., das heißt: nicht wissen was kommt – und trotzdem sicher sein, ans Ziel zu gelangen.“ – Dr. Ursula Reiser-Mumme
Freundlichsten Dank für den tollen-lustigen-informativen-kenntnisreichen-unterhaltsam-kurzweiligen Abschluss des Jahres mit Ihrem Artikel zum Thema Improvisation von Sebastian Kempkens. Da bekommt man gleich Lust, selbst etwas mehr zu improvisieren! Große Klasse, bitte mehr von dieser Sorte Text! Ich habe ihn ausgeschnitten und kopiert. Nun wird das Machwerk samt der großartigen Bilder an Freunde und Familie verteilt. – Franz Xaver
Was mein Leben reicher macht: das Dossier der Zeit Nr. 1 vom 30. Januar, Blühende Fantasie, mit diesem fantastischen Schlusssatz von Sebastian Kempkens zum Thema Improvisieren: „...das heißt: nicht wissen, was kommt – und trotzdem sicher sein, ans Ziel zu gelangen.“ Großartig gesagt und mir voll aus der Seele gesprochen! – Klaus Andres Huber
Beim Bild „Mit falscher Karte auf Entdeckung gehen, also mit der Karte von London den Harz durchwandern“ gehen Sie zu weit, so angesehen der zitierte Alexander Kluge auch sein mag. Das hat mit Improvisation nichts mehr zu tun, das ist nur noch schlimmstenfalls Dummheit. Wenn es keine wasserfeste Karte ist, hilft sie Ihnen nicht einmal bei Regen. Im Gegenteil, um eine Gegend zu erforschen, ist eine möglichst genaue Karte notwendig, aus der Sie auf Grund Ihrer Erfahrung unter Umständen besondere Orte aufspüren können, an denen Sie mit der Deutschen Generalkarte in 1: 200 000 garantiert vorbei gerauscht wären. Daher gefällt mir ja auch Ihr Ansatz, dass man sich mehr der Wissenschaft bedienen sollte, gerade wenn es ums Improvisieren geht. Ohne gute Basis landet man allenfalls Zufallstreffer. – Wolfgang Kuebart
Leserbriefe zu „Und er wird dicker und dicker ...“ von Henning Sußebach
Ja – er wurde dicker und dicker. Und ja: Mercedes Benz als „Hersteller“ wurde schlechter und schlechter. Ich bin smart-Käufer der ersten Stunde. Und ich wurde komplett verladen! Ich habe mit dem smart ein „Mobilitätspaket“ gekauft; etwa 60 fette Seiten Marketing zur urbanen Mobilität inklusive Mitgliedschaft im car-sharing und im ökologischen Automobilclub. Leider nur als „Schnupperangebote“ – wie ich dann bemerkte. Rabatte in Waschstrassen, Rabatte bei mehreren Mietwagenagenturen – wenn ich einmal eingrößeres Fahrzeug benötige. Kostengünstiges Parken in städtischen Parkhäusern, und, und, und.
Alles Lüge! Was ich bekam war ein von der Größe, vom Platz, vom Fahrverhalten und von den Nutzungsmöglichkeiten adäquates aber viel zu teures Stadtauto mit viel zu hohem Verbrauch (+ 8 l/100km), mangelhaften Fahrleistungen (z. B. Im Vergleich zu ähnlichen Toyotas) und eng getakteten und viel zu teuren Wartungszyklen. Mein smart verschliß in 40.000 km zwei Getriebe und zusätzlich eine Kupplung und ich zerstörte bei einer Vollbremsung aus 100 km/h die komplette vordere Bremsanlage. Alles auf meine Kosten, Mercedes nahm sich da nichts von an.
Unterm Strich: Ein super Fahrzeugkonzept, welches auf gar keinen Fall von einem etablierten Fahrzeughersteller gebaut werden darf. Das können die einfach nicht. Sieht man auch sehr schön an den aktuellen Elektrofahrzeugen. Wer 30 Jahre A8 baut, der kann kein angepasstes E-Fahrzeug. Wie auch? – Wolfgang Siedler
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie den Jahresauftakt 2021 in ihrer aktuellen Ausgabe optimistisch gestaltet haben. Überdies war ich gleich sehr neugierig und positiv angetan, da Sie die Zukunft der Städte zum zentralen Thema in Ihrem Wirtschaftsteil gemacht haben. Umso enttäuschter war ich dann, als ich die einzelnen Artikel gelesen habe. Zwar wurden an einigen Stellen interessante neue Tendenzen – gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise – aufgegriffen, und beispielsweise bieten das Interview mit Jürgen Bruns-Berentelg sowie der Beitrag von Martin Machowecz sowie das Porträt von Belit Onay schöne Einblicke in die Komplexität der aktuellen Stadtentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Insgesamt finde ich die gesamte Ausrichtung aber doch etwas altbacken und leider auch an vielen Stellen oberflächlich recherchiert und zugespitzt.
Von der ZEIT hätte ich mir hier doch sehr viel mehr erhofft! Hier einige Beispiele: • Auch wenn ich Hanno Rauterbergs Einschätzungen und Positionen zu Fragen der Stadtentwicklung durchweg als bereichernd empfinde, ist beispielsweise das relativ ausführlich von ihm behandelte Thema der Überwindung der Autoorientierung in der Stadtentwicklung doch schon lange nicht mehr neu. In der Stadt- und Verkehrsplanung kümmern wir uns seit Jahrzehnten darum und versuchen, in einer schwierigen Öffentlichkeit allmählich Veränderungen herbeizuführen, wenngleich das natürlich in einer so stark auf das Auto ausgerichteten Gesellschaft eine sehr langwierige Angelegenheit ist. Erlauben Sie am Rande auch die Bemerkung, dass in diesem Zusammenhang das prominent auf der ersten Seite ihres Wirtschaftsteils gezeigte Bild des Toyota-Projekts „Woven City“ trotz dessen von Ihnen aufgegriffener Signalwirkung stutzig macht – wie viele ähnliche Bilder suggeriert es eine Belebtheit,

die sich angesichts der geringen Dimension von 2.000 Einwohnern erst einmal einstellen muss. Ob das technologisch sehr innovative Projekt tatsächlich vorbildhaft für die Stadt der Zukunft sein wird, sollte man überdies angesichts der Erfahrungen mit vollständig von einem privaten Konzern kontrollierten Quartieren erst einmal kritisch verfolgen – selbst wenn man nicht gleich Dystopien à la Dave Eggers („The Circle“) am Horizont aufziehen sieht. Und über dieses Bild einer neuen Konzern-Stadt schreiben Sie ironischerweise auch noch „Bürger an die Macht!“. • Verblüfft war ich nicht zuletzt von der Bemerkung, dass, u.a. angesichts der Konzepte des Planers (!) Jan Gehl für Innenstädte, nun „auch die Stadtplaner ... gewaltig umdenken“ müssten. Jan Gehl steht bereits seit vielen Jahren sehr weit oben auf den Literaturlisten der Stadtplanungsstudiengänge.
„Menschliches Maß“ und andere seiner Überlegungen werden von Planern vielerorts propagiert und angewendet. Darüber hinaus spielt Jan Gehl längst eine nicht zu unterschätzende Rolle auch durch seine Vorträge auf Konferenzen zur Stadtentwicklung, an denen unterschiedlichste Akteure aus Politik und Verwaltung teilnehmen. Aus Ihrer Darstellung wird deutlich, dass Sie gar kein genaues Bild davon haben, in welchem vielfältigen und schwierigen Akteursumfeld Stadtentwicklung heute betrieben wird und was dabei eigentlich die Stadtplaner tun. Dabei hatte das gerade Ihr Ressort- Kollege Roman Pletter – der seltsamerweise an dem aktuellen Special zur Stadt gar nicht beteiligt gewesen zu sein scheint – vor einigen Jahren in seinem Beitrag zum stadtentwicklungspolitischen Umgang mit der Flüchtlingskrise so überzeugend getan („Die unsichtbare Wand“, Zeit Nr. 40/2016), dass ich das damals geradezu als Sternstunde der journalistischen Aufarbeitung von Stadtentwicklungsthemen empfunden habe.
– Der Beitrag zu Veränderungen in Einkaufsstraßen tut so, als würden jetzt Stadtpolitik und Planung angeregt durch findige Investoren aufwachen und sich dem Thema Mischnutzung und Revitalisierung niedergehender Zentren zuwenden. Als ich Mitte der 1980er Jahre studiert habe, war Mischnutzung bereits das Thema, und seit den 1990er Jahren haben engagierte Stadtverwaltungen mit Planer*innen und Architekt*innen längst zahlreiche innovative Mischnutzungskonzepte in Quartieren wie dem Tübinger Französischen Viertel, der Kasseler Marbachshöhe, dem Trierer Petrisberg, dem Schwabacher O’Brien-Viertel und vielen anderen mehr entwickelt.
– Für die Innenstädte wurde vor mehr als zehn Jahren im Rahmen der Bund-Länder- Städtebauförderung das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt, das sich von Anfang an intensiv darum gekümmert hat, Zentren als multifunktionale Stadtquartiere zu begreifen. Den Städten wurde in den schon damals aufkommenden Warenhauskrisen deutlich gemacht, dass eine Revitalisierung auf viel mehr als nur Einzelhandel setzen muss – u.a. auf Wohnen, Gastronomie und Kultur. Dass Sie nun auf die durchaus beeindruckenden Ansätze aus Bremen, Osnabrück und anderswo hinweisen, finde ich sehr gut. Dass nun auf einmal Konzepte zur multifunktionalen Nachnutzung von ehemaligen Warenhäusern ganz etwas Neues sein sollen, kann allerdings nur einer verkürzten Recherche geschuldet sein.
Abgesehen von den vielen Konzepten zur Stärkung der Multifunktionalität in Innenstädten, die beispielsweise im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ umgesetzt werden, sei auch auf die Umnutzungen von Warenhäusern hingewiesen, die von Investoren vielerorts mit tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeistern, Planerinnen, Architekten und Verwaltungsmitarbeiterinnen umgesetzt werden konnten. Wenn man auf die ehemaligen Hertie-Filialen in Berlin-Moabit, Berlin-Neukölln, Gelsenkirchen- Buer, Detmold oder Lünen, das Krönchen-Center in Siegen oder die ehemalige Horten-Filiale in Neuss sieht, kann man erkennen, mit wie vielen Ideen für eine multifunktionale Wiederbelebung – etwa durch einen interessanten Mix aus Einzelhandel, Dienstleistungen, öffentlichen Verwaltungsdienststellen und kulturellen Einrichtungen – es vielerorts immer wieder gelungen ist, mit dem Umbruch im stationären Einzelhandel umzugehen.
– Viele andere kreative Umnutzungen und Revitalisierungsprojekte werden in den Innenstädten seit Jahren realisiert – weit über die von Hanno Rauterberg als Standard erwähnten Umnutzungen von „Werkshallen“ hinaus. Dabei spielte übrigens das bereits seit Anfang der 2000er Jahre laufende Stadtumbau-Programm der Bund- Länder-Städtebauförderung häufig eine wesentliche unterstützende Rolle. Auch wenn die dabei umgesetzten Projekte nicht so spektakulär sein mögen wie der von Ihnen behandelte Bibliotheksneubau in Rotterdam – soziokulturelle Infrastruktur und sogar Bibliotheken stehen auch in den vielen deutschen Beispielen nicht selten im Mittelpunkt.
Ich erwähne stellvertretend für die beinahe unüberschaubare Vielfalt die Umnutzung und Erweiterung des Bahnhofsgebäudes von Luckenwalde zur Stadtbibliothek und zum Kulturzentrum, die Wiederbelebung des Ortskerns von Magdeburg-Salbke mithilfe einer von den Bewohner*innen selbst aufgebauten kleinen Bibliothek, den Abriss des Horten-Warenhauses in Hamm mit an gleicher Stelle neugebautem multifunktionalem Gebäude zur neuen Unterbringung der Bibliothek, die übrigens von der ZEIT-Stiftung wenige Jahre zuvor als „Bibliothek des Jahres“ ausgezeichnet wurde. • Auch im Hinblick auf den Verkehr wird schon seit langer Zeit intensiv an einer Weiterentwicklung des Verhältnisses von Autos, Fahrrädern, Fußgängern und ÖPNV in den Zentren gearbeitet.
Niedergeschlagen hat sich dies in den letzten Jahren beispielsweise in innovativen Konzepten für verkehrsberuhigte Innenstadtbereiche in Bad Wildungen, Bad Driburg, Kassel, Mindelheim oder Bamberg sowie Verbesserungen der ÖPNV-Organisation in Augsburg und Neuwied, um nur einige zu nennen. Und vor diesem Hintergrund hätte man meiner Meinung nach auch viel eher über die vielfältigen innovativen Ansätze des Umgangs mit individueller Mobilität mit und ohne Auto berichten können, als eine Geschichte des Smarts zu erzählen, die nun wirklich nicht sehr viel mit der Zukunft der Stadt zu tun hat. Und weitergehende Fragen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit kommen daneben nach dem Auftaktüberblick von Hanno Rauterberg fast gar nicht zum Tragen, obwohl Sie explizit nach der Zukunft der Städte suchen.
– Hier noch einige weitere Hinweise: Marcus Rohwetter vertritt die auch in der Stadtsoziologie vor vielen Jahren intensiv diskutierte These, die Stadt von heute sei so etwas wie eine „grüne Festung“, die sehr stark ausgrenzend und räumlich kontrollierend aufgebaut ist. Autoren wie Klaus Selle haben schon vor Jahren eindrücklich nachgewiesen, dass die vermeintliche Privatisierung des öffentlichen Raums und ähnliche Phänomene sehr viel weniger eindeutig sind als bisweilen behauptet. Natürlich gibt es die von Herrn Rohwetter dargestellten Phänomene. Ich wundere mich allerdings schon, warum er diese in den Mittelpunkt stellt und sich nicht beispielsweise fragt, warum in Deutschland die räumliche Polarisierung gerade keinen Boom an „Gated Communities“ wie in vielen anderen Weltteilen hervorgebracht hat und insoweit auch die städtische Spaltung und räumliche Kontrolle sehr viel differenzierter betrachtet werden muss, als dies der Beitrag andeutet.
Marc Schieritz greift zu Recht die problematische Geschichte der leistungslosen Gewinne an städtischem Grund und Boden auf und sensibilisiert Wirtschaftsinteressierte für die dahinterliegenden Zusammenhänge. Ich wundere mich allerdings, warum in seinem Beitrag fast kein Hinweis darauf zu finden ist, wie vielfältig das Thema derzeit in Politik und Wissenschaft diskutiert wird – selbst die sehr intensiv und vielschichtig geführte Diskussion um Erbbaurechte kommt bei ihm sehr allgemein daher. Und trotz des schönen Einblicks, den Martin Machowecz in das Wohnprojekt in Leipzig gibt, hätte er bei genauerer Recherche bemerken sollen, dass Leipzig-Grünau, der Herkunftsort der im Artikel porträtierten Romy Gröschner, derzeit von seinen Bewohner*innen keineswegs so negativ gesehen wird wie von ihm suggeriert.
Und der von Ihnen im Zuge der Innenstadtrevitalisierung erwähnte Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt steht zwar dafür, dass heute vielerorts „Stadtreparatur“ betrieben wird, doch hätte man dafür viele andere und weniger kontrovers diskutierte Beispiele als das Luxusprojekt aufgreifen können, wenn man gleichzeitig an anderer Stelle in dem Special über preiswertes Wohnen und die Problematik explodierender Bodenpreise berichtet.
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch weiterhin Stadtentwicklungsfragen aufgreifen würden – dort liegt sicher einer der Schlüssel für die gesellschaftlichen Transformationen der nächsten Jahrzehnte. Wenn ich dafür einen Wunsch frei hätte, dann wäre es der, dass Sie Ihrem journalistischen Anspruch dabei besser gerecht werden als in Ihrer aktuellen Ausgabe. – Prof. Dr.-Ing. Uwe Altrock
Bei Ihrem Beitrag fiel mir wieder ein, dass wir vor zwoelf Jahren auch ueber den Kauf eines Smarts als Ersatz fuer unseren damals 16 Jahre alten Polo nachdachten (auch weil der Polo immer groesser geworden war). Ein Vergleich zeigte jedoch, dass der Smart trotz geringeren Volumens deutlich mehr Sprit verbrauchte als die Modelle Peugeot 107/Citroen C1/ Toyota Aygo, die damals die sparsamsten Beziner waren. Wir kauften also einen Peugeot 107, der nun bei ca. 180000km immer noch im Jahresdurchschnitt 4,3 l Super/100km braucht und in dem wir sogar schon Gartenliegen transportieren konnten. Die wenigen Smart-BesitzerInnen, die ich kenne, haben ihn als Zweit- oder Drittwagen. Wer nur ein Auto besitzt und dabei ein sparsames Modell moechte, wird sich m.E. im Regelfall gegen den Smart, aber nicht notwendigerweise gegen ein Auto insgesamt entschliessen. Der Smart ist (leider) vor allem ein „Lifestyle“ Auto geworden. – Sabine Moehler
Mit Abschluss des Berufslebens, war der Firmen Wagen weg. Die Wahl auf einen smartder 2. Generation, Baujahr 2005, Benziner, fiel mir als Single nicht schwer. Obwohl sog. Experten sagten, nach 100.000 km kann man Motor und halbautom. Getriebe wegwerfen, habe ich bis heute ca. 210.000 km geschafft, mit den üblichen Wartungen und Reparaturen an Verschleißteilen. .Ich sehe im Moment noch keinen Zeitpunkt zu wechseln. Das wäre dann auch nur der Typ der 3. Generation. On dit: Man kann in jeden smartmit einem Zylinder auf dem Kopf einsteigen.
Vergessen hat Ihr Redakteur, das kurze Leben der Sportversion des smartanzusprechen.Der wäre, bei entsprechender Preisgestaltung und Marketing/Werbung, was für die ab 18jährigen gewesen. Ich habe mich , im Rentenalter, einmal hineingesetzt und hatte große Schwierigkeiten herauszukommen. Der neue, 4. Generation, grimmig/bullig, ist mit jedem japanischen, koreanischen Modell verwechselbar. – Hartmut Wagener
Es gibt den Begriff der passiven Sicherheit. Für viele Autofahrer ein Grund sich ein „Protzauto“ zuzulegen. Habe es selbst erleben müssen. Meine Schwester verunglückte In den 1970er Jahren mit einem VW-Käfer. Nach einer Kollision ihres Fahrzeugs mit einem Porsche starb sie. Ich fuhr in dieser Zeit eine Mercedes 200 D (Traktor mit Pkw-Karosserie). Mit diesem Fahrzeug hätte sie den Unfall sicher überlebt. Wenn heute so ein smarter Smart eine Begegnung mit einem SUV (Hausfrauenpanzer) hat, ist das Ergebnis kein anderes. – Bernd Roller
Leserbriefe zu „Ganz weit draußen“ von Stefan Schmitt
Ich will ja nicht kleinlich sein. Aber: Auf der Seite 33 (unten) befinden sich 4 Grafiken. In der zweiten von links muss es 100 bis 400 Milliarden Sterne heißen. In der linken Grafik heißt es, die Sonne vereint mehr als 99 % der gesamten Masse auf sich. Leider passt die Relation der Planeten nicht. So ist z.B. der Jupiter doppelt so groß wie die Sonne (?) Nichts für ungut und einen guten Rutsch. – Hagen Treutmann
Seite 32, Bildunterschrift Antennengalaxien: diese liegen 66 MILLIONEN Lichtjahre von der Erde entfernt. – Reinhard Rönnecke
Sie haben sich unten auf der genannten Seitre um drei Größenordnungen vertan : Die Milchstraße hat nicht 100 bis 400 Milli
onen
Sterne, sonder mehr als 100 Milli
arden
Sterne ! – Winfried Raith
Bei der Lektüre der ZEIT 01/2021, ist mir im Wissensteil bei dem Artikel „Wegweiser für den Weltraum“ im Abschnitt „Milchstraße“ ein Fehler aufgefallen. In dem Artikel heißt es, dass es 100 bis 400 Millionen Sterne in der Milchstraße gibt, nach meiner Kenntnis (siehe Quellen) sind es aber 100 bis 200 Milliarden. Quellen: Sternengeschichten Folge: 88 ca. 1,5 min.; https://www.google.de/amp/s/www.planet-wissen.de/technik/weltraumforschung/astronomie/die-milchstrasse-unsere-heimatgalaxie-100.amp; Hawking, Stephen. 2017. Eine kurze Geschichte der Zeit. 14. Aufl. Reinbek: Rowohlt, S. 55. – Elias Bala
Ich möchte eine kurze richtigstellung anbringen. in o.s. artikel s. 33 über astronomie wird angegeben: 1. die milchstrasse habe einen durchmesser von 185.000 lichtjahren. in wissenschaftlichen kreisen wird der durchmesser bis heute mit 100.000 lichtjahren angegeben. 2. unter „wegweiser für den weltraum“ (s.33) wir angegeben, dass die milchstrasse aus 100-400 millionen sternen besteht und ist eine unter zwei billionen galaxien. richtig ist, dass unsere milchstr. aus 100-400 milliarden sternen besteht und nach neuesten schätzungen es etwa 400-500 milliarden galaxien gibt nicht zwei billionen. – m.engelhardt
Leserbriefe zu „Sex als Problem“ von Antonia Baum
Nicht nur Paris Hilton, Britney Spears und Beyonce ́werden in diesem Jahr 40, sondern auch die Feldulme vor meinem Haus. Ich habe im Mai 1981 einige Ulmensamen in einen Blumentopf gesetzt. Eines der bald erschienenen Pflänzchen habe ich vor dem Haus eingepflanzt. Im Schutz der Sträucher, die damals dort standen, ist langsam ein Baum gewachsen. Bis heute hat die Ulme etliches an CO2 in ihrem Holz gebunden. Sie dient Vögeln als Trittstein auf dem Weg vom Wald ins Dorf und zurück. Auch Eichhörnchen nutzen sie als Ausgangs- oder Fluchtpunkt, wenn sie im Spätsommer von den Haselnusssträuchern im Garten stibitzen. An der Weggabelung, an der sie steht, ist sie zur markanten Landmarke geworden. Und wenn sie wie auf dem beiliegenden Foto von einem Regenbogen gekrönt wird, ergibt das ein stimmungsvolles Bild der Schönheit und Zuversicht. – Dirk Schranz
Bezüglich Britney Spears schreiben Sie: „So Schafft sie es (...)tatsächlich Sex zu haben ohne Sex zu haben – die unbefleckte Empfängnis...“ Genau der Gedanke kam mir an Sylvester Abend als ich eine gewisse Shakira im TV (3sat) sah und hörte. Schön, beruhigend aber auch curios was ihr Kollege dann über das neue Sternchen Billie Elish schrieb. Was wir in den 68igern noch als Frage diskutierten (siehe Beatles etc.) scheint längst wahr gworden zu sein: Jede Popkulturelle (Gegen-)Bewegung ist schon comerzialisiert bevor sie zur Bewegung wird. Oder besser vielleicht: Kristallisiert sich um ein Comerzielles und gleichzeitig menschliches Vorbild. – Dieter Herrmann
Für einen Journalist/eine Journalistin reicht es nicht, sich einen flotten Jargon zuzulegen und die Originalität bis zur Geschmacklosigkeit zu treiben (s. letzte Kolumne von Frau Baum), sondern es wäre angesagt, sich eine Kenntnis über die Sachverhalte zu verschaffen und nicht ”Sex zu haben, ohne Sex zu haben – die unbefleckte Empfängnis” rauszuhauen (Artikel über Hilton, Spears, Beyoncé, der übrigens, samt Titel, besser in die Klatschpresse als in die ZEIT gepasst hätte). Frau Baum müsste eigentlich wissen, dass die unbefleckte Empfängnis nicht “Sex ohne Sex” bedeutet (wie vermeintlich bei der Empfängnis Jesu), sondern sich auf Maria bezieht, die von ihren Eltern auf natürliche, d.h. sexuelle Weise gezeugt wurde, aber “unbefleckt”, d.h. frei vom Makel der Erbsünde war. Mit wachsender Besorgnis über das Abgleiten der ZEIT – Prof. Michaela Böhmig
Endlich – nach ihren „Mein literarisches Ich“ – Geschichten , bei denen ich immer die Vorstellung hatte , daß sie Untiefen ihres Seelenhaushalts surrealistisch „beleuchteten“ – nun ein Artikel , der in Format , Stil und Methode dem entspricht , was ich von ihnen erwarte . Wenn ich ihre Protagonistinnen synoptisch mit denen des Herrn Jessen betrachte (gleiche Ausgabe S.51) , fällt mir auf : Paris Hilton – die übersättigte , geschäftstüchtige Dollarprinzessin. Britney Spears – das frustrierte Glamour-girl : nein , eine Lolita ist sie nicht – dazu fehlt ihr die Verruchtheit und die eiskalte Berechnung. Beyonce – die geschäftstüchtige Primaballerina mit sex-appeal Pompadour – die porzellanene Mätresse mit politischem Instinkt und kommunukativer Begabung.
Luxemburg – das von Geburt an körperbehinderte , polyglotte , politisch und rhetorisch hochbegabte „Monument“ Es fällt auf , daß ihre Damen und die beiden anderen fast gleichalt sind : Die Pompadour starb mit 42 – „körperlich erschöpft durch angeborene Krankheiten , vielen Fehlgeburten und übermäßiger Arbeitsbelastung “ Die Luxemburg wurde mit 47 ermordet . Beide hatten da schon seit ca 20 Jahren ein öffentliches Wirken hinter sich . Erstaunt hat mich die Benützung des pejorativen Begriffs „Schlampe“ : Sie sind sich doch sicher bewußt , daß sie damit den Blick des Mannes übernehmen , genauer den des frustrierten Machos , der das Objekt seiner Begierde verflucht , weil er es nicht bekommen kann . Eigentlich ist sie überlegen – aber die Angst vor dem „Gerede“ .
Bei allen fünf Damen spielt die äußere Erscheinung – ob Segen oder Fluch – eine entscheidende Rolle . Die Attraktivität für das männliche Geschlecht ist das Kriterium – v.a. bei Britney besonders ausgeprägt : Klubschaugen und Babyspeck – aber selbst die Luxemburg hatte ihre Liebhaber . Gemein ist allen Frauen die Angst vor dem Verlust dieser Anziehungskraft – als ob es nichts Anderes gäbe . Simone Signoret hat dies unübertrefflich formuliert : „Wir sind gleich alt , Montand und ich : Er hat erlebt , wie ich neben ihm alterte , ich habe erlebt , wie er neben mir reifte. So nennt man das bei den Männeren .“ Ich habe immer wieder festgestellt , daß Frauen , die wegen ihres Aüßeren im Tageslicht stehen , irgendwann geradezu inbrünstg bekennen : „Ich will gebären ! Metamorphose ? Oder verwandelt sich hier ein Objekt in ein Subjekt ? Ihr Artikel war für mich eine Anregung – vielleicht ist mein Brief das auch für sie . – Dieter Wendler
Leserbriefe zu „Die Männer werden weiblicher“ von Peter Dausend
Ich beziehe Die Zeit erst seit Kurzem und ärgere mich immer wieder, mal mehr, mal weniger, über bestimmte redaktionelle Arbeiten. Der Artikel von Herrn Peter Dausend, der in der aktuellen Ausgabe vom 30.12.2020 erschienen ist, hat mich besonders verärgert. Bereits die gewählte Überschrift „Die Männer werden weiblicher“ erschließt sich mir auch nach dem Lesen des Artikels nicht. Wo soll diese Weiblichkeit sich zeigen? Reicht die (vermeintliche) Abwesenheit von plakativem Schauvinismus und Machtgehabe bereits aus, um diese „Eigenschaften“ als weiblich zu deklarieren? Die Ausführung über das daran geknüpfte Bild und Verständnis von Weiblichkeit und Männlichkeit spare ich mir an dieser Stelle.
Im Wesentlichen behandelt der Artikel dann, dass die aktuellen Führungsämter der Politik überwiegend männlich besetzt sind und Herr Dausend zieht hieraus keinesfalls die Schlussfolgerung, dass dieser Umstand im Jahr 2020/2021 ggf. ein Armutszeugnis sein könnte. Im Gegenteil, es wird als Chance gesehen für: mehr Männer. Als Zugeständnis folgt, dass es immerhin andere Männer, als die bisherigen seien, aber letztendlich sieht Herr Dausend keinesfalls die Besetzung wichtiger Ämter durch eine Frau als Option. Die patriarchale Struktur, die sich offenbar aktuell in der Besetzung von politischen Ämtern in Deutschland ganz drastisch zeigt, will Herr Dausend also ernsthaft unter dem Titel „Manches wird gut“ verkaufen. Ich muss mich an dieser Stelle fragen, ob dieser Beitrag redaktionell nicht gelesen wurde, oder ob Ihre Redaktion tatsächlich der Ansicht ist, dass die Abwesenheit von weiblichen Besetzungen tatsächlich als Potential und als Hoffnung gesehen werden kann und soll?
Neben diesem aktuellen Artikel, den ich als überaus fragwürdig empfinde, fällt mir immer wieder auf, dass in den meisten Artikeln das generische Maskulinum verwendet wird. Mir ist bewusst, dass es aktuell (leider) noch keine einheitliche und verpflichtende Schreibweise gibt, um alle Menschen anzusprechen. Von einer Zeitung, die sich auf die Fahne schreibt den Zeitgeist widerzuspiegeln, erwarte ich jedoch wenigstens geschlechtsneutrale Formulierungen, oder zumindest sowohl die weibliche, als auch die männliche Nennung.
Desweiteren kann ich nicht nachvollziehen, dass bestimmten Personen unkommentiert redaktioneller Raum geboten wird. So auch in der aktuellen Ausgabe, in der Boris Palmer fast eine ganze Seite einnehmen darf. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wieso jemandem in Ihrer Zeitung Raum geboten wird, der immer wieder durch rassistische Kommentare und Handlungen auffällt. Ich bin letzendlich sehr enttäuscht über die redaktionelle Arbeit, die hier teilweise geleistet wird, da sie den Journalist*innen im Weg steht, die tatsächlich wertvolle Arbeit leisten. Mir ist bewusst, dass diese Rückmeldung eine von vielen ist und dass weder Herr Dausend, noch die Verantwortlichen der Redaktion sie lesen werden, jedoch möchte ich mir nicht vorwerfen müssen, diese Kritik nicht angebracht zu haben. Dann kann ich wenigstens demnächst guten Gewissens kündigen. – Daria Bierbrauer
Schon bei der letzten Bundestagswahl fiel es Frau Merkel nicht unbedingt leicht, erneut zu kandidieren. Aber irgendwie sah sie keinen anderen geeigneten Kandidaten in den eigenen Reihen. Eine interessante xx-Version des Unersetzbarkeitswahns, würde ich sagen. Das neue Alpha-Männchen könnte es diesbezüglich jedenfalls besser machen als das altgediente Alpha-Weibchen. Dieses Alpha-Weibchen hatte zwar eine begnadete, ausgleichende Persönlichkeit und war sehr gut darin, möglichst wenig überflüssigen Schaden anzurichten. So richtig in Schwung kam sie allerdings nur durch Kernschmelzen und Migrationswellen.
Das kommende alpha-Männchen könnte mit ein bisschen mehr Voraussicht und Mut dafür Sorgen, durch längst überfällige Schritte die eigentlichen Gefahren zu bannen. Wirksame Taten füs Klima statt großer Worte vom Gletscher. Echte Bekämpfung von Fluchtursachen statt bloßem Outsourcing der Grenzkontrollen. Ökologisches Umdenken in der Landwirtschaft statt anhaltendes Totschweigen des Artensterbens. Dafür braucht es mehr als die Fähigkeit zum Ausgleich. Dafür braucht es Entschlossenheit und auch ein Stück weit Risikobereitschaft, wenn nicht sogar Radikalität. Vielleicht hilft dem neuen Alpha-Männchen dabei ein klitzekleiner Fitzel auf seinem y-Chromosom... Herr Dausend wird das kaum für möglich halten. Denn seine provozierenden, überheblichen und plumpen Vorurteile belassen das „Männliche“ unerschütterlich im Reich des Bösen. – Dr. Christian Voll
In welcher Welt lebt Herr Dausend? 17 Jahre werden wir nun von dem Alphatier Merkel regiert. Und in der EU und EZB sind alle Spitzenpositionen weiblich besetzt. Und hat es was substantiell besseres gebracht? Können wir uns endlich davon lösen das Männer weiblicher und Frauen härter werden müssen damit die Welt eine bessere wird. Wir sind wie wir sind und machen jeweils das Beste nach eigenem freien Ermessen daraus. Schluss mit diesem künstlichem Geschlechterkampf. – Peter Knappmann
Vor 30 Jahren war ich zur Silvesterfeier in Berlin am Brandenburger Tor und habe die Freude zur Deutschen Einheit aus nächster Nähe erlebt. Für die Einheit der Deutschen sind natürlich wesentlich mehr Faktoren ausschlaggebend als eine Silvesterfeier. Einen Faktor hat Die Zeit jedoch im letzten Jahr mit der gut gemeinten Änderung „Zeit im Osten“ in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Für alle Leser in den neuen Bundesländern wurde ein Austausch der Seiten 18 bis 20 mit den Rubriken Geschichte, Recht und Unrecht / Verbrechen und Leserbriefe (werden den Ostdeutschen auch vorenthalten), gegen die Rubrik „Zeit im Osten“ vorgenommen. Diesen Austausch, der von den Abonnenten nicht verändert werden kann, und zwangsweise an die Postleitzahl gekoppelt wurde, empfinde ich als bevormundend, diskriminierend und als einen Keil zwischen Ost und West. Ich wohne ca. 5 km von der Berliner Stadtgrenze in Brandenburg.
Wenn ich Die Zeit in der Form lesen möchte, wie ich sie vor 30 Jahren kurz nach dem Mauerfall bestellt habe, fahre ich jetzt nach Berlin, um die Zeitung zu kaufen. Dort gibt es die Trennung zwischen Ost und West nicht. Das erinnert mich an meine Kindheit vor dem Mauerbau, als ich von Ostberlin, wo ich zu Besuch bei meinen Großeltern war, zum Westteil ging, um mir die Mickymaus zu kaufen. Nach 60 Jahren hat mir Die Zeit also ein „Déjà vu“ beschert. Für 2021 stellt sich deshalb für mich die Frage, wann hört die Bevormundung auf, die sich aus einer gut gemeinten Berichterstattung ergeben kann? Ostdeutsche Leser sind auf Grund des 40 jährigen sozialistischen Feldexperiments darin sehr sensibel. – Dr. Wolfgang Lüdge
Leserbriefe zu „Jetzt kommt der Erasmexit“ von Manuel J. Hartung
Ob sich wohl irgendein europäisches Regierungsmitglied klargemacht hat, was im neuen Handelsvertrag – auch über Erasmus+ – steht oder genauer nicht steht? Innerhalb von zwei Tagen nach der Einigung der Unterhändler signalisierten die Regierungen Zustimmung, obwohl die Lektüre eines 1.200 Seiten starken Dokuments bei einer Lesegeschwindigkeit von 30 Seiten pro Stunde fünf volle Arbeitstage erfordert. Dass das Erasmus-Abkommen nicht verlängert werden soll, erfuhr man, wenn überhaupt, eher nebenbei.
Wieder einmal musste die Bildung wirtschaftlichen Interessen weichen. Von Stellungnahmen der Kulturstaatsministerin oder der für Bildung zuständigen Länderministerien hörte und hört man skandalöserweise nichts. Dabei ist ein Schul- oder Studienaufenthalt im Ausland das beste Mittel, um über den Tellerrand zu blicken und Bindungen zwischen den Völkern entstehen zu lassen. – apl. Prof. Dr. Wilhelm Büttemeyer
In Ihrem Artikel schreiben Sie von der “selbstverschuldeten Unerreichbarkeit“ der britischen Universitäten. Ist sie denn wirklich selbstverschuldet, d.h. waren die Universitäten in die Entscheidung, aus dem Erasmus-System auszutreten, eingebunden? Die britischen Professoren, die ich kenne, sind zumindest über den Brexit mindestens ebenso fassungslos, wie Kontinentaleuropa, und sich des Schadens für das britische Wissenschaftssystem wohl bewusst. Ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass knapp die Hälfte der Briten sehr gern in der EU geblieben werden, und ich nehme an, dass der Anteil unter Akademikern noch höher ist. – Stefan Witzel
Den Inhalt des Artikels von Herrn Palmer unterstütze ich voll und ganz. Es ist geradezu irrwitzig, wie eine Minderheit von Datenschützern panisch den Einsatz hoch effektiver Datentechnik für den Gesundheitsschutz verhindert. Sie nehmen lieber Tod und Krankheit von Menschen in Kauf, als technische Möglichkeiten für den Schutz der Menschen einzusetzen. Wie Herr Palmer richtig ausgeführt hat geben die Menschen bei der Nutzung sogenannter sozialer Medien, beim Onlinehandel und mehr oder weniger nützlicher Apps ihre Daten preis, weil sie sonst nicht in den Segen derer Anwendung kämen. Wenn aber der Staat auf anonymisierte Standortdaten zugreifen will, bricht die orwell ́sche Götterdämmerung herein.( In Verbindung mit der Strafverfolgung ist Ähnliches zu beobachten.)
Und so komme ich auf die Verbindung zu dem Artikel „Keine Zeit zum Rumprobieren“ der Vorwoche, in dem Frau Schürmann sich damit brüstet, durch ihre datenschutzrechtlichen Eingriffe der App zu großer Akzeptanz verholfen zu haben. Woher weiß sie das? Mit wem hat sie darüber gesprochen? Mit ihrer Blase am Prenzlauer Berg? Kann es nicht ebenso richtig sein, dass eine „Taiwanesische App“ zu viel mehr Akzeptanz geführt hätte, weil sie viel erfolgversprechender gewesen wäre? Ist das Erreichen von Akzeptanz nicht auch das Ergebnis positiver Kommunikation? Leider wurde die App aber von Anfang an von Bedenkenträgern zerredet.
Und noch ein letzter Punkt. Ich gehöre zu den 23,8 Millionen, die die App heruntergeladen haben, Sogar zweimal. Beim ersten Mal habe ich nämlich angenommen, ich hätte einen Fehler gemacht, weil sie sich nicht öffnen ließ. Hatte ich aber nicht, mein mobiles Endgerät ist mit seinen sechs Jahren einfach zu alt um die App anzuwenden. Die Bundesregierung hat sich nämlich von Apple, Google und co. über den Tisch ziehen lassen, weil die App unterhalb einer bestimmten Betriebssystemversion nicht läuft.
So sind also rund 25% der Endgerätenutzer von der Anwendung der App von vornherein ausgeschlossen. Da es gerade die Alten sind, die sich nicht ständig mit neuen Geräten versorgen, weil die vorhandenen das was man mit ihnen tun will problemlos leisten, ist durch diese Nutzungseinschränkung gerade eine große Risikogruppe von der Nutzung der App ausgeschlossen. Aber andererseits war es wohl ein gutes Konjunkturprogramm für Apple und co. So hat Alles auch seine guten Seiten, wenn auch nicht für die Richtigen. – Henning Glaser
Als Lehrerin bin ich es gewohnt, dass jeder (und jede, aber zur Verbesserung der Lesbarkeit wird hier nicht gegendert) meint, er wisse, wie es in der Schule zuginge und was Lehrer alles falsch machen bzw. besser machen könnten, wenn sie nur wollten. Schließlich war doch jeder mal in der Schule und weiß, wie es da zugeht. Obwohl ich auch jahrelang Sportberichte für meine Heimatzeitung verfasst habe, wäre ich nie so vermessen, Ihnen zu erklären, wie Ihr journalistisches Handwerk funktioniert.
Seit Corona die ganze Welt vor große Herausforderungen gestellt hat, wird die Kritik lauter, rabiater und häufiger, gerade auch in Ihrer Zeitung. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass Sie mit neuen Erkenntnissen aufwarten und auch anderen Raum dafür geben. Am 26. November kam Ekkehard Winter von der Deutschen Telekom Stiftung zu Wort, der glaubt, Lehrkräfte müssten sich mehr fortbilden und er wüsste, wie’s besser ginge. Ich habe seit Dezember 2019 insgesamt 8 Fortbildungen gemacht, darunter fünf online. Ich habe mich mit Lehrmethoden und dem Erstellen von attraktiven Lernmaterialien befasst, mit digitalem Lernen, mit Fernunterricht, mit Mediendidaktik und mit Themen der Integration. Zusätzlich müssen Lehrkräfte an beruflichen Schulen (da arbeite ich) regelmäßig Betriebspraktika machen. Wie viele Fortbildungen machen denn Menschen in anderen Berufen so?
Die Fortbildungen sollten am besten von den Hochschulen angeboten werden, nicht von anderen Lehrkräften. Inwiefern verfügt denn ein Dozent an der Universität über bessere praktisch anwendbare Kenntnisse über die Schule und die Schüler als erfolgreiche und versierte Lehrerkollegen? Herr Winter vergleicht uns mit Fachärzten, die seit einem Vierteljahrhundert keine Kenntnisse mehr dazugewonnen haben. Scheinbar glaubt er, dass wir unsere Arbeitsblätter noch mit der Hand schreiben, Fernseher mit Videogeräten durch die Schule schieben und Kassenrecorder mit CD-Deck mit uns herumtragen. Damit ist er aber wohl nicht allein, woher käme sonst die Idee, dass das Wichtigste im Moment sei, Lehrkräften einen Laptop zur Verfügung zu stellen?
Keine Lehrkraft braucht einen Laptop, den die Schule stellt, wir alle haben einen Laptop oder einen PC zu Hause, auf denen gängige Software installiert ist, die Boxen funktionieren und einen Drucker mit Scanner haben wir auch. Aber unsere Schüler nicht, und das ist das Problem, wenn wir Arbeitsmaterialien per Email ins Homeschooling schicken oder auf Mebis hochladen. Apropos Homeschooling: da wäre es von Vorteil, wenn das Internet überall auf dem flachen Land stabil liefe, sonst klappt es mit der Videokonferenz nicht – könnte sich ja die Telekom mal drum kümmern.
Woran scheitern meine Schüler, die ja alle sogenannte Digital Natives sind, sonst noch so? Zum Beispiel am Lesen und Verstehen von Arbeitsaufträgen und am Öffnen, Bearbeiten und Zurücksenden von nicht-schreibgeschützten Word-Dokumenten („die Schrift ist so klein, das kann ich nicht lesen – wie, das kann ich selber ändern? – wo denn?“) oder Dokumenten allgemein („an meinem Handy geht nur PDF“). Eine Email mit einem eindeutig nachvollziehbaren Arbeitsauftrag und selbsterklärendes Arbeitsmaterial zu verfassen dauert übrigens unglaublich lange – probieren Sie es aus. Ich habe es auch mit kurzen Audio-Nachrichten versucht – vergebens. Zum geteilten Unterricht, der vielfach gefordert wird: der verursacht deutlich mehr Arbeit als normaler Unterricht, aber das ist ja kein Problem, denn Lehrer sind Beamte und haben nachmittags frei und sowieso so viel Ferien.
Ich bin sehr froh gewesen, so lange wie möglich im Präsenzunterricht zu sein, denn die meisten meiner Schüler sind nicht diszipliniert genug, ständig weitgehend allein am PC zu lernen. Beim Lockdown letztes Schuljahr haben viele extrem wenig für die Schule gemacht (das weiß ich, weil ich die Ordner aller meiner Schüler durchgesehen habe, auch wenn das sehr lange gedauert hat) und haben jetzt große Lücken. Auf meine Nachrichten haben sie meistens nicht geantwortet, sondern waren im Lockdown verschollen. Wenn der bayerische Kultusminister meint, dass 90% aller Schüler den Montag und Dienstag vor Weihnachten zum Lernen nutzen werden, halte ich dagegen. Ich habe vor dem Lockdown vor Weihnachten den Schülern noch eine Aufgabe zur Erledigung vor den Ferien mitgegeben, mit der Aufforderung, ihr Ergebnis zu fotografieren und mir zu schicken. Von zwei Dritteln habe ich keine Antwort erhalten.
Was mir noch aufgefallen ist: für die Journalisten der Zeit gibt es scheinbar im Wesentlichen nur drei Schulformen, nämlich Grundschule, Mittelschule und Gymnasium. Berufliche Schulen nehmen Sie überhaupt nicht wahr. Das ist sehr schade, denn bei uns werden nicht nur alle Schüler beschult, die über eine Ausbildung ins berufliche Leben gehen, sondern auch alle jugendlichen (oft unbegleiteten) Geflüchteten, die zu alt für eine Regelschule sind – das sind die meisten. Bei uns lernen sie in Berufsvorbereitungsklassen nicht nur Deutsch, sondern zum Beispiel auch Mathe und Sozialkunde, können einen Mittelschulabschluss erreichen und werden anschließend in beruflichen Fachklassen integriert, um einen Beruf zu erlernen und ihr Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Übrigens erlernen die meisten geflüchteten Jugendlichen an unserer Schule den Beruf der Sozialpflege – sehr gefragt in diesen Zeiten.
In der aktuellen Ausgabe der Zeit bedauern Sie, dass durch den Brexit die Erasmusprogramme der Universitäten nicht mehr stattfinden werden. Das ist sehr bedauerlich, ich war selbst mit Erasmus während meines Studiums in England. Ist Ihnen aber auch bewusst, wie viele Erasmusprojekte jedes Jahr an beruflichen Schulen stattfinden? Ich bin gespannt, wie es in Ihrem Bildungsressort im neuen Jahr weitergeht. – Daniela Sailer
Leserbriefe zu „Empörpoly“ von Jochen Bittner und Stefan Schirmer (Idee und Konzeption)
Selten so gut amüsiert und herzhaft gelacht. Herrlich. Mit fiel auf, dass keine Damen Ihrer Redaktion sich an den Albernheiten beteiligt haben. Kann es sein, dass das letzte graue Feld, Seite 13 ganz unten rechts, damit zu tun hat? Viele Grüße aus Saarbrücken. – Hartmut van Meegen
Ich habe eben mit meiner Familie das Empörpoly um Geld gespielt, ein Punkt entsprach 10€. Wir sind jetzt total zerstritten und reden nicht mehr miteinander, so ein Scheißspiel Das ist ja ein reines Glücksspiel, so etwas gehört verboten. Als langjähriger Zeitleser bin ich von ihnen ein anderes Niveau gewohnt...!!!!!! PS: Ich freue mich schon auf zahlreiche Artikel im nächsten Jahr, auf die ich meine neu erworbenen Empörskills anwenden kann. – Georg Partzsch
Mit Ihrem Beitrag „Empörpoly“ haben Sie den Nerv der Deutschen exakt getroffen. Das Zwei-Seiten-Epos ist gleichermaßen witzig, lustig, traurig und zutiefst realistisch. Besser hätte man die aktuelle Gemütsverfassung der Deutschen auf spielerisch-humorige Art gar nicht darstellen können, das ist gewissermaßen eine silvesterliche Eulenspiegelei. Den Autoren gebührt höchste Anerkennung, zum Jahresende so ein komplexes, einzigartiges Werk zustande gebracht zu haben. Ich unterstelle allerdings, dass der Spaß im Team nicht ganz gering war – ganz im Sinne von Eulenspiegel. – Dr. Ulrike Schlüter
Ausgezeichnete Idee der Herren Bittner und Schirmer auf der Höhe unserer Zeit, sonderlicher Trigger und allgemeiner Empörung. Erwachsenenbildung zwecks mentaler Abwechslung mit spielerischer und humorvoller Methodik gestaltet; schön wär’s, wenn’s immer so schön wär. Zudem endlich mal ein Spiel, bei dem es wohl keine klaren Verlierer (Frauen sind mitgemeint) gibt. – Matthias Bartsch
Leserbriefe zu „Tschüss!“ von Mariam Lau
Ihre Betrachtungsweise aktueller Fragen schätze ich sehr. Da unterschiedliche Betrachtungsweisen nicht auszuschließen sind, erlaube ich mir, meine Sicht auf dieses Thema hier darzustellen. Mir geht es dabei nicht um Streit, sondern lediglich darum, eine andere Perspektive sichtbar werden zu lassen. Meine Erfahrung ist, die Bereitschaft zur politischen Betätigung und Profilierung hält sich in überschaubaren Grenzen. Als berufliche Perspektive kommt dieser Weg nur für Wenige in Frage (mit oder ohne Abschluss:„Vom Hörsaal in den Plenarsaal“). Die Karriereleiter in den Parteien ist sehr lang und sehr unsicher. Mit jeder Stufe, die der Eine oder der Andere weiter (höher) kommt, erwirbt er Anrechte auf Weiterkommen und damit auf Posten.
Von der Masse der 709 Abgeordneten im Bundestag „treten nur wenige besonders hervor“, um ein Attribut der Beurteilung von Beamten zu verwenden. Mich wundert es nicht, dass der Personenkreis mit strategischen Konzepten selten sind. Wenn für die Besetzung von Stellen eine Quote entscheidet, besteht die Gefahr, dass noch weniger Kandidaten mit strategischen Konzepten Probleme lösen. Über die zu Ende gehende Ära Merkel wird die Geschichte urteilen. Mein Urteil wird sehr stark beeinflusst von einigen ihrer persönlichen Aussagen:
Im Interview wurde sie gefragt, warum sie sehr lange schweige zu aktuellen Problem. Ihre Antwort war, sie müsse sehr lange überlegen und immer zu Ende denken. Davon habe ich jedoch nichts wahrgenommen, weder in der Migrationspolitik, noch in der Pandemie. Vor der Bundestagswahl 2017 stellte sich Frau Merkel einem ausgewählten Forum von Wählern in Bayern. Dort wurde sie von einer Frau gefragt, was sie als Kanzlerin zu tun gedenke gegen eine zu befürchtende Islamisierung unserer Gesellschaft. Die Antwort von Frau Merkel lautete sinngemäss, sie brauche doch keine Angst zu haben, sie könne doch zur Bibelstunde gehen, um Bibelfests zu werden. Dann könne sie den Migranten die Bibelgeschichte an Hand der Bilderfenster in ihrer Kirche erklären. – Schmolling
Die Quote für Frauen bringt nichts. Ich wundere mich ohnehin, wer das ins Spiel gebracht hat. Wer sich für Politik interessiert braucht keine Quote. Es ist eine unnütze Forderung. – Gunter Knauer
Lange hat man sich ja verwundert die Augen gerieben, wie ausgerechnet die „Grand Old Party“ in den USA einen Kandidaten mit dem Motto „Anti Establishment“ nominieren konnte. Aber – allein die Tatsache, dass der Kandidat F. Merz mit seinem Programm „ICH“, ausgerechnet in der größten christlichen Partei Deutschlands überhaupt eine Chance hat, gibt Anlass zur großen Sorge – auch hier. Es müssen sich die Kandidaten Röttgen und Laschet sowie alle, denen die Werte der CDU am Herzen liegen, dringend und sofort dazu aufraffen, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Ob er nun Laschet, Röttgen, Spahn, ... heißt – egal. Aus Amerika kann man nur lernen, dass sich auch etablierte Parteien mit unbestritten großen Verdiensten gegen Kandidaten mit dem Programm „ICH“ verbünden müssen – RECHTZEITIG !!!! – Burkhard Plett
Leserbriefe zu „Der gute Bär“ von Peter Kümmel
Großartig, diese besondere Ausgabe des Feuilletons mit den kommenden Jubiläen. Der wunderbare und einzigartige Sir Peter Ustinov hat es verdient, als Erster gewürdigt zu werden (Peter Kümmel, „Der gute Bär“). In einer Zeit grassierender Vorurteile und Verschwörungstheorien hat er uns viel zu sagen, zum Beispiel dies: „Ich bin nämlich der Überzeugung ..., dass bei der Infizierung mit nur einem Vorurteil das Tor für alle anderen geöffnet wird, dass schon beim kleinsten Insektenstich die ganze Krankheit ausbricht. Ich kenne niemanden, der nur ein Vorurteil gegen ‚fremde’ Menschen hat und sich neben diesem einen kein anderes leistet. Sobald die Immunabwehr, welche dem ersten Vorurteil rotes Licht zeigt, einmal geschwächt ist, wird sich die Ampel in unserem Kopf für weitere auf Grün umstellen.“ Dabei findet Sir Ustinov Vorurteile nicht von vornherein verwerflich, der „springende Punkt“ dabei sei die Bereitschaft, „sie zu revidieren“ ...
Überraschend und faszinierend die Parallelbetrachtung der Marquise de Pompadour und der Revolutionärin Rosa Luxemburg (Jens Jessen, „Ihre Waffe war ihr Geist“). Pauline Viardot-García: Nie gehört! Doch welche Fülle begeisternder Detail im Artikel von Volker Hagedorn („Schluss mit Diva und Deko“), den ich gleich zwei Mal gelesen habe, mich ehrfürchtig verneigend vor der Frau, in die sich Charles Gounod und Hector Berlioz verliebten, die auf der Bühne Gustave Flaubert zutiefst ergriff und Charles Dickens zum Weinen brachte und so weiter und so toll!!! – Ludwig Engstler-Barocco
Herzlichen Dank für die Beiträge über die „herrlichsten Geburtstage 2021“. Ohne die „Berechtigung“ der Genannten infrage zu stellen, so vermisse ich doch einen wichtigen Geburtstag, den 150. von Heinrich Mann. Ich darf sicher davon ausgehen, dass dies zeitnah in der „Zeit“ erfolgen wird. – Gunter Lange
Von den vorgestellten herrlichsten Jubiläumsgeburtstagen kann ich aus „persönlichen“ Gründen zwei besonders nachvollziehen. Zum einen den von Sir Peter Ustinov, der für mich bis heute ganz einfach der Inbegriff eines populären (und doch) geistreichen „Allrounders“ ist. Zum anderen den von Rosa Luxemburg, die in der Tat über einen kraftvollen und leidenschaftlichen Intellekt verfügt hat. Nach einer Dokumentation über die „durchaus sehr eigenwillige Sozial- demokratin“ (Hans-Jochen Vogel) jedenfalls war ich überaus eingenommen von den Waffen dieser außergewöhnlichen Frau. Insofern – danke für die schönen Erinnerungen per ZEIT-Feuilleton. – Matthias Bartsch
Leserbriefe zu „»Es gibt eine Esoteriksucht«“. Gespräch mit Hans-Peter Erb geführt von Sabine Rückert
In Ihrem Gespräch vergleichen Sie ständig Äpfel mit Birnen, legen zweierlei Maß an oder stellen Behauptungen auf, denen dann nicht weiter nachgegangen wird. Zunächst einmal haben Wochentage rein gar nichts mit den Sternen oder der, wie Sie es nennen, Sterndeuterei zu tun ( sind für eine Horoskopdeutung unerheblich). Sie haben ja auch diesen Fakt der Geburten an Sonntagen ausschließlich passiv dargestellt ( ich wurde geboren etc.). Es gab dabei aber auch die aktiv Beteiligten, die Mütter und man müsste vielleicht dahingehend genauer untersuchen, warum diese an Sonntagen eine Gebärfreude entwickelten. Und wenn sich mein Eindruck aus dem von mir sehr geschätzten Potcast „Unter Pfarrerstöchtern“ nicht allzu sehr täuscht, mag hier vielleicht gar nicht mehr so viel Zufall im Spiel gewesen sein.
Etwas weiter unten sagt Herr Erb, es sei nicht verwunderlich, dass die Sterne für die dem Menschen ureigene Sinnsuche „herhalten“ müssen, dienten sie doch früher der Navigation. Hier wird alles mit allem in einen Topf geworfen zu dem Zweck, die Astrologie ad absurdum zu führen. Das eine schließt jedoch das andere überhaupt nicht aus. Dass die Sterne zur Navigation dienten, bedeutet ja nicht, dass im Zusammenhang mit Sternbildern bzw. Planetenbewegungen nicht auch Beobachtungen zu anderen Bereichen des menschlichen Lebens gemacht werden können, die auch heute noch Relevanz haben, obwohl es für die Navigation mittlerweile andere Gerätschaften gibt. So wird jedoch ständig von Astrologiegegnern verfahren:
Etwas aus einem Bereich, der veraltet ist, wird als Beispiel herangezogen, um zu beweisen, dass das komplette Thema sozusagen ins Mittelalter gehört. Dass die einzelnen Sterne der genannten Sternbilder nicht physisch nah beieinanderstehen, spielt für die astrologische Beobachtung gar keine Rolle. Die Sternbilder dienen vielmehr der Orientierung am Himmel vom Standpunkt der Erde aus: Wenn Planeten diese oder jene Region am Himmel passieren, kann man diese oder jene Ereignisse auf der Erde beobachten. Dafür gibt es Jahrtausende alte und über Jahrtauende währende Erkenntnisse. Wenn es die sogenannte „self-fulfilling-prophecy“ gäbe, warum funktioniert sie eigentlich nicht bei positiven Voraussagen, derart wie „Du wirst nächste Woche deinen Traummann treffen“ o.ä..??
Am besten ist jedoch der Abschnitt, in dem Herr Erb von Suchtproblemen bei Astrologie- und Esoterikanhängern spricht (natürlich , um Astrologen zu diskreditieren). Das hat ungefähr so viel Substanz wie als wenn Sie die gesamte Bäckerbranche verunglimpfen, weil es Menschen gibt, die süchtig nach ihrem täglichen Stück Sahnetorte werden. Im Bereich Astrologie sind die Astrologen schuld, die unverschämterweise auch noch Geld für ihre Arbeit nehmen; bei den Bäckern, die mir die Brötchen auch nicht umsonst geben, sind die Kunden selbst schuld, wenn sie angesichts der verführerischen Auslagen Essstörungen entwickeln.
Das nenne ich mal mit zweierlei Maß messen. Es gibt sicherlich unter Astrologen auch unseriöse Vertreter, so wie unter Juristen, Medizinern, Apothekern, Journalisten, Pastoren, Lehrern, Metzgern und Bäckern usw.usw. auch, aber niemals wurde oder wird deshalb gleich der komplette Berufsstand verurteilt – nur die Astrologen werden in Bausch und Bogen niedergemacht... Man muss leider ständig beobachten, dass die Astrologie von naturwissenschaftlicher Seite rigoros abgelehnt wird, allerdings wie immer sehr schnell deutlich wird, ohne auf Seiten der Naturwissenschaftler genauere Kenntnis von der Materie zu haben.
Ist das etwa wissenschaftliche Vorgehensweise??? Auch würde mich mal interessieren, was denn daran so schlimm ist, nicht alles als puren Zufall zu betrachten. Ich erspare mir die übliche Formulierung, ich sei nun als langjährige ZEIT-Leserin enttäuscht; nun ja, ein wenig schon, aber die oben beschriebene Haltung ist nun wirklich gerade Mainstream und da kann sich auch die ZEIT nichts anderes erlauben. Schade! Aber wir Astrologen denken in größeren Zeiträumen und es kommen auch wieder andere Zeiten. – Susanne Bartsch
In der Zeit 01/2021 ist beim Artikel „Es gibt eine Esoteriksucht“ ein kleines – wie wir hier in Wien sagen – Hoppala passiert. Die Antennen-Galaxien sind nicht 66 Lichtjahre von der Erde entfernt, sondern wohl 66 Millionen. Darüberhinaus freut es mich, dass im Titelthema die Position unserer Spezies in Raum und Zeit einer größeren Leserschaft wieder in Erinnerung gerufen oder gar vor Augen geführt wurde. – Gustav Rittler
Für mich bleibt die eigentliche Frage, „warum der Mensch auch im Zufall immer einen Sinn suchen muss“, im Artikel unbeantwortet. Denn offensichtlich suchen wir (und finden vermeintlich) Sinn und Systematik überall, auch dort, wo es den Sinn überhaupt nicht gibt. Und dass „wir aus Zusamenhängen zwischen Handlungen und dem, was sich daraus ergibt, lernen“ erklärt ja in keinster Weise die „EsoterikSUCHT“. Die Antwort auf die Frage, warum Menschen es mit der Sinnsuche und -findung so unfassbar übertreiben, liegt eher verborgen in einem Teil der aktuellen kognitiven und Sozialpsychologie und die relevanten Erkenntnisse sind auch noch nicht älter als 20 Jahre. Der Psychologe Justin Barrett hat wohl als erster das „Hyperactive Agent Detection Device“ (HADD) beschrieben.
Das ist aber noch vergleichsweise unbekannt und es gibt keinen deutschen Begriff dafür. Ich nenne es „Übereifriger Akteurs-Detektor“. Das HADD ist immerhin eine Beschreibung des Systems der überschießenden Suche nach Zusammenhängen, aber noch keine Erklärung dafür, dass Menschen in dieser Hinsicht eine so offensichtliche Fehlanpassung an die Realität entwickelt haben. Das hat dann mit asymmetrischen Fehlerkosten zu tun. Da meine Zuschrift vermutlich in der Masse untergeht, verzichte ich hier auf die Arbeit der weiteren Ausarbeitung. Bei Interesse kann ich das Thema aber gerne weiter auführen. – W. Deimel
Leserbriefe zu „Eine Heilkur namens Kunst“ von Hanno Rauterberg
Der Vergleich Dürer – Beuys erscheint mir nicht nur “ haarsträubend“, sondern auch „an den Haaren herbeigezogen“, wobei dieser Vergleich nicht nur mangels (Haar-)Masse auf Seiten von Beuys erheblich hinkt und wohl eher als provozierender “ Kehraus „-Beitrag am Schluß des Geburtagskalenders 2021 gemeint ist. Dies trifft auch auf die abschließende diffuse Interpretation des Feldhasen bei Beuys und Dürer zu, die mich an den Satz erinnert:“ Sein Name ist Hase, er weiß von nichts“. Mit diesem Schlußsatz ergreife ich nun “ das Hasenpanier“. – H. Fommert
Vergessen wir mal Dürer, aber Beuys ? Der Mann mit der Fettecke, aber vielleicht hat das Fett Heilkräfte ? – Hans-Emil Schuster
Leserbriefe zu „Schluss mit Diva und Deko“ von Volker Hagedorn
Eine schöne Idee für ein Feuilleton, das Jahr mit einigen Gedenktagen an mehr oder weniger runde Geburtstage zu beginnen. Erfreulich dabei ist die Frauenquote von 50%, und als Musikwissenschaftlerin freut es mich besonders, dass auch die Komponistin Pauline Viardot Eingang in diese Reihe kleiner Würdigungen gefunden hat, noch dazu mit einem gut informierten Text. Allerdings auch mit einem Wermutstropfen: Pauline Viardot gehöre wie Clara Schumann zur „ersten Generation von Komponistinnen in einer Männerwelt“ heißt es da.
Sicher, die Zahl der Komponistinnen, die wir heute aus der Musikgeschichte kennen, ist kleiner als die der Komponisten. Die kultur- und gesellschaftshistorischen Gründe dafür sind vielfältig und sind hinreichend aufgearbeitet worden (unter anderem der Ausschluss von Frauen vom institutionellen Kompositionsstudium an Konservatorien und Musikhochschulen, z. T. bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein).
Ein zentraler Grund, warum so viel weniger Komponistinnen bekannt sind, ist jedoch der, dass das Wissen um diese immer wieder negiert wurde und wird. So wie in der Gratulation an Pauline Viardot, die keineswegs zur „ersten Generation“ von Komponistinnen gehörte, denn es hat im Gegenteil immer Komponistinnen gegeben, die ihren künstlerischen Weg ungeachtet aller Hindernisse gegangen sind. So ist der Name Hildegard von Bingen (1098–1179) alles andere als unbekannt, und sie war keineswegs die erste. Maddalena Casulana Mezari (geb. 1544), Francesca Caccini (1587–nach 1641), Barbara Strozzi (1619–1677), Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1665–1729), Marianne Martines (1744–1812) oder Maria Szymanowska (1789–1831) sind nur einige von zahllosen Beispielen von Komponistinnen aus früheren Generationen. Die in dieser Liste klaffende Lücke zwischen 1200 und 1500 ließe sich erfahrungsgemäß leicht schließen, wenn man die entsprechenden Quellen erschließen würde – vorausgesetzt natürlich, sie sind noch erhalten.
Robert Schumann behauptete einst scheinbar galant, die Namen der Komponistinnen seiner Zeit ließen sich „bequem auf ein Rosenblatt schreiben“. Doch auch er hatte schon Unrecht, allein Clara Schumann und Pauline Viardot gehörten zu seinem persönlichen Umfeld, ebenso Fanny Hensel. Wiederholt rezensierte er Werke von Komponistinnen, die ihm in gedruckten Ausgaben vorlagen, z. B. von Louise Farrenc oder Leopoldine Blahetka. Dass der Komponist, der auch Herausgeber einer Musikzeitschrift und ein wacher Musikrezensent war, darüber hinaus z. B. Emilie Mayer oder Johanna Kinkel und zahllose weitere nicht gekannt haben will, lässt sich auf sachlicher Ebene allenfalls mit deren geringer Präsenz im Konzertleben erklären.
Bis in die 1970er und 80er Jahre haben diese Namen kaum jemanden interessiert. Doch seitdem wird kontinuierlich über Komponistinnen und ihre Werke geforscht, und die Ergebnisse sind in vielfältiger Weise allgemein zugänglich, am einfachsten im Internet, konkret erfahrbar auf dem CD-Markt. Dass die Werke von Komponistinnen selten oder nie in Konzerten und Opernhäusern zu hören sind, heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Pauline Viardot war zweifellos eine ganz besondere Komponistin, und es ist absolut gerechtfertigt, diese Besonderheit auch gebührend hervorzuheben. Doch auch wenn es eine lange Tradition hat: Es ist nicht nur unnötig, sondern auch sachlich falsch, zu diesem Zweck die kulturellen Leistungen anderer Frauen einmal mehr zu negieren. – Dr. Christin Heitmann
Mit großem Genuss lesen wir Ihren Artikel zu Pauline Viardot-Garcia in der aktuellen ZEIT. Dafür möchten wir uns mit einem musikalischen Gruß zum neuen Jahr bei Ihnen bedanken – unserem Silvesterkonzert mit frühchristlichen Gesängen aus armenischen und europäischen Klöstern. https://www.youtube.com/watch?v=5CipUAzJiik&feature=emb_logo – Ensemble Cosmedin Stephanie & Christoph Haas
Leserbriefe zu „Wie kam das Web in die Welt?“ von Michael Allmaier
...das www. war für mich stets ein schwarzes Loch am Firmament! Die Super-Recherche von Michael Allmaier (und Team) über das WORLD WIDE WEB , und w e r, w o, w i e und w a n n es entdeckt wurde, war bestimmt nicht einfach wegen der Bescheidenheit des Entdeckers Tim Berners-Lee (und Team!). Und diese weltweit genutzte Entdeckung ist noch nicht einmal 30 Jahre alt! Den Artikel habe ich ausnahmsweise mal nicht umständlich kopiert – sondern nur den www.-Link an alle Interessierten in meinem Umkreis, besonders an meine Enkel, weitergegeben! – Ingrid Schröter
Ein guter Artikel, der die schnöde Arbeitsweise in der Informatik einfängt. Steve Jobs wird am Ende gescholten, er hätte das Web verpasst. Das ist nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Der abgebildete ’schwarze Würfel‘ war ein NeXT Computer, der von Jobs Firma NeXT entwickelt wurde. Zu seiner Zeit war er einer der besten PCs. Er wurde verwendet, weil er einen Interrupt zur Verfügung stellte, mit dem der laufende Prozess angehalten wurde, wenn eine Nachricht über das Modem ankam. Steve Jobs war 11 Jahre nicht bei Apple, sondern leitete NeXT. Wer weiß, ob das Web ohne seinen leistungsfähigen Computer ans Laufen gekommen wäre. – Prof. Dr. Tilo Hildebrandt
Leserbriefe zu „Urlaub machen im Warenhaus“ von Hanna Grabbe et al.
Das Fallbeispiel Kaufhäuser im Kontext der Verödung der Innenstädte finde ich eine spannende Nische dieses doch sehr umfassenden Themas. Eine weitere Antwort auf die Frage inwiefern die leerstehenden Flächen in Zukunft wirtschaftlich, kulturell, aber auch sozial in Wert gesetzt werden können, bietet aus meiner Sicht die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Seit Oktober studiere ich hier Freie Kunst und wurde mitsamt 70 anderen Erstsemestern in ein leerstehendes Kaufhaus in der halleschen Innenstadt einquartiert. Auf drei Stockwerken des ehemaligen Küchen- und Haushaltswarenkaufhauses Xenos haben sich nun kreative Köpfe ihren Atelierplatz eingerichtet. Als Passant erhascht man den ein oder anderen Blick hinter die teilweise abgeklebten Schaufenster des Kaufhauses auf das künstlerische Treiben in seinem Inneren.
Filigrane Pappskulpturen schlängeln sich die massiven Jugendstiltreppen hinauf, Musik aus verschiedenen Etagen bildet interessante akustische Kompositionen, Demos werden mit selbst gestalteten Plakaten am Eingang beworben, Kunstbibliotheken in alten Warenregalen eingerichtet und der ein oder andere Austausch über das eigene Schaffen an der gruppeninternen Küchenecke getätigt. Das Ganze diente vorerst als Lösung zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen, entwickelte sich für mich jedoch Stück für Stück zu einem Life-Akt des künstlerischen Schaffensprozesses mitten in der Stadt. Auch wenn von den Projekten bisher wenig nach außen gelangte und zudem der Lehrbetrieb nun vorerst aussetzen muss, bin ich gespannt, was in den kommenden Semestern auf dieser Fläche passieren wird und wie es von den Hallenserinnen und Hallensern aufgenommen wird! – Paula Barth
Sie beschreiben zwar sehr schön und umfangreich das Veröden der Innenstädte. Eine der Hauptursachen für das Sterben des Einzelhandels und des privaten Fachhandels (gegenüber den „Ketten“) untersuchen Sie leider nicht. Es ist die fehlende soziale Verantwortung der wenigen privaten reichen Immobilienbesitzer, denen große Gewerbe- bzw. Mietflächen in den Innenstädten gehören. Diese haben in den letzten 20 Jahren die Mieten stetig und teilweise exorbitant erhöht, weil sich „Ketten“ und Banken“ die Mieten leisten konnten.
Und so hat der Markt dafür gesorgt, dass der private Einzelhandel, wenn er nicht Eigentümer, sondern nur Mieter der von ihm genutzten Gewerbeflächen war, von diesen geldgiergen Vermietern ausgesaugt wurde und aus den Innenstädten verschwand. Die Politik hat zugeschaut und nichts unternommen. Die Presse stellt fest, alle wundern sich, und es geht weiter wie bisher. Währenddessen werden durch die Politik immer neue Abschreibungsmodelle für superreiche Immobilienbesitzer erdacht oder zumindest nicht abgeschafft.
Die Vermögensteuer ist aufgrund ihrer durch das Bundesverfassungsgericht vor fast 30 Jahren festgestellten Verfassungswidrigkeit (insbesondere aufgrund der Immobilienbewertung) immer noch nicht wieder eingeführt. Nun sollen es – so schreiben Sie – Stadtplaner richten. Diese können sich aber nicht beliebig über Eigentumsrechte gierige Vermieter hinwegsetzen. – Michael Platz
Leserbriefe zu „Reiche zuerst“ von Andrea Böhm
„Patente ... seien die besten Voraussetzungen für die rasche Verteilung von Medikamenten.“ – Nicht, wenn man die Kunden vorher an der Krankheut sterben lässt. Man könnte ja mal menschlich sein. – Iman Schwäbe
Die Forderung Indiens und Südafrikas, den Patentschutz für Medikamente abzuschaffen, kann ich gut verstehen, in beiden Ländern gibt es grosse Hersteller von Generika. So weit ich weiss, haben diese Hersteller aber noch nie ein neuartiges Medikament entwickelt, und ich sehe nicht, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Wenn sich die Forschung nicht rentiert, gibt es bald keine neuen Medikamente mehr. – Peter Pielmeier
Leserbrief zu „Dollars für die Heimat“ von Andrea Böhm et al.
An diesem Artikel hat mich das häufig erwähnte Wort ‚Rücküberweisung‘ sehr gestört, weil es m.E. schlicht falsch übersetzt und unpassend ist. Wenn erwähnt wird, das Ökonomen ‚remittances‘ Rücküberweisungen nennen, vermute ich, dass diese Aussage auf einer falsch verstandenen Übersetzung der Korrespondenten beruht. Denn remittances heißt schlicht Überweisungen. Und tatsächlich wird hier ja auch kein Geld zurücküberwiesen, sondern nur überwiesen. Ich lass mich gern eines Besseren belehren, aber ich verstehe unter Rücküberweisungen nur Beträge, die vorher überwiesen sein müssen und aus irgendeinem Grund zurücküberwiesen worden sind. – Joachim Wernicke
Leserbrief zu „Politik ohne Anfassen“ von Peter Dausend und Mariam Lau
Sie führen aus, Sie wollen erwachsenen Leuten nicht sagen, was diese zu tun und zu lassen haben. Bei dieser Einstellung müssten Sie eigentlich die gesamte Gesetzgebung in Frage stellen, übrigens einschließlich des Verbots von Zwangsprostitution. Die lehnen Sie natürlich ab, Sie sollten aber wissen, dass Experten aus Polizei und Wissenschaft von einer skandalös großen Zahl von Frauen in der Zwangs-Prostitution sprechen. Diese stellen einen großen Teil innerhalb der nachweislich 90% von in Deutschlands Prostitution Arbeitenden dar, die aus Süd- und Südosteuropa, oft aus Armutsgebieten, nach Deutschland gebracht wurden und die oft bis zu 15 Sexkäufer pro Schicht ertragen müssen, davon bis zu fünf, nur um die Zimmermiete bezahlen zu können.
Diese Frauen tun das nicht selbstbestimmt. Helfen Sie mir doch einmal zu verstehen, warum Sie sich so eifrig für die Prostitution einsetzen und damit für das Recht einer wohlhabenden Minderheit, eine große Mehrheit von in Zwangs- und Armutsprostitution Arbeitenden sexuell und wirtschaftlich auszubeuten? Es kann doch wohl nicht sein, dass Ihnen das wirtschaftliche Wohl der vergleichsweise verschwindend kleinen Gruppe von Prostitutionsprofiteurinnen, wie Bordellbetreiberinnen, Dominas und Escort-Dienstleisterinnen so sehr am Herzen liegt. Das Nordische Modell braucht übrigens keine Alarmknöpfe. Schauen Sie sich dazu einfach einmal eines der You Tube-Videos des Stockholmer Kriminalinspektors Simon Häggström an. – Dr. Valentin Klöppel
Leserbrief zu „Zahlen, bitte“ von Doreen Borsutzki und Maren Jensen
Bei den Zahlen „Die Großstädte mit den meisten Grünfläche pro Einwohner“ muss Ihnen ein Fehler unterlaufen sein: Die (ländlich strukturierte) Großstadt Salzgitter (105.000 Einwohner) ist flächenmäßig eine der größten Städte Deutschlands mit riesigen Wald-, Feld- und Wiesenflächen. Das sollte doch mehr sein als Potsdam, Kassle oder Bremen. – Reinhold Jenders
Leserbrief zu „WIE ES WIRKLICH IST ... eine Petfluencerin zu sein“ aufgezeichnet von Stefanie Witterauf
Mit Entsetzen las ich den Artikel zur „Petfluencerin“ Talitha Girnus und ihrem Arikanischen Weißbauchigel. Erstens, weil Frau Girnus ein Wildtier als Haustier hält. Igel stehen in Deutschland unter Naturschutz und dürfen nicht als Haustiere gehalten werden. Auch wenn dies nicht für den Afrikanischen Weißbauchigel gilt, so wird doch auch hier von Tierschützern von einer privaten Haltung abgeraten! Zweitens, weil Frau Girnus auf Kosten des Igels Geld verdient. Drittens, weil ihr so viele Menschen unkritisch auf Instagram folgen.
Viertens, weil Ihre Redakteurin, Frau Stefanie Witteruf, diese verwerfliche Tierhaltung unkritisch kommentiert und Frau Girnus somit in ihrem Handeln bestärkt und die ZEIT ihr eine weitere Plattform hierfür bietet. Ich kann nur hoffen, daß viele Tierschützer ähnlich denken, weiterhin entsprechend aufmerksam agieren und Tier- und Artenschutz gewährleisten! Ein enttäuschender Artikel der ZEIT! In der Hoffnung auf Besserung – Cathrin Rost
Leserbrief zu „Tiere können lachen wie Menschen. Stimmt’s?“ von Christoph Drösser
Meines Wissens bestehen echte Zweifel daran, ob Koko so etwas wie die amerikanische Gebärdensprache beherrschte, wie Patterson behauptet. Nicht seriös, wie so vieles, was man über Sprachfähigkeiten von Primaten verlautbart hat. – Prof. em. Dr. Wolfgang Butzkamm
Leserbrief zu „Gesprächsstoff: Kaliumnitrat“ von Katharina Menne
Zu der Strukturformel des Kaliumnitrates habe ich eine Frage. Wenn ich mich richtig an meine Schulzeit erinnere, ist N 3-wertig, O 2-wertig und K 1-wertig. Müsste nicht deswegen ein Sauerstoffatom mit seinen beiden Verbindungen anstatt nur mit N auch mit K verbunden sein. Vielleicht auch eine dumme Frage von mir. – Scheer
Leserbrief zu „Freiheit“ von Elisabeth von Thadden
In Ihrem o.g. Artikel schreiben Sie, dass Sophie Scholl „im tiefen Schwaben“, in dem“schwäbischen Städtchen Forchtenberg“ geboren sei. Forchtenberg liegt aber mitten in Hohenlohe, diesem Landstrich im nordöstlichen Württemberg, den der dicke Friedrich 1806 ff sich von Napoleon hat zukommen lassen. Man kann sich hier sehr unbeliebt machen, wenn man die (Ur-) Einwohner als Schwaben bezeichnet. – Friedrich König
Leserbrief zu „PROMINENT IGNORIERT. Kluges Motto“ von GRN.
Schwierig! „die Welt vorzustellen...vernüftigsten wäre“ trotz Corona, Terrorismus,nuklearer Bedrohung usw. Wahr, Phantasie kennt keine Grenzen. Aber es gibt klaffende Lücke zwischen Vorstellung und Boden Realität. – Kaushik Ray
Leserbrief zu „Unser Revolutionspalast“ von Martin Machowecz
Dazu bleibt nur zu sagen „Leipziger Allerlei“ – Hans-Emil Schuster
Leserbrief zu „Gesichter Gottes“ von Michael Triegel
Die Vorstellungen, die Herr Triegel hier erläutert, sind allgemein bekannt. Seit sich der Mensch seiner selbst bewusst wurde, strebt er nach Erkenntnis der ihn umgebenden Wirklichkeit. Dort, wo große Religionen zur Geltung und Macht gelangten, wurde der Mensch in Beziehung zu einer höheren, allgegenwärtigen, außerirdischen Macht gestellt. Damit sollte der Erkenntnisprozess bereits vor Jahrtausenden abgeschlossen sein. In Unkenntnis der Zusammenhänge irdischen Lebens entstand so das Bild von der Dunkelheit des Todes und gleichzeitig die Furcht vor dem Tod, dem ewig ungewissen. Selbstaufgabe und Demut wurden verlangt.
So entstanden phantastische Vorstellungen, die mittels starker Emotionen einen Schlusspunkt aller Erkenntnis, tiefen Frieden und Glückseligkeit suchen. Eigene Wahrheiten (Erkenntnisse) werden ignoriert, um die Welt der Phantasie nicht zu stören, um dieser Vorstellung zu dienen. Praktisch bedeutet das die Aufgabe seines eigenen Denkens. ES sollte nun an der ZEIT sein, berufenen Protagonisten anderer Vorstellungen ein Podium zu bieten. – R. Renaux
Leserbrief zu „Zwischen Euphorie und Panik“ von Harro Albrecht
Die Zutatenliste der Biontech-Vaccine sollten Sie genauer lesen: PEG ist keines drin, nur in der Formel, die die Transportmicellen beschreibt. Ihrer Allergiestory fehlt daher die Basis, Wissensvermittlung geht besser! – Wolfgang Funk
Leserbrief zu „»Prost. Wie Prost Neujahr«“. Gespräch mit Winfried Böller et al. geführt von Karin Ceballos Betancur und Stefanie Witterauf
Als alter Comic-Kenner muss ich natürlich hier an „Virginia Peng “ erinnern, die Muse und Erzfeindin von Nick Knatterton, eine so genannte „Blume der Gosse“... Aus der Feder ( ja, kratz kratz, per manum !!) des unerreichten Manfred Schmidt, der wie keiner sonst die Wirtschaftwunderzeit persiflieren konnte. Guuugeln sie mal. – Dr. Johannes Pfander
Leserbriefe zu „Da draußen“ von Heike Faller im ZEIT Magazin
Wenn Ihre Autorin für den Kindergarten schreibt, warum wird das dann im Zeitmagazin veröffentlicht? – Bodo Malige
Als Biologin und ehemalige Doktorandin am Max-Planck-Institut f. Verhaltensphysiologie (s. Konrad Lorenz) habe ich gerade mit besonderem Interesse Ihren Beitrag zum Vogelleben auf den Nymphenburger Gewässern gelesen. (Auch als nicht forschungsmäßig mit dieser Tiergruppe befasst, bleibt der Blick dafür bewahrt, wenn man von Seewiesen kommt!) Graugänse, Kanadagänse – das erinnerte mich plötzlich an eine Beobachtung vor einigen Wochen, wo ich dachte: Hm – sieht aus wie Mischling von Kanada- und Graugans ...kann aber doch nicht sein! Und nun erwähnen Sie, dass es vorkomme, wenn auch noch selten! Deshalb als Ergänzung zu Ihrem Bericht:
Am Dreifelder Weiher im Westerwald überwintern Scharen von Wasservögeln, z.Zt. zum allergrößten Teil die altbekannten Stockenten, Blässhühner, Reiherenten, Tafelenten, Höckerschwäne, ein paar Silberreiher und eben auch Graugänse und – in großer Menge – Kanadagänse. Normalerweise halten sich die Trupps eher voneinander getrennt. Aber mir fiel ein Tier auf, das innerhalb einer Gruppe von Kanadagänsen von einer Kanadagans immer wieder verfolgt wurde. Das „verfolgte“ Tier war auffällig anders gefärbt, schien Anteile von Kanada- sowie Graugans zu haben. Die Entfernung war allerdings zu groß, um, auch mit Fernglas, die Färbung so genau zu erkennen, wie Sie sie schildern. Aber mein Eindruck war eben s.o.
Weshalb ich das erzähle: Es geht bei den Hybriden wahrscheinlich nicht nur um eine Veränderung des Gefieders sondern auch des Verhaltens! Und das schien nicht in die Gruppe zu passen. Das Tier ging unter seine „Halb-Artgenossen“, wurde aber nicht erkannt sondern „gemobbt“. Solches Verhalten gegenüber „Aussenseitern“ ist auch von anderen Tierarten bekannt. Aber es würde mich sehr interessieren, ob es dazu bzgl. der Kanada-Graugans-Mischlinge schon systematische Beobachtungen gibt. Forscht Thassilo Franke evtl. selbst dazu? Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen! – Dr. Cornelia Fitger
Leserbriefezur Deutschlandkarte „WIE STÄDTE GENDERN“ von Matthias Stolz im ZEIT Magazin
Seit ca. 55 Jahren lese ich die ZEIT, anfangs am Kiosk gekauft, danach als Abonnentin (wahlweise auch Abonnent*in, Abonnent/in, Abonnent/-in, AbonnentIn, Abonnent_in, Abonnent:in – habe ich eine Version vergessen?). Meinen Vornamen habe ich in all den Jahren nicht geändert. Vielleicht sollten Sie Ihrem Programm beibringen, dass es korrekte Anreden produziert? Barbara war und ist ein weiblicher Vorname. Bei all dem Genderwahn kam noch niemand auf die Idee, alle Menschen mit „Herr“ anzureden. Sie selbst haben im letzten ZEIT MAGAZIN eine Deutschlandkarte veröffentlicht, wie Städte gendern. Wie wäre es mit einem Überblick über Zeitungen und Zeitschriften? Dass für die ZEIT Frauen nicht existieren, wäre ein neuer Aspekt. – Barbara Zeiger
Ach, du liebe Zeit, da habe ich doch letzte Woche die obige Rubrik gelesen und mich danach gefragt, ob die unterschiedlichen Schreibweisen von Bürgerinnen und Bürgern nicht nur die Spitze eines Eisberges sind. Und ob sich das nicht noch auf andere Spitzen treiben lässt. Ich habe das mal angedacht. Bitte sehr:
Gendern, bis die akademisch medizinisch ausgebildete kompetente Fachkraft kommt. Eine Übertreibung? Die Gleichstellung von Frau und Mann ist richtig und wichtig. Im alltäglichen persönlichen Miteinander und Dialog und selbstverständlich auch im geschriebenen Wort. Es darf keine Bevorzugung oder Benachteiligung der einen oder des anderen oder des einen oder der anderen geben. Das steht schon im Grundgesetz, liebe Leserinnen und Leser, liebe Bürgerinnen und Bürger. Alle müssen gleichermaßen und sichtbar angesprochen werden oder eben neutral, liebe Leserschaft, lieber Bürgerschaft. So weit, so gut. Aber es geht ja noch weiter. Und wie weit soll, muss es gehen?
Metzger, Schreiner, Tischler, Glaser, Maurer, Klempner, Bäcker, Schneider, Brauer und Schuster – alles, was ein generisches Maskulinum ist und als neutrale Berufsbezeichnung gedacht war, entbehrt jeder weiblichen Komponente und muss umgehend für die Umgangssprache geändert, gegendert werden. Also ein „in“ hintendran, wenn es um eine Frau geht. Oder man wird eben nicht mehr Metzger oder Metzgerin, sondern Fleischverarbeitungsfachperson. Für jeden Beruf muss ein neutraler, entmännlichter Begriff her. Da reicht es doch nicht, zu schreiben: Metzger (m/w/d). Das Wort Metzger bleibt Metzger bleibt männlich.
Bei einer „Berufsbezeichnung“ gibt es allerdings schon lange geschlechtergerechte Begriffe. Man kennt die Dienstmagd, den Dienstmann, das Dienstmädchen, selbst der Dienstjunge und die Dienstfrau tauchen zumindest in der Googlesuche auf. Und ja, es gibt den Buhmann und die Buhfrau, selbst im Duden. Der Buhmensch steht zwar nicht im Duden, aber auch er kommt dennoch hier und da zum Zuge. Ebenso geht es der Klabauterfrau, sie hat im Gegensatz zum Klabautermann jedoch noch keinen Zugang ins Wörterbuch gefunden.
Jungfernfahrten werden wohl eingestellt und durch so etwas wie Premierenfahrten ersetzt werden müssen. Lausbubenstreiche werden gestrichen. Milchmädchenrechnungen gehen nicht mehr auf, sondern werden storniert. Mädchen und Jungen werden über einen Kamm geschoren und heißen jetzt nur noch Kinder – zum Beispiel in Lauskinderstreichen und Milchkinderrechnungen. Es lebe die Geschlechtergleichstellung in der Sprache, damit sie erstrahle in neuer Herrlichkeit. Mhm, oder in Fraulichkeit oder gar Dämlichkeit? Nein, sie erstrahle in Pracht und Pomp, in Glanz und Gloria. Gloria? Das ist doch ein Frauenname. Also doch lieber in Glanz und Glamour oder so. Wo wir gerade bei Herrlichkeit sind: Was ist mit dem Herrgott? Mannomann...
Und was geschieht mit dem Hanswurst? Heißt seine Sprachgefährtin jetzt etwa Hannawurst? Ganz kompliziert wird es mit denen, die es gleich doppelt trifft. Den Ottonormalverbraucher beispielsweise. Ihm wird die Ottonormalverbraucherin zur Seite gestellt, oder noch konsequenter, die Ottilienormalverbraucherin. Auch das Heinzelmännchen wird sich neu ausrichten müssen. Zuerst beim Heinzel, denn das ist eine Verniedlichungsform von Heinz und Heinz wiederum eine Kurzform von Heinrich, und dann natürlich beim Männchen. Da müsste dann das Henrietteweibchen immer im gleichen Atemzug mitgenannt werden. Oder nehmen wir die Heinzelhenriettegruppe? Ich sollte Schluss machen, bevor er/sie/es noch weiter mit mir durchgeht. – Hendrik Rapsch
Leserbrief zu „Mein Abschied von der Nacht“ von Moritz von Uslar im ZEIT Magazin
Zu Ihrem Artikel des Abschieds von der Nacht kann ich nicht still bleiben. Alles, was Sie über den Beginn von Clubs zusammenfaseln, zeigt wieder einmal mehr, wie oberflächlich die Journaille arbeitet. Oder liegt es in Ihrem Fall daran, dass Sie einfach glauben, der tolle, immerhin inzwischen vom Clubleben zurückgetretene Nachtlebenshecht zu sein? Als recht alter Mensch will ich nun ein wenig in medias res einsteigen: 1962 wurde in Berlin die erste Grossdicothek eröffnet, der Big Apple. Und da war nichts mit Sesselchen und Teppichen! Natürlich hat die Musik noch nicht so stark bassgewummert wie später, (die Technik war noch eine andere) aber es war trotzdem ganz schön der Teufel los.
Hetero- und Homo- friedlich, aber sehr locker vereint. Und getrunken wurde auch, bis morgens um acht, oder länger oder noch länger. Erst später kamen andere Clubs auf, auch das Studio 54 in New York. Und lange vor dem Tresor etc. hat, auch zum Beispiel in Paris schon 1974 und weiter, eine Clubszene die Nächte durchtobt, wovon München und Frankfurt und andere nur träumen konnten. Das Sie der, der Sie sind, nur dem Schmuddelleben in Berliner Kellern zu verdanken haben, ist schon recht armselig. Nebenbei: sind Ihre Ohren noch intakt? Und die Leber? Und weiter unten? Wenn ja, sind Sie nicht oft genug in die Keller abgestiegen. Und jetzt ist es zu spät. Sie Ärmster... – Gerhard Grab
Leserbrief zu „FAST ÜBERHÖRT“ von Nadine Redlich im ZEIT Magazin
Immer ein Ärgernis diese geistlose Rubrik, hat auch was.... – Jörg Machel