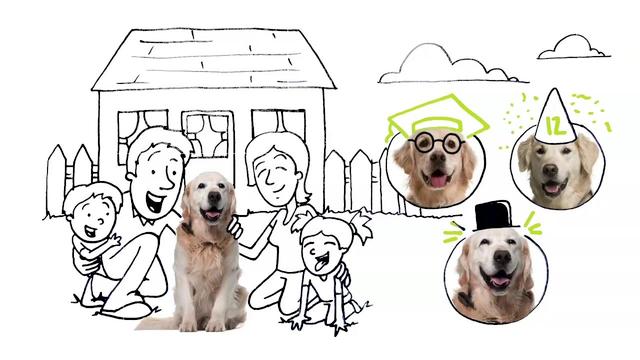Man fühlt sich ein wenig wie ein Sportreporter in den 70er-Jahren, wenn man versucht, Otis Houston Jr. zu interviewen. Ihn zu einer direkten Antwort auf eine Frage zu bewegen, ist vermutlich genauso leicht, wie es einst war, Muhammad Ali dazu zu bringen, eine nüchterne Auskunft über sein Training oder seinen nächsten Gegner zu geben.
Statt gewissenhaft Informationen zu übermitteln, verfällt Houston, der auf der Frieze Art Fair in diesem Frühjahr als eine der großen Neuentdeckungen der New Yorker Kunstszene galt, unweigerlich ins Performative. Die Frage wird Stichwort für ein Gedicht, eine Meditation, einen Rap oder einen Song.
Wenn man etwa wissen möchte, wie Harlem 1969 war, als Otis Houston Jr. als Jugendlicher aus dem Süden ins Mekka des schwarzen Amerika kam, erfährt man von seiner Begegnung mit den Lehren der Nation of Islam, deren Prediger damals die New Yorker 125th Street bevölkerten. Der Gedanke führt zu Houstons Weg in den Vegetarismus und zurück in den tiefen Süden, wo seine Mutter die Familie aus einem Gemüsegarten ernährte, weil man sich Fleisch nicht leisten konnte.
Ähnlich geht es, wenn man ihn auf eines seiner jüngeren Werke anspricht, das jetzt hier an der Wand einer hippen Galerie am Union Square hängt. Es ist ein Handtuch, auf das er mit blauer Farbe "The world catches up with me" gesprüht hat - "Die Welt holt zu mir auf". Die Antwort ist ein melodischer Proto-Rap, der in gleich mehrerer Hinsicht an Ali erinnert. Er erzählt von einem verarmten Boxer in den Straßen von Harlem, der niemals aufhört, an seine Chance zu glauben, an den großen Kampf, der ihn reich und berühmt macht.
Otis Houston Jr. ist der richtige Künstler zum richtigen Moment, meint sein Galerist
Es ist natürlich Houstons eigene Geschichte, die er da durch die Galerie singt, illustriert von einem weiteren Werk. Auf einem weiteren Handtuch steht, gesprüht in schwarzer, roter und grüner Farbe: "I will prepare and some day my chance will come." Dieser Tag, diese Chance ist jetzt da, die Kunstwelt hat von ihm Notiz genommen. Otis Houston Jr. ist der richtige Künstler zum richtigen Moment, da ist sein Galerist Sam Gordon sicher. "Es war ein Geschenk, als mir vor zwei Jahren ein gemeinsamer Bekannter von Otis erzählte", sagt Gordon.
Otis Houston Jr. stand damals, wie schon viele Jahren zuvor, Tag für Tag an einer besonders betriebsamen Kreuzung des Franklin D. Roosevelt East River Drive, jener New Yorker Stadtautobahn entlang des East River, über die Tag für Tag eine Blechlawine in den Geschäftsdistrikt von Manhattan und am Abend wieder hinaus in die Vorstädte rollt.

Man kann das, was Houston da trieb, Situationismus oder Performance Art nennen, obwohl er mit diesen Begriffen ganz sicher nicht viel anzufangen wüsste. Er hängte seine besprühten Handtücher auf, stellte Readymade-Installationen aus Sperrmüll zusammen. Oft saß er dort in seinem Klappstuhl mit einer Wassermelone auf dem Kopf, eine Parodie auf das rassistische Klischee des "Watermelon Man", den es in vielen Schwarzenvierteln der USA gibt und den schon Herbie Hancock im gleichnamigen Lied besang.
Die Pendler kannten Otis, sie hupten ihm zu, sie winkten, sie fotografierten ihn für Instagram. Lange bevor die Kunstwelt ihn entdeckte, war er ein Underground Star, ein Straßenkünstler wie Keith Haring oder Jean-Michel Basquiat. Beinahe könnte man meinen, dass Houston sich die Nähe von nur wenigen Hundert Metern zu Keith Harings "Crack is Wack"-Mural, das dort einen Spielplatz ziert, ausgesucht hätte - doch es ist nicht mehr als ein charmanter Zufall.
Die Ecke am FDR hat ihn gefunden, nicht umgekehrt - und so verhält es sich mit der Kunst selbst
Wie seine berühmt gewordenen Vorgänger, vielleicht gar ein wenig mehr noch, besitzt Houston die auf dem Kunstmarkt so rare und kostbare Qualität der Unverfälschtheit. Eine strategische Positionierung, eine bewusste Bezugnahme auf Zeitgenossen und Wegbereiter wäre Houston fremd. So ist er nicht gestrickt. Die Ecke am FDR Drive, sagt er gerne, hat ihn gefunden, nicht umgekehrt, und ebenso verhält es sich mit der Kunst selbst.
Streng genommen hat die Kunst ihn gefunden, als er wegen eines Drogendelikts im Gefängnis saß, auch wenn Houston sagt, er habe "schon immer Dinge gemacht". Doch bei seinem zweiten Aufenthalt im berüchtigten Sing Sing, ein paar Dutzend Kilometer den Hudson River hinauf, bekam er eine formale Kunstausbildung nebst einem formalen Äquivalent für eine Hochschulzulassung.
Das war vor rund 20 Jahren, und wenn Houston davon erzählt, klingt es wie eine klassische Konversionsgeschichte nach dem Vorbild von Malcolm X etwa, den Houston ohnehin gerne zitiert. Im Gefängnis wurde ihm klar, dass er sein Leben in den Griff bekommen muss, die Drogen und den Alkohol aufgeben, Verantwortung für seine Kinder übernehmen. Und die Kunst war dafür das Vehikel. Seither arbeitete Houston, der einst wie viele junge schwarze Männer aus dem Süden nach Harlem kam, um auf der Straße sein Glück zu machen, als Hausmeister. Und stellte sich, wann immer er konnte, an seine Ecke.
Ein wenig ist das, was Houston da immer noch tut, auch ein Revival jenes Harlems Ende der 60er-Jahre. Harlem war noch lange nicht gentrifiziert, schwarze Kultur entfaltete sich frei, und dazu gehörte vor allem die Straßenkultur. Jede Ecke der 125th Street war gut für eine spontane politische Rede, eine Predigt, einen Tanz, und das Klischee von der Musik, die in Harlem unaufhörlich durch die Straßen wehte, hatte seine Gültigkeit. "Signifying" nannte einst der afroamerikanische Kulturwissenschaftler Henry Louis Gates Jr. diese Tendenz zur Performance in der schwarzen Kultur, auch im täglichen Miteinander. Kunst und Leben verschmolzen in Harlem.
Für all das ist in der Kunstwelt gerade genau der richtige Augenblick. Die Pandemie hat den Betrieb zumindest temporär entglobalisiert. Bei der Frieze und in der New Yorker Galerieszene besinnt man sich in diesem Jahr stark auf das Lokale, auf das Naheliegende. Vor allem ist man jedoch geradezu begierig nach allem, was bislang marginalisiert war. Die wichtigsten Ausstellungen des Frühjahrs in New Yorker Museen waren die Show von Okwui Enwezor über "Grief and Grievance" (Zorn und Trauer) in der schwarzen Kunst im New Museum und die Retrospektive von Alice Neel mit ihren Porträts der einfachen Leute von New York im Metropolitan Museum.
Natürlich ist Otis Houston Jr. aller Frische und Authentizität zum Trotz nicht naiv, sondern weiß genau, was es bedeuten kann, nun vom Kunstbetrieb aufgesogen zu werden. In einem seiner neueren Werke hat er auf eine ausgehängte Tür die Worte gesprüht: "We are the canvas. Abstract. Original. Breathtaking ... You see us, Admire us and when you reach out to us, we are gone."
Nicht zuletzt deshalb wird Houston die Ecke am FDR wohl niemals aufgeben. Sie ist vom Kunstbetrieb unberührbar. Sein Lohn dort ist eine kurze Interaktion mit einem Passanten, ein Lachen, ein Wort, ein Winken, ein Hupen. Mehr wollte er nicht, als er sich vor 20 Jahren dort hinstellte. Und mehr braucht er auch heute nicht.