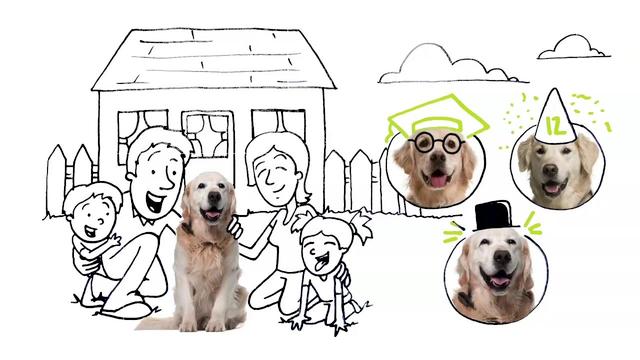Gewürznelken
:
D
ie Blütenknospen eines bis zu 10 Meter hohen Baumes, der ursprünglich nur auf den Molukkeninseln
wuchs
, die zu Indonesien gehören und früher „Gewürzinseln“ hießen, dazu gehörte u.a. die kleine Insel Ternate (*).
Im Zuge der kolonialen Eroberungen
geriet
der Archipel zunächst
in
den
Besitz der
Portugiesen. Die Gewürznelken waren in Europa bald so begehrt bei den Reichen und Mächtigen, dass sie wertvoller als Gold wurden. Die Niederländer vertrieben
schließlich
die Portugiesen und monopolisierten die
Produktion von
Gewürznelken, die sie von der Molukkeninsel Ambon
aus
verschifften. Auf den Diebstahl von Samen d
e
s Gewürznelkenbaumes stand die Todesstrafe. Als die Engländer dort 1623 eindrangen, kam es zu einem „Ambon-Massaker“. Die Engländer wurden vertrieben.
1796 waren sie erfolgreicher
, aber den Niederländern gelang es, Ambon zurück zu erobern. 1942
nahmen
die Japaner in
d
er „Ambon-Schlacht“ die Insel
ein
. Sie wurden
dann
von den
Engländern
vertrieben. 1945 erklärte sich Indonesien für unabhängig und nahm die Molukken in Besitz, viele Ambonesen flüchteten nach Holland, wo sie immer wieder militant auf ihre prekäre Flüchtlingssituation aufmerksam machten, 1978 mit einer Geiselnahme.
.
.
Als Sukarno 1945 Präsident wurde, versuchten die Niederländer erneut Indonesien zu kolonisieren, was bis 1949 in einen Guerillakrieg mit 300.000 Toten gipfelte. Nachdem die Niederländer sich
aus Indonesien
zurückgezogen hatten, entwickelte sich aus der Guerilla die KPI – die drittstärkste kommunistische Partei der Welt. Dagegen entwarf die CIA Putschpläne, wobei sie auf Offiziere um
den
General Suharto setzte. 1965 entwickelte sich daraus ein Bürgerkrieg, der ihn im Jahr darauf an die Macht brachte. Bei den von ihm
angeordneten
Säuberungen sollen
mit CIA-Hilfe
drei Millionen Kommunisten ermordet worden sein, daneben auch viele Chinesen
als Sündenböcke
. England und die USA begrüßten das indonesische Massaker.
Heute ist Indonesien das größte islamische Land.
Der Suharto-Clan riß das ehemalige niederländische Gewürznelkenmonopol an sich, d.h. die Plantagen auf
den
Molukkeninseln. Die Gewürznelken w
u
rden
aber
weiterhin
zu großen Teilen in Amsterdam und Rotterdam umgeschlagen.
.
.
Wie die 2016 der Süddeutschen Zeitungen zugespielten „
Paradise Papers“, vertrauliche Unterlagen der Anwaltskanzlei Appleby auf der Isle of Man,
ergaben
(
die Briefkastenfirmen
u.a. von Madonna und Königin Elisabeth
verwaltet
)
, beläuft sich das von Suharto beiseite geschaffte Vermögen auf 35 Milliarden Dollar. Seine Kinder haben Anteile an 564 indonesische Firmen, sein Sohn Tommy ist Großaktionär bei Lamborghini, zusammen mit seinem Bruder Bambang besitzt er zwei Ölfirmen, seine Schwester Tutut ist im Zuckerhandel aktiv. Ihr Vater war bereits in den Fünfzigerjahren mit Zuckerschmuggel auf Java reich geworden.
Die
Weltbank
bezeichnete
Suharto
als
das „korrupteste Staatsoberhaupt der Welt“.
Im Bürgerkrieg 1998, der erneut vielen Chinesen das Leben kostete, trat er zurück. Große Teile der Wirtschaft brachen zusammen. In Indonesien raucht man Zigaretten (Kretek), die mit Gewürznelken aromatisiert sind; um in der Krise Arbeitsplätze zu schaffen, wurden die Maschinen in den Kretek-Fabriken stillgelegt und Mädchen eingestellt, die die Zigaretten mit der Hand drehten. 1999 gelang es Dschihadisten auf der christlichen Molukkeninsel Ambon, einen Bürgerkrieg zu entfesseln.
.
Gewürz-Karawane
.
Es gibt einige Leute, die für den Glühwein statt Gewürznelken Piment verwenden. „Piment sieht beinahe aus wie Pfeffer und schmeckt ähnlich scharf: Kein Wunder, dass Christopher Kolumbus und seine Männer die braunen Körner zuerst für wertvollen Pfeffer hielten! Daher tauften die spanischen Eroberer das Gewürz auch „pimienta“ (Pfeffer). Kaum hatten sie jedoch ihren Irrtum bemerkt und echten Pfeffer gefunden, spielte Piment keine Rolle mehr für sie. Erst mehr als 200 Jahre später gelangten die Körner dann doch noch nach Europa. Heute genießt Piment große Beliebtheit in den Küchen der Welt. Da er hauptsächlich auf der Insel Jamaika angebaut wird, trägt er auch den Namen Jamaikapfeffer. Aufgrund seiner aromatischen Ähnlichkeit mit Gewürznelkenwird er außerdem als Nelkenpfeffer bezeichnet,“ heißt es auf „zauberdergewuerze.de“
.
Muskatnuß
:
Der 5-18 Meter hoch werdende Muskatnußbaum ist ebenfalls auf den Molukken beheimatet. Als Gewürz und Droge
dient
sein Samen und der Samenmantel.
Als die Muskatnuß im 16. Jahrhundert im Ruf stand, gegen die Pest zu helfen, stieg ihr Preis ins Unermeßliche, sie wurde als „Gold Ostindiens“ bezeichnet.
Nachdem die Niederländer die Portugiesen vertrieben hatten, rotteten sie die einheimische Bevölkerung,
15.000 Menschen,
auf den zu den Molukken gehörenden Banda-Inseln aus und ersetzten sie durch Sklaven aus anderen Gebieten, die auf den Muskatnuß-Plantagen arbeiten mußten. Gepflanzt wurden vor allem weibliche Bäume.
1667 tauschten die Niederländer Manhattan gegen die winzige Muskatnuß-Insel Run. 1735 verbrannten sie 570 Tonnen Muskatnüsse, um den Preis in die Höhe zu treiben.
150 Jahre konnten
sie
ihr Muskatnuß-Monopol aufrecht erhalten, dazu hatten sie auf allen Inseln die Muskatnußbäume gefällt, bis auf zwei
Inseln
, die si
ch
leicht bewachen
ließen
. Auf Samendiebstahl stand die Todesstrafe.
.
.
Dem französischen Intendanten der
zwei Inseln
Ile de France (Mauritius) und La
Réunion, Pierre Poivre, ein Botaniker,
der in einem englischen Seegefecht einen Arm verloren hatte,
gelang es,
das holländische Gewürzmonopol
zu brechen, indem er
Samen der
Muskatnuß- und der Gewürznelken-
Bäume stahl und nach Mauritius schmuggelte, wo er sie
im
„Jardin d
e
Pamplemousses“ in die Erde brachte.
25 Jahre und zig Expeditionen,
finanziert von
der französischen Ostindienkompanie, brauchte es, bis
er
die ersten Nüsse von tausenden zum Keimen brachte, und noch
ein
mal sieben Jahre, bis 1778 die ersten Muskatbäume Nüsse trugen.
Sie
wurden
,
ebenso
die Gewürznelkenbäume, in Plantag
en angebaut
.
Poivre
stieg
da
mit
zur „Kernfigur des Gewürzhandels“ auf, wie der Botaniker Marc Jeanson und die
Autorin
Cha
r
lotte Fauve in ihrem Buch „Das Gedächtnis der Welt“ (2020) schreiben.
.
.
Aber die Konkurrenz nahm
immer mehr
zu:
In der Zwischenzeit hatten die Engländer die Molukken erobert und Muskatnußbaum-Plantagen
in Singapur, Ceylon, Sumatra, Penang und auf den westindischen Inseln angelegt.
A
uf Grenada entwickelte sich die Muskatnuß zum Hauptexportprodukt –
bis heute
. Nachdem eine sozialistische Regierung
1979
ein kostenloses Gesundheitssystem
und
basisdemokratische Verfahren
eingeführt
sowie
Schulen gebaut hatte, wurde sie 1983
durch
eine US-Militärinvasion gestürzt.
Inzwischen gibt es auch Muskatnußbaum-Plantagen in Afrika und in anderen Teilen Südamerikas.
.
.
Heute produziert Guatemala von allen Ländern am meisten Muskatnüsse: 38.163 Tonnen jährlich.
Dieses kleine mittelamerikanische Land wurde lange Zeit von der amerikanischen „United Fruit Company“ beherrscht.
Nachdem der demokratisch gewählte Präsident Guzman soziale Reformen durchgesetzt hatte, initiierte
das US-amerikanische Außenministerium laut Wikipedia eine Kampagne gegen
ihnGewürz-Karawane
. Die CIA intervenierte daraufhin in Zusammenarbeit mit oppositionellen guatemaltekischen Militärs. 1954 wurde
der
Präsident auf Betreiben der USA gestürzt und durch einen Diktator ersetzt. Innerhalb kürzester Zeit machte dieser sämtliche soziale Reformen einschließlich der begonnenen Agrarreform rückgängig.
Die linke Regierung
hatte
damals
begonnen
, die Ländereien an die Indianer zu verteilen, die heute zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen. Rund 500.000 von ihnen verdingen sich als Saisonarbeiter auf den Fincas.
D
ie Großgrundbesitzer, die zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen,
besitzen
60 Prozent des Boden
s
. Die Besitzer der Fincas sind zumeist Deutsche, das Land gehörte seit Beginn des Jahrhunderts Firmen wie der Hanseatischen Plantagen-Gesellschaft. Die Deutschen bekamen es von der Regierung geschenkt, sie mußten nur für die Vermessung zahlen. 1933 wurde die Zwangsarbeit eingeführt – auf Grundlage eines „Gesetzes gegen Vagabundentum“, das man sich aus den Sklavengesetzen von Deutsch-Südwestafrika quasi übersetzte. 1934 motorisierte Mercedes-Benz die guatemaltekische Polizei.
.
.
In Guatemala herrschte ab 1960 ein
Bürgerkrieg
, der erst 1996 durch die Unterzeichnung eines Friedensvertrages formell für beendet erklärt wurde.
Rechte
Todesschwadrone
ermordeten
allein zwischen 1978 und 1982 über 5.000 Oppositionelle. Der Krieg
kostete
bis
1996
mehr als 2
5
0.000 Menschen,
mehrheitlich Indigene,
das Leben.
.
.
Die
Westberliner Dokumentarfilmer
Thomas Walter und Uli Stelzner drehten
erst
einen Film über Landlose
in Guatemala
, die vor der Repression nach Mexiko geflüchtet waren, dann einen über Landbesetzungen. Ihr
dritter
Film
befaßte sich
1998 mit der
deutsche
n
Kolonie –
den „Zivilisationsbringern“
. Zumeist
sind es
alte Finca- Besitzer,
Kaffeeanbauer,
und deren kaufmännisch tätige Nachkommen sowie westdeutsche Konzernrepräsentanten, die man allesamt getrost als „rechtsnational“ bezeichnen darf: „Das wird man hier draußen!“ Ein deutscher Textilunternehmer
meint
: „Die Menschenrechte und alle möglichen Vergünstigungen – das kann man nicht von heute auf morgen einführen!“
Guatemala hat die höchste Analphabetenquote in Lateinamerika. Eine einst pädagogisch-engagierte Finca-Erbin erinnert sich: „Meine Schwägerin hat immer gesagt: ,Paß auf, die Indianer sind falsch.‘ Ich muß leider sagen: Sie hat recht!“ Eine Lehrerin an der deutschen Schule meint noch heute: „Dieses Land würde nur besser werden, wenn es eine Diktatur auf rechter Seite wäre.“ Eine Finca- Besitzerin erzählt
freimütig
: „Die Arbeiter hatten die Angewohnheit, sich nachts in ihren Unterkünften zu unterhalten. Das hat mich gestört – und da wurde das abgestellt.“
Neben den Deutschen machen sich heute vermehrt auch koreanische Textilunternehmer in Guatemala unbeliebt. Und nicht zu vergessen die Amerikaner: Sämtliche Erdölvorkommen Guatemalas werden von ihnen ausgebeutet und exportiert, um anschließend das Öl, als Kraftstoff, wieder zu reimportieren – diese schöne „Veredelung“, gleichzeitig eine „Verelendung“, schlägt sich mit drei Prozent in der Ausfuhr- und mit elf Prozent in der Einfuhrstatistik nieder.
.
Vanille
Vanille verfeinert nicht nur alle möglichen Speisen, vor allem Süßspeisen,
sondern wirkt auch „entzündungshemmend, antimikrobiell und fungizid und kann beispielsweise bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis lindernd wirken und ist damit eine Wohltat für die Gesundheit. Auch wirkt sie beruhigend und wurde früher gegen Schlafstörungen verordnet,“ heißt es auf Wikipedia.
.
Vanille-Ernte
.
Das Gewürz besteht aus den Schoten einer Pflanze der Orchideen-Gattung Vanilla, kommerziell angebaut wird von 15 Arten vor allem die Gewürzvanille, auch „Bourbon-Vanille“ genannt. Sie stammt ursprünglich aus Mexiko und Mittelamerika.
Auf die Ausfuhr der Pflanze aus Mexiko verfügten die spanischen Kolonialherren die Todesstrafe.
.
.
Nachdem
das Land
sich 1810 die Unabhängigkeit erkämpft hatte, gelangten Stecklinge in die Botanischen Gärten von Antwerpen und Paris. 1819 kultivierten die Niederländer sie in ihrer indonesischen Kolonie, 1822 brachte
Pierre
Poivre sie auf die Insel La Réunion. Dort sowie
auch
auf Madagaskar und in Indonesien
wird sie heute
in Plantagen angebaut.
D
aneben gibt es noch die „Tahiti-Vanille“ für gehobene G
a
stronomie.
Die Vanille ist übrigens die einzige Orchideenart, die ein für Menschen nützliches Produkt liefert, sonst sind Orchideen nur wegen ihrer Schönheit begehrt, außerdem sind es sehr interessante Pflanzen. (**)
.
Vanille-Ernte
.
Z
imt:
Das Gewürz besteht aus der Rinde des Ceylon-Zimtbaums. Im 13. und 14. Jahrhundert dominierte Venedig den Zimthandel, dann Portugal und nach einem Krieg die Niederländer,
infolge
de
s
englisch-niederländischen Seekrieg
s
schließlich
die Engländer. Ab dem 18. Jahrhundert war London der Hauptumschlagplatz für Zimt.
Der Anbau weitete sich unterdes aus – nach China, Vietnam und Indonesien. Auf indonesischen Inseln wird heute die größte Menge Zimt produziert: 2018 waren es 221.815 Tonnen.
Oft wird Zimt vor der Verwendung schon mit Zucker vermischt – um z.B. auf Pfannkuchen, Kartoffelpuffer und Milchreis gestreut zu werden. Viele geben auch dem Kaffee Zimt (und Kardamon) zu.
.
Zimtbaum
.
Zimternte
.
Zimt trocknen
.
K
ardamon
:
Der 2-5 Meter hohe Strauch gehört zur Familie der Ingwergewächse, genutzt wird sein Samen, der ein wichtiges Gewürz in der asiatischen und arabischen Küche ist, er wird daneben auch als Droge genutzt. Ursprünglich stammt die Pflanze aus
S
üdwest-Indien,
aus dem
heutigen
Bundesstaat Kerala, was „Land der Kokospalmen“ heißt. 1498 landete der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama dort in Calicut. Als er versuchte, das Gewürzmonopol der in Calicut ansässigen Araber
zu durchbrechen
, verwehrte ihm der dortige Herrscher die erhofften Handelsprivilegien. Da Gama wandte sich daraufhin laut Wikipedia an den Herrscher von Cochin, schloss mit ihm ein Bündnis und ließ 1503 in Cochin das erste europäische Fort auf indischem Boden errichten. Auf diese Art und Weise wurden Cochin und Calicut in den bald darauf ausbrechenden Krieg zwischen Portugiesen und Arabern verwickelt. Unter Ausnutzung der Feindschaft zwischen den beiden Königreichen gelang es Portugal, das Gewürzmonopol der Araber zu brechen.
.
Kardamonernte in Kerala
.
Ab 1603 intrigierte die Niederländische Ostindien-Kompanie erfolgreich gegen die Portugiesen in Calicut und Cochin. Bis 1662 hatten sie diese aus Kerala vertrieben.
Danach geriet
Calicut zunehmend unter
d
en Einfluss
der Engländer
und wurde 1664, nach dem Ausscheiden Portugals als Kolonialmacht in Kerala, englisch. Zunächst war die Konkurrenz durch die Niederländer
noch
groß, doch mit dem Ende des holländischen Einflusses durch die Invasionen
des benachbarten Fürstenstaates
Mysores konnten sich die Briten auch in Kerala als führende europäische Macht etablieren.
Ab
1800 war
ihre
Kolonialherrschaft
dort
endgültig gesichert.
Erst ab den 1920er Jahren kam es im Rahmen der indischen Unabhängigkeitsbewegung wieder zu nennenswertem Widerstand.
Wikipedia erwähnt den Moplah-Aufstand
1921 und die Punnapra-Vayalar-Revolte 1946.
Im Jahr darauf wurde Indien unabhängig, bei den ersten freien Wahlen in Kerala ging die Communist Party of India (CPI) als Sieger hervor, mit der Folge, dass Kerale
heute
die höchste Alphabetisierungsrate hat, die Frauen die wenigsten
unerwünschten
Kinder bekommen
und die in Indien regierende Partei der Hindufaschisten
(BJP), die das Land „amerikanisieren“ will, in Kerala keine große Rolle
spielt
.
Bei den letzten Wahlen kam es
allerdings
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen BJP und Kommunisten bzw. deren Unterorganisationen, die etliche Todesopfer forderten.
.
.
Der
amerikanische
Umweltaktivist
Bill Mc Kibben
bezeichnete das Modell Kerala bereits 1999 als „bizarre Anomalie unter den Entwicklungsländern“, die „wirkliche Hoffnung für die Entwicklung der Dritten Welt“ biete. Soziale Indikatoren wie Säuglingssterblichkeit, Geburtenrate und Lebenserwartung wären fast schon auf dem Niveau der „Ersten Welt“, trotz eines vielfach geringeren Pro-Kopf-Einkommens. Laut einer Erhebung von „
Transpar
e
ncy International“ 2005 in
Indien ist Kerala der
bei weitem
am wenigsten korrupte Bundesstaat Indiens.
Am Rand von Kerala liegen die Kardamonberge, die nach den dortigen Kardamonplantagen benannt wurden. In einem Reisebericht heißt es: „
Wer Gewürze nur aus dem Gewürzspender kennt, kommt hier nicht mehr aus dem Staunen heraus. Besonders beeindruckend fanden wir die Kardamonplantagen. Riesenhafte, saftig grüne Blätter mit kleinen Kardamonkapseln, die dick wuchernd bis auf die Straße wachsen. Wir ließen uns die Gelegenheit, unterwegs in einer Gewürzplantage Halt zu machen und ‚original‘ von dort stammende Gewürze zu kaufen, nicht entgehen. Zumal die Kinder, Eltern und Freunde uns auf den Weg mitgaben: ‚Bringt Gewürze mit!‘“
.
.
H
eute wird
Kardamon
auch
in Guatemala, Tansania, Madagaskar, Vietnam und Papua-Neuguinea angebaut.
In all diesen Ländern haben die zivilisierten Europäer zeitweilig alles an sich gerissen und Millionen Einheimische
versklavt bzw. vertrieben oder
ermordet.
.
Zwei Health-Officer aus Papua-Neuguinea mit mir in der Mitte, ihr Land war eine britische Kolonie, die jedoch von Australien verwaltet wurde, dem nach der Unabhängigkeit die Bergbauunternehmen und Plantagen weiterhin gehörten und gehören. Noch heute, sagten mir die beiden Health-Officer, würden sie sie Straßenseite wechseln, wenn ihnen ein Australier engegenkomme.
.
In Vietnam kämpfte die Bevölkerung
nach dem Zweiten Weltkrieg
erst gegen die französische Kolonialherrschaft,
die 1858 begann,
und dann von 1964 bis 1973 gegen die Amerikaner, wobei fast zwei Millionen Vietnamesen getötet wurden. (***)
.
Kardamon-Pflanze
.
Sternanis
:
Beim „Echten Sternanis“ handelt es sich um die reifen Früchte eines bis zu 20 Meter hohen immergrünen Magnolienbaumes, der im autonomen chinesischen Gebiet Guangxi und im Norden Vietnams wächst. Die sternförmigen Früchte werden als Gewürz und Heilpflanze genutzt. Zusammen mit Fenchel, Cassiazimt, Gewürznelke und Szechuan-Pfeffer wird der Echte Sternanis in der chinesischen Küche als „Fünf-Gewürze-Pulver“ verwendet. Der Sternanis hat la
u

t Wikipedia Schleimlösende, Auswurf fördernde und leicht krampflösende Eigenschaften. Als Öl ist er deswegen in vielen Hustenmitteln enthalten.
Er wird außerdem
in der „Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen“ des Ethnopharm
a
kologen Christian Rätsch
erwähnt
.
Der Echte Sternanis ist nahe verwandt mit dem Japanischen Sternanis, aber dieser ist giftig und wird in Japan als Räucherwerk verbrannt.
.
Guangxi- Sternanis
.
Der Chinareisende Marco Polo brachte den Echten Sternanis 1275 nach Europa, aber es dauerte 300 Jahre bis er
wirklich
bekannt wurde, wofür
sich vor allem
der
Engländer Thomas Cavendish
engagierte
. In Deutschland
kennt man
den Sternanis
erst seit Ende des 18. Jahrhunderts. Hier wird er für Weihnachtsgebäck, Puddi
n
ge, Konfit
ü
ren, Grog und Glühwein verwendet. Außerdem kann man ihn als Zimmerpflanze kaufen, aber
sie
braucht 15 Jahre, bis
sie
das erste Mal Früchte trägt.
.
Sternanis-Ernte
.
Zucker
:
Der Rohrzucker aus den Tropen war einst ein „Gewürz“, das sich nur Reiche leisten konnte, die Armen mußten mit Honig vorlieb nehmen. Heute ist es umgekehrt. Das verdanken die Armen Europas jedoch nicht nur der Ausweitung der
Zuckerrohr-
Plantagen in den ehemaligen Kolonien als vielmehr der
Hochz
üchtung der
europäischen
Zuckerrübe (in den USA gibt es inzwischen auch eine transgene Zuckerrübe: „H7-1“).
Umgekehrt hat sich dabei auch das durch Zuckerkonsum bewirkte Übergewicht bei vielen Menschen, vor allem bei den Amerikanern, entwickelt: Früher neigten die Reichen zur Fettleibigkeit, heute sind die Armen die „dicksten Menschen der Welt“, wie James Walvin in seinem „Zucker“-Buch schreibt (siehe unten); darin heißt es an anderer Stelle: „Herrscher, Adlige, Geistliche, nutzten den Zucker nicht nur zum Süßen der Speisen, sondern ließen auch „Prestigeobjekte in Form von kunstvollen, aus Zucker gefertigten Objekten und Statuetten“ in Auftrag geben. Davon übrig geblieben sind heute die mehrstöckigen Hochzeitstorten. „Als Zucker gegen Ende des 16. Jahrhunderts weitere Verbreitung fand und billiger wurde (angebaut von Sklaven auf dem amerikanischen Kontinent), verloren kunstvolle Zuckerskulpturen ihre Strahlkraft.“ Das gilt wohl auch für die mehrstöckigen Hochzeitstorten, die gar nicht mehr gegessen, nur noch fotografiert werden. Zumal die Rolle des Zuckers bei der Fettleibigkeit heute „vielfach mit den Auswirkungen von Tabak verglichen“ und bekämpft wird. Es geht aber auch so: 2009 bekam das New Yorker „Yankee-Stadion“ breitere Sitzplätze, weil die Baseballfans zu dick geworden waren, dafür hat das Stadion nun 4000 Plätze weniger.
Der Zuckerexperte Walvin scheint in politischer Hinsicht auf diesen Rohstoff davon überzeugt zu sein, dass die USA in ihrem „Hinterhof“ (Mittel- und Lateinamerika) überall korrupte Diktatoren bzw. Militärregime installierte, nur damit ihnen nicht der Zucker ausgeht – als ein wichtiger Bestandteil in ihren Softdrinks, im Kaffee und im Gebäck, aber auch in vielen anderen Lebensmitteln. „1776, am Vorabend des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs belief sich die Menge Zucker, die von den Amerikanern importiert wurde, auf 200.000 Tonnen, 90 Prozent davon aus der Karibik.“ Man erinnert sich: dieser Krieg begann dann damit, dass die Bostoner 342 Kisten Tee, der für England bestimmt war, in den Hafen warfen. Die „Bostoner Tea-Party“. Vielleicht rührt daher noch eine gewisse Abneigung gegenüber Tee und die Bevorzugung des Kaffees in den USA. Inzwischen zählen laut Walvin die Australier mit fast 50 Kilogramm pro Kopf und Jahr zu den größten Zuckerkonsumenten weltweit.
In England, das vom Kaffee zum Tee (mit Gebäck) wechselte, besaß man dafür die Kolonien. Rund um die Nordsee bevorzugt man heute Tee, während die Ostseeländer Kaffee trinken. Für beide Getränke braucht man Zucker. Kleinkinder bekommen ein Kakaogetränk. „Allesamt werden sie in ihren ursprünglichen Anbaugebieten als bittere Getränke konsumiert – beim Tee sind es China und Japan, beim Kaffee das Horn von Afrika und bei der Schokolade Mexiko.“
Und alle vier Genußmittel (ebenso Tabak und das Nebenprodukt aus Zucker: Rum) kommen aus den Tropen, wo die Weißen „zuerst die indigenen Völker vertrieben, damit das Land von Europäern besiedelt und kultiviert werden konnte; anschließend wurden Arbeitskräfte aus anderen Ländern herbeigeschafft, um das Land profitabel zu nutzen. Indios wurden von ihrem Land gejagt und durch Afrikaner ersetzt...Zucker war gleichbedeutend mit Sklaverei geworden...In den 1790er-Jahren wurden jährlich 80.000 Sklaven über den Atlantik transportiert. Der Tee wurde 15.000 Kilometer mit dem Schiff herangeschafft und der Zucker 6.000 Kilometer (hinzu kamen noch die Porzellantassen aus China). In Europa saßen die Männer im Kaffeehaus, rauchten Tabak und besprachen ihre Geschäfte. War es nicht merkwürdig, dass sie gerade Waren von so weit her bevorzugten, „ohne die ihre Vorfahren gut zurecht gekommen waren und die sie nicht einmal gekannt hatten?“
Die profitabelste Zuckerkolonie, d.h. der größte Zuckerproduzent weltweit, war das zu Frankreich gehörende Haiti, heute mit das weltweit ärmste Land mit der höchsten Analphabetenquote, wo heute 80 Pr0zent Schwarze (deren Vorfahren als Sklaven aus Afrika gekommen waren), 5 Prozent Weiße und dazwischen „Personen mit schwarzen und weißen Vorfahren“ leben. Diese nehmen laut dem Wikipedia-Eintrag „Haiti“ in der Wirtschaft des Landes „eine dominante Rolle ein“. Weil sie sich nichtr selten zum Katholizismus und zum Voodoo-Kult gleichzeitig bekennen, wurden sie von Haitis Herrschern immer wieder verfolgt.
Die Karibikhistoriker Peter Linebaugh und Marcus Rediker beschreiben in ihrem Buch über „Die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks: Die vielköpfige Hydra“ (2008) den anfänglichen Widerstand von Afrikanern, Seeleuten und weißen Deportierten gegen diesen menschenfressenden Handelsverkehr. „Doch wer dachte auch nur eine Sekunde daran oder hörte im Geiste das Geräusch der Peitsche, wenn er in London oder Paris Zucker in eine Tasse Tee oder Kaffee löffelte?“ heißt es bei James Walvin. Erst infolge der Amerikanischen und der Französischen Revolution entwickelte sich eine politische und moralische Debatte über die Sklaverei, die schließlich durch die nicht viel weniger ausbeuterische „Vertragsknechtschaft“ ersetzt wurde.
Auf Mauritius, das ab 1810 britisch war, ersetzten 455.187 Inder die ehemaligen Sklaven in den Plantagen. Den Anfang vom Ende der Sklaverei und des Plantagen-Kolonialismus machte der Sklavenaufstand auf Haiti 1791, bei dem Hunderte von Zucker- und Kaffeeplantagen zerstört wurden. Infolge der siegreichen Revolution auf Haiti begann der Zuckerrohranbau auf Kuba und Louisiana und später in Florida. Die amerikanischen „Zuckerpflanzer konnten ihre Sklaven bei der Beantragung von Krediten als Sicherheit einsetzen...1850 arbeiteten 125.000 Sklaven auf den Zuckerrohrfeldern Louisianas.“In einem Film, den die Zuckerbarone drehen ließen, hieß er: „Einen Westinder dabei zu beobachten, wie er ein Zuckermesser schwingt, bedeutet, einer jahrhundertealten Kunst zuzuschauen.“ Witzigerweise hat die FAZ fast 100 Jahre später in einer Reportage über das Opelwerk in Eisenach fast die selben kunstkritischen Worte für die dortige Arbeit am Fließband gefunden.
Auf Kuba investierten die USA Zigmillionen Dollar und schafften per Schiff Sklaven herbei, gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Kuba der bedeutendste Zuckerproduzent. „1958 ließ Fidel Castro alle Zuckergüter, die größer als 400 Hektar waren, verstaatlichen und verbot Ausländern, auf Kuba Land zu besitzen.“
Bereits Ende des 19.Jahrhunderts begann man in den USA „mit der Herstellung eines Süßmittels aus Mais“ zu experimentieren, doch erst „im Jahr 1957 entwickelten Forscher ein Verfahren zur Produktion eines fruktosereichen Kornsirups, der HFCS (high-fructose corn syrup) genannt wurde. 1980 wechselte die Coca-Cola Company von Rohrzucker zu HFCS. Der Maisanbau wurde staatlich subventioniert: allein 5,7 Milliarden Dollar im Jahr 1983 laut James Walvin. Jetzt wird Coca-Cola jedoch mit etwas beworben, was nicht drinne ist: „Zero Sugar“.
Ich arbeitete 1975 kurz in einer Spedition in Bremen. Dort mußten wir tausende Kartons mit Schokoriegeln öffnen, damit der Mann der Weltfirma „Controlco“ den Inhalt prüfen konnte, anschließend luden wir die Kartons auf LKWs, die sie nach London brachten. Eine englische Firma hatte diese neuen Schokoriegel entwickelt und in Europa vertrieben. Aber der Verkauf ließ zu wünschen übrig, so dass die Firma schließlich alle ihre Schokoriegel in Europa zurückrufen ließ, um in England die Zuckersteuer zurück zu bekommen. „Die Zerstörungsmacht des Zuckers“ reicht tief, schreibt James Walvin, in meinem Fall, dass ich mir bei der Arbeit im Lager den Fuß brach.
Zurück zu Zuckerrüben- und Zuckerrohr:
Die Zuckerrübe
gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse und ist eine Kulturform der hiesigen gemeinen Rübe. Der Zuckerrohr gehört zur Familie der Süßgräser und stammt aus Ostasien.
2018 wurden weltweit 275 Millionen Tonnen Zuckerrüben geerntet, die Hauptanbauländer sind Russland, Frankreich und USA. An Zuckerrohr wurden 2018 1,907 Milliarden Tonnen geerntet, die Hauptanbauländer sind Brasilien, Indien,
Thailand
und China.
.
.
Zunächst
gelangte
der Rohrzucker
als Luxusgut nach Indien und Persien und dann auf die westindischen Inseln. Ab 1500 wurde
der Rohrzucker
in Plantagen angebaut. Die erste Rübenzuckerfabrik entstand 1801. Der Rübenanbau war und ist in Europa wichtig für den Fruchtwechsel,
ihre Abnehmer, die Zuckerfabriken, garantierten Festpreise, und die
Bauern bes
aßen Anbauquoten, die
sie kaufen und verkaufen konn
t
en
.
.
.
.
Im 15. Jahrhundert transferierten die
Spanier und Portugiesen den Zuckerrohranbau aus dem Mittelmeerraum in ihre amerikanischen Kolonien. Dazu führten sie gleichzeitig Afrikaner als Sklaven
für
ihre Plantagen ein. Im spanisch-amerikanische Krieg 1898 wurde Kuba amerikanisch dominiert. Nach der Vertreibung
des Diktators
und
der
Enteignung der Amerikaner auf Kuba machten die Sozialisten aus Plantagensklaven proletarische Zukerrohrernte-Brigaden. Den Zucker exportierten sie zu Festpreisen u.a. in die UDSSR – im Tausch gegen Benzin, Maschinen etc..Die CIA versuchte immer wieder gegen die kubanischen Sozialisten zu putschen.
Die US-Regierung verschärfte unterdes laufend ihre Embargos geg
e
n Kuba.
(****) Noch heute ist der Zucker ein wichtiges Exportprodukt Kubas. Der Anbau dort begann 1791 nach dem Sklavenaufstand auf Haiti – als 30.000 französische Pflanzer nach Kuba flüchteten. 1850 gab es dort bereits 14.000 Zuckerrohrplantagen, Kuba wurde damit zum größten Zuckerproduzenten der Welt.
.
.
1970 erreichten die Kubaner mit einer 8,5 Millionen Tonnen Ernte das beste Ergebnis in der Geschichte. Nach Auflösung der UDSSR waren es nur noch 3,5 Millionen Tonnen. 2003 wurde die Hälfte aller Zuckermühlen geschlossen.
Nun will man den Zuckerrohranbau allerdings wieder ausweiten.
In der Stadt Trinidad hatten einst die „Zuckerbarone“ ihre Residenzen gebaut. 1988 wurde der Ort von der Unesco zum „Weltkulturerbe“ erklärt, eigentlich hätte man ihn zum „Weltunkulturerbe“ erklären müssen. Die Paläste werden heute großteils als Museen genutzt.
.
.
Der Journalist
Bartholomäus Grill hat sich 2005 für „Die Zeit“ bei den europäischen, afrikanischen und brasilianischen Zuckerrüben-
und
. Zuckerrohr-Anbauern umgesehen. Auf den guten Böden bei Hildesheim „stehen die Rübenburge
n
. Mächtige, backsteinerne Bauernhäuser sind das, so groß wie kleine Schlösser.“ Der Rübenbauer, den er besuchte hat einen sechsreihigen Rübenroder und erntet in der Stunde 50 bis 80 Tonnen.
.
Zuckerrohrernte auf Kuba
.
2017 schaffte die Deregulierungsbehörde EU die „Zuckerquote“ ab, was für die Rübenbauern das Ende bedeuten könnte, denn der Zuckerrohr in den Tropen wird so billig produziert, dass sie nicht mithalten können: „Der Garantiepreis für Zucker soll um 40 Prozent sinken. Zwar hat die EU angekündigt, den Bauern bis zu 60 Prozent
des Einkommensverlustes zu ersetzen. Aber in vielen Fällen wird das nich
t
reichen.“
.
.
In Mosambik besuchte der „Zeit“-Autor einen Kleinbauern, der mit seinen Zuckerrohrfeld etwa zwei Dollar am Tag verdient. „Das ist nicht schlecht in einem Land“, dass „die Versklavung durch die portugiesischen Kolonialherren“, die Schrecken des blutigen Unabhängigkeitskrieges zwischen 1977 und 1992 sowie „die Misswirtschaft unter der kommunistischen Regierung“ bis 1990 überstanden hat. Aber die Herstellung von einer Tonne Zucker kostet in Afrika 250 Dollar (in Europa sogar 480 Dollar), und in Brasilien nur 160 Dollar. „Dagegen haben die Mosambikaner keine Chance“. Ebensowenig die europäischen Zuckerrübenanbauer. James Walvin hält die europäische Zuckerrübenproduktion sogar für eine zu vernachlässigende Größe bei der weltweiten Produktion von Zucker (aus Zuckerrohr).
.
.
In Brasilien besuchte der „Zeit“-Autor einen „Zuckerbaron“, der 2600 Arbeiter und Angestellte beschäftigt. Auch er setzt auf vollautomatische Roder, aber nur zum Teil. Eine solche Maschin
e
ersetzt 80 Zuckerrohrschneider,
diese
verdienen etwa 12 Dollar am Tag. Die „Nordzucker AG“, „eine der großen europäischen Zuckerproduzenten, die bisher ausschließlich EU-Rüben verarbeitete,“ überlegt bereits, ob sie in Brasilien investieren soll und hat schon mit dem von Bartholomäus Grill besuchten Zuckerbaron Kontakt aufgenommen. Auch er lebt in einem von einem Stararchitekten entworfenen Palast (aus Glas), „umgeben von Springbrunnen und golftauglichem Rasen, finanziert vom Zuckergeld“. Dass daraus einmal ein Museum wird, ist vorerst eher unwahrscheinlich.
In Berlin gibt es ein (Rüben-)„Zuckermuseum“, es ist das älteste Museum seiner Art und wurde 1904 zusammen mit dem damaligen Institut für Zuckerindustrie eröffnet. Seit 1995 ist es Teil des Deutschen Technikmuseums. Im Zusammenhang der Ökologiebewegung thematisieren auch immer wieder Kunstgalerien Aspekte von Flora und Fauna im Kolonialismus und danach. (*****)
Das sehr informative Buch mit dem Titel „Zucker. Eine Geschichte über Macht und Versuchung“ von James Walvin, aus dem ich oben bereits mehrmals zitiert habe, erschien 2020 in der wunderbaren Reihe „Stoffgeschichten“ (herausgegeben von Armin Reller und Jens Soentgen).
Das Buch beginnt damit, dass der Autor erzählt, wie viele „Süßigkeitsläden“ es in der Nähe seines Hauses gab, als er klein war. Ende der Sechzigerjahre arbeitete er auf einem jamaikanischem Zuckergut und beschäftigte sich dann als Historiker vorwiegend mit der Geschichte der Sklaverei. In seinem Text will er nun erklären, wie und warum sich „unsere Haltung gegenüber dem Zucker zu Beginn des 21. Jahrhunderts stark gewandelt hat“ – in 16 Kapiteln.
Ein Kapitel thematisiert den Rum. 1648 war man in den Zuckerrohr anbauenden Kolonien noch der Meinung, Rum, der zunächst in Barbados und Martinique aus dem Nebenerzeugnis bei der Zuckerproduktion, der Melasse, hergestellt wurde, „sei ein Getränk, das nur für Sklaven und Esel tauge“, aber dann kamen doch immer mehr Leute auf den Geschmack, so dass 1695 auf Barbados schon 2,3 Millionen Liter hergestellt wurden. Nach 1731 gehörte Rum zur Verpflegung der Marinesoldaten der Royal Navy, wenig später wurde in England festgelegt, dass allen an Bord täglich ein halber Liter zustand. Der Rum milderte die Strapazen, die sie auf den langen Schiffsreisen aushalten mußten, meint Walvin. Die deutsche Rumproduktion befand sich wegen des Hafens vor allem in Flensburg, das sich noch heute „Rumstadt“ nennt.
Vielleicht kann man sagen, dass sich überhaupt alle mit Zucker hergestellten Produkte, Süßigkeiten, Pralinen, Kuchen, Limonaden, Alkoholika etc. die Bitterkeit des Lebens, das Alleinsein, das Alt- und Krankwerden etc. mildern. Es verhält sich mit dem Zucker so ähnlich wie mit dem ebenfalls gesundheitsschädlichen Rauchen. Sie rufen vielfach sogar die gleichen körperlichen Schäden hervor.
Sinnigerweise stellt das sozialistische Kuba beides in bester Qualität her: Zucker und Tabak (Rum und Zigarren), auch der kubanische Kaffee, der in Havanna fast an jeder Straßenecke für wenig Geld in kleinen Tassen ausgeschenkt wird, hat eine hohe Qualität. Auf Kuba gibt es ferner das größte Angebot an Schaukelstühlen, schon für kleine Kinder. Kein Wunder, dass es gerade ein Kubaner war, der „Das Recht auf Faulheit“ verfasste: Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx, der eher ein Lob der Arbeit schrieb, sich aber ansonsten gut mit „dem Kubaner“ verstand, der seine Tochter Laura heiratete, mit der er bis zu ihrem gemeinsamen Selbstmord in Europa politisch aktiv war. 1889 eröffnete er den „Internationalen Arbeiterkongress“ in Paris.
Dabei fällt mir ein, dass die weissrussischen Emigranten im Westen gerade einen ganzen „Weltkongreß der Belorussen“ per Internet veranstalteten – das gehört aber nicht unbedingt hierher.
.
Zuckerrohr-Transport
.
Anmerkungen:
(*)
1854 lag der Engländer Alfred Russel Wallace krank in seiner Hütte auf der Molukkeninsel Ternate. Er war einer der großen, auf Insekten und Vögel
gewissermaßen spezialisierten Sammler
, der aber auch Orang-Utans nicht verschonte. Er hatte seine Kunden vor allem in England,
die ihm z.B. einen Shilling pro Käfer zahlten
. Bevor
Wallace
den „Malayischen Archipel“ absammelte, durchstreifte er zusammen mit dem englischen Käferexperten Henry Walter Bates Amazonien. („Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro“ und „Der Malayische Archipel. Die Heimath des Orang-Utan und des Paradiesvogels. Reiseerlebnisse und Studien über Land und Leute.“ heißen die beiden Berichte von Wallace, den ersten hat der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht neu herausgegeben, der zweite erschien in dem Berliner „Verlag der Pioniere“. De
n
Bericht von Bates
gab H.M. Enzensberger
in
seiner
Anderen Bibliothek
heraus –
unter dem Titel: „Am Amazonas : Leben der Tiere, Sitten und Gebräuche der Bewohner, Schilderung der Natur unter dem Äquator und Abenteuer während eines elfjährigen Aufenthalts“.)
Bates blieb elf Jahre in Amazonien, sein Bericht erschien 1863, in der „Vorrede“ dazu heißt es: Wallace und er unternahmen die Reise, um „für uns selbst eine Sammlung anzulegen. Die Duplikate wollten wir nach London senden, um dadurch unsere Kosten zu decken.“ Außerdem wollten die beiden, „Tatsachen sammeln für die Lösung des Problems über den Ursprung der Arten.“
Wallace kehrte schon nach vier Jahren vom Amazonasgebiet zurück und veröffentlichte seinen Expeditionsbericht. Im Gegensatz zu ihm gelang es Bates später, seine 14.712 gesammelten Tiere 1859 heil nach London zu transportieren. Von diesen Objekten waren „nicht weniger als 8000 für die Wissenschaft neu“. Der Schriftsteller Alex Shoumatoff schreibt in seinem Nachwort: Auch 125 Jahre nach Erscheinen von Bates‘ Bericht sei dessen Werk „immer noch das Buch zum Thema“. Auch wenn dieses oder jenes inzwischen korrigiert werden mußte: So z.B. Bates‘ Bemerkungen „über die extreme Fruchtbarkeit des Bodens. In Wirklichkeit sind die Böden Amazoniens meist tropische Böden, eher dünn und arm.“
1855 schickte Wallace aus dem Malaiischen Archipel einen Aufsatz an Bates, der sich noch in Amazonien aufhielt: „On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species“. Dieser erinnerte ihn sogleich in seinem Antwortbrief daran: „Die Theorie wurde auch von mir entwickelt, aber ich gebe zu, dass ich sie nicht mit solcher Kraft und Vollständigkeit zu entfalten vermocht hätte.“
Dem „Artenrätsel“, wie Matthias Glaubrecht diese Theorie in seiner Wallace-Biographie „Am Ende des Archipels“ (2013) nennt, war damals auch Charles Darwin auf den Galapagos-Inseln nachgegangen, wo er sich auf seiner Weltreise 1835 vier Wochen aufgehalten hatte. Dort waren ihm die Galapagos-Finken aufgefallen, die auf den Inseln unterschiedliche Schnabelformen ausgebildet hatten – je nachdem womit sie sich ernährten. Auch die vier Spottdrosselarten auf den Galapago-Inseln unterschieden sich von der, die auf dem südamerikanischen Festland lebte.
1885 setzte sich Wallace in seine Hütte auf der Molukkeninsel Ternate und brachte fiebrig eine Theorie der Entwicklung der Arten zu Papier. Dieses sogenannte „Ternate-Manuskript“ schickte er Darwin. Was der damit machte und wie andere damit umgingen bzw. Darwin rieten, wie damit umzugehen sei, hat der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht nun in seiner umfangreichen Wallace-Biographie „Am Ende des Archipels“, die einem Detektivroman ähnelt, herauszubekommen versucht. Sein Verdacht ist, dass mit Darwins 1859 veröffentlichten Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ Wallace‘ Anteil daran gewissermaßen unterschlagen wurde, obwohl sie ein Jahr zuvor noch beide ihre Thesen öffentlich zur Diskussion gestellt hatten – und die Londoner Linné-Gesellschaft dieses Ereignis 50 Jahre später zum Anlaß nahm, um alljährlich eine „Darwin-Wallace-Medaille“ zu vergeben – die erste bekam 1908 sinnigerweise Alfred Russel Wallace selbst – vielleicht zur Entschädigung. Darwin hatte ihm in den Siebzigerjahren bereits zu einer Regierungspension verholfen, nachdem Wallace sich mit Aktien verspekuliert hatte und zu verarmen drohte. Wenn es denn eine üble Trickserei sowie vernichtete oder umdatierte Briefe um die „Darwinsche Theorie“ gab, um Wallace aus der doppelten Urheberschaft an der „Evolutionstheorie“ auszuschalten, und mit Wallace genaugenommen auch Bates, dann hat Wallace dies Darwin auf alle Fälle niemals übel genommen.Alex Shoumatoff schreibt im Nachwort zu Bates Amazonien-Bericht: „Wallace war unabhängig von Darwin zu der Theorie gelangt – dennoch sprach er immer vom Darwinismus und war hinsichtlich seines eigenen Anteils am Ruhm gänzlich unbekümmert -, aber er hatte das Gefühl, dass es viele Dinge gab, die diese Theorie nicht erklärte.“ 2009 meinte ein Biologiehistoriker am Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte sogar: „Sie erklärt so gut wie gar nichts.“
Darwin und Wallace korrespondierten über die Kontinente hinweg miteinander – höchstwahrscheinlich auch über Paradiesvögel sowie über den im Malayischen Archipel lebenden und ebenfalls prächtigen Argusfasan. Bei beiden Vögeln unterscheiden sich die Männchen stark von den Weibchen. In seiner 1871 veröffentlichten Arbeit „Die Abstammung des Menschen und die sexuelle Selektion“ dienen sie Darwin als Paradebeispiel dafür, dass die Männchen in Schönheitskonkurrenz zueinander stehen und die Weibchen den Imposantesten wählen – „den mit den besten Genen“: „Survival of the Prettiest“ – unter dieser Überschrift fand 2013 eine Konferenz des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte statt. Dieses „Survival“ über die sexuelle Selektion war für Darwin neben der natürlichen Selektion bei der Entwicklung der Arten wesentlich, nicht so für Wallace, der die Theorie der sexuellen Selektion für überflüssig hielt, weil die Theorie der natürlichen Selektion bereits alles erkläre.
Der FU-Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hat von der Theorie der sexuellen Selektion ausgehend in seinem Buch „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ (2011) eine neue – schreckliche – Soziobiologie entworfen, indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. In der „Welt“ hieß es dazu: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen.“ Mit Konrad Lorenz könnte Menninghaus auch sagen: „Ich vermenschliche die Tiere nicht, ich vertierliche den Menschen“. Aber ob so oder so, eine neue Erkenntnis hat der Gründungsdirektor des neuen Frankfurter Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik dadurch nicht gewonnen. Ebensowenig wie das einst bereits mit dem selben Gedankengut gespeiste „Institut für Humanethologie“ von Irenäus Eibl-Eibesfeldt, das die Max-Planck-Gesellschaft jetzt abwickelt. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 2011 auch der Ökologe Josef Reichholf ein Buch über die sexuelle Selektion veröffentlichte: „Der Ursprung der Schönheit: Darwins größtes Dilemma“
Auf dem Weg von Brasilien nach London ging das Schiff mit den ganzen von Wallace gesammelten Tierkadavern, Fischen in Gläsern, getrockneten Pflanzen und seinen schriftlichen Notizen unter. Wallace konnte zwar gerettet werden, aber er verfiel danach in London in Depressionen – bis er sich zum Malayischen Archipel aufmachte und aufs Neue anfing zu sammeln. Vor allem jagte er dort Paradiesvögel, die gerade auf Damenhüten in Europa groß in Mode waren – und deswegen hohe Gewinne versprachen. Wallace war auf den Inseln ständig hinter ihnen her, zeitweilig beschäftigte er auch noch Jäger dafür. Obwohl die Federn der männlichen Paradiesvögel heute schon lange aus der Mode sind, gelten diese Tiere noch immer als „bedrohte Art“.
Wallace sah das damals mit den Paradiesvögeln so: „Auf der einen Seite erscheint es traurig, dass so außerordentlich schöne Geschöpfe ihr Leben ausleben und ihre Reize entfalten nur in diesen wilden, ungastlichen Gegenden, welche für Jahrhunderte zu hoffnungsloser Barbarei verurteilt sind; während es auf der anderen Seite, wenn zivilisierte Menschen jemals diese fernen Länder erreichen und moralisches, intellektelles und physisches Licht in die Schlupfwinkel dieser Urwälder tragen, sicher ist, dass sie die in schönem Gleichgewicht stehenden Beziehungen der organischen Schöpfung zur unorganischen stören werden, sodass diese Lebensformen, deren wunderbarer Bau und deren Schönheit der Mensch allein imstande ist, zu schätzen und sich ihrer zu erfreuen, verschwinden und schließlich aussterben.“
Desungeachtet schätzte er die holländische Kolonialverwaltung, die mit großer Strenge die Molukker zu regelmäßiger Arbeit auf ihren Plantagen zwangen. Er verteidigte „selbst die Zerstörung der Muskatnuss – und der Gewürznelkenbäume auf vielen Inseln, um ihren Anbau auf eine oder zwei zu beschränken“ – auf denen die Holländer „das Monopol leicht aufrecht erhalten“ können.
Wie Darwin lobte auch Wallace die segensreiche Wirkung der sklavenhaltenden Plantagenbesitzer und die fürchterlich autoritären Missionare in den Kolonien, die den beiden auf ihren Expeditionen Unterkunft, Verpflegung und Unterhaltung boten. (Bates war da zurückhaltender.)
Es gibt in Wallace‘ Bericht über seine Sammeltätigkeit auf den Inseln der Malayischen Archipels ein langes Kapitel, das sich ausschließlich mit den Paradiesvögeln befaßt. Viele seiner Reisen dort zu den Inseln wurden, wie er schreibt, „zu dem speziellen Zweck unternommen, um Exemplare von Paradiesvögeln zu bekommen“...Und da er, soweit ihm bekannt, „der einzige Engländer“ war, „der diese wundervollen Vögel in ihren Heimatwäldern gesehen und viele derselben erhalten hat,“ deswegen verfaßte er ein Extra-Kapitel über die Paradiesvögel, die von den malaiischen Händlern „Göttervögel“ genannt werden. Die anderen Kapitel wurden von dem Geobiologen Wallace zumeist nach Inseln benannt.
Anhand einer Reihe erlegter Paradiesvogel-Exemplare der Art „Paradisea apoda“ beschreibt Wallace die Stadien der Herausbildung der für die Hutmode so wichtigen Schwanzfedern, bei denen zuletzt die roten Seitenfedern erscheinen – um sodann daraus zu folgern: „Die aufeinanderfolgenden Stadien in der Farbe und dem Gefieder beim Paradiesvogel sind sehr interessant, weil sie in schlagender Weise mit der Theorie übereinstimmen, dass sie durch einfache Tätigkeit der Abänderung und durch die kumulative Wirkung der Auswahl durch die Weibchen, welche den mehr als gewöhnlich gezierten männlichen Vögeln den Vorzug geben, hervorgerufen sind.“ Das ist sowohl voreilig geschlußfolgert als auch wahrscheinlich aus der Korrespondenz mit Darwin gefolgert – deduziert, um damit anhand von fünf Bälgern darzulegen, wie die sexuellen Vorlieben der Weibchen sich evolutionär auf die Entwicklung der männlichen Schwanzfedern (auf ihre Prächtigkeit) auswirken, was sich dann an der Wachstumsabfolge der Federn ablesen läßt.
Wallace hat nie dieses „Vorzug geben“ durch die Weibchen beobachtet, wie er überhaupt keine Tiere beobachtet hat, es ging ihm vor allem um das Aufkaufen von erlegten oder gefangenen Tieren und/oder um das Aufspüren, Zielen, Erlegen und Zerlegen derselben. Das macht im übrigen seine beiden über 1000 Seiten umfassenden Expeditionsberichte so tödlich langweilig.
Noch öder ist allerdings der 2015 veröffentlichte Bericht „Im Reich der Inseln“ des australischen Evo-Devologen (Entwicklungsbiologen) Tim Flannerty, der die Inselwelt Melanesiens (quasi vor der „Haustür Australiens“, wie der Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht in einer Rezension des Buches schreibt) nach noch nicht ausgestorbenen und nur bisher übersehenen Säugetieren durchkämmte. Er fand – wenig überraschend – einige neue Ratten-, Fledermaus- und Flughunde-Arten. Wie Wallace, der zuvor ebenfalls auf einigen dieser Inseln gewildert hatte, ging es Flannerty darum, diese Tiere zu fangen bzw. zu schießen und anschließend auseinander zu nehmen – um die Wissenschaft wieder ein Stück voran zu bringen, indem er dadurch dem Linnéschen System ein paar neue Namen hinzufügte. Keine Beobachtung, keine Erforschung ihrer Umwelten und Lebensweisen, nur schlecht erzähltes Abhaken einer Insel und ihrer wenigen Säugetierarten nach der anderen...
(Der großartige Insektenforscher Jean-Henri Fabre sah einst, wie seine Kinder mit einigen Käfern spielten. Sie rissen ihnen die Fühler und Beine aus usw.. Erst wollte er entsetzt einschreiten, aber dann fragte er sich, ob er nicht in seiner Wissenschaft das selbe mache wie seine Kinder im Spiel – und mußte das bejahen.)
Zu der von Wallace erwähnten Paradiesvogel-Art „Paradisea apoda“ sei noch hinzugefügt, dass ihre Benamung durch Linné erfolgte: „apoda“ heißt fußlos. Der große schwedische Benamer hatte nur fußlose Exemplare dieser Art zu sehen bekommen – wenn er überhaupt eins gesehen hat, wahrscheinlich hat er nur den Bericht des Kaufmanns und Entdeckers Jan van Linschoten gelesen, der das Tier 1598 „Paradiesvogel“ nannte – und dazu laut Wallace schrieb, „dass niemand diese Vögel lebend gesehen hat, denn sie leben in der Luft, wenden sich stets gegen die Sonne und lassen sich vor ihrem Tod nie auf die Erde nieder; sie haben weder Füße noch Flügel, wie man an den Vögeln, die nach Indien und manchmal auch nach Holland gebracht wurden, sehen kann“.
Die Fußlosigkeit rührt in Wahrheit daher, dass die Eingeborenen, wie Wallace schreibt (ohne sie deswegen umbenennen zu wollen), bei den gefangenen oder geschossenen Vögeln „Flügel und Füße amputieren, dann balgen sie den Körper bis zum Schnabel hinauf ab und nehmen das Gehirn heraus. Darauf wird ein starker Stock hindurch gestoßen, der aus dem Mund heraus kommt. Dieser wird mit einigen Blättern umwickelt, das Ganze in eine Palmen-Blütenscheide gelegt und in der rauchigen Hütte getrocknet. Bei dieser Behandlung schrumpft der Kopf, welcher in Wirklichkeit groß ist, auf fast nichts zusammen, der Körper wird sehr verändert und verkürzt und das wallende Gefieder kommt am meisten zur Geltung.“ Und einzig darum geht es dem Endverbraucher in Europa ja auch.
Wallace hat eine Liste von allen Paradiesvögeln aufgestellt, sie umfaßt 18 Arten, von denen er jedoch nur fünf erwerben konnte, eine von ihm „auf der Insel Batchian selbst entdeckte“, der Standartenflügler, hat der englische Zoologe George Robert Gray nach ihm benannt: „Semioptera wallacei“.
Am Schluß seines Kapitels über Paradiesvögel kommt Wallace noch kurz auf das Selten-Werden dieser Vögel infolge des europäischen Bedarfs zu sprechen: Während seines fünfjährigen Aufenthalts auf Celebes, den Molukken und Neuguinea war er „nie imstande gewesen, Bälge von nur der Hälfte der Arten zu kaufen, welche der Südseeerforscher René Primevére Lesson 40 Jahre früher während einiger Wochen in denselben Gegenden erhielt“. Wallace führt das auf die „holländischen Händler“ zurück, die den Sultan von Tidore veranlaßten, nach diesem „wundervollen Naturprodukt Paradiesvögel“ zu suchen, „deren exquisite Schönheit in Form und Farbe darauf angelegt ist, die Bewunderung und das Staunen der zivilisiertesten und geistig am weitesten vorgeschrittenen Menschen zu erregen und dem Naturforscher unerschöpfliches Material für sein Studium, dem Philosophen für seine Spekulationen zu gewähren.“. Die Steuereintreiber des Sultans hatten auf ihren „Expeditionen“ zu den Eingeborenen-Dörfern den „Befehl, alle seltenen Arten Paradiesvögel zu sammeln“ – für die sie wenig oder nichts zahlten, „da es genügend ist, wenn sie sagen, dass es für den Sultan sei“, der sie dann an die holländischen Händler verkaufte.
2017 veröffentlichte der US-Schriftsteller Tom Wolfe
ein dünnes Buch über zwei Feldforscher: Alfred Russel Wallace und Daniel L. Everett. Die beiden kennt kaum jemand, wohl aber Charles Darwin und Noam Chomsky, zwei Celebrities aus der „Upperclass“, die die anderen beiden – „Underdogs“ – verdrängt haben, obwohl deren „wissenschaftliche Leistung“ ihnen mindestens ebenbürtig war. Das muss sich ändern – so Tom Wolfe in seinem Pamphlet, denn Wallace stehe
wohl eher als Darwin die Urheberschaft an der Evolutionstheorie zu.
2019 veröffentlichte der Evolutionsbiologe und Wallace-Biograph Mathias Glaubrecht ein dickes Buch mit dem Titel „Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten“. Darin kommt er noch einmal auf den Anteil von Darwin und Wallace an der Evolutionstheorie zu sprechen.
.
„Viren – das Erfolgsmodell der Evolution“ – Foto: scinexx.de
.
(**)
Manche Blume, so schrieb der Philosoph Theodor Lessing, könnte man „als ein festgebanntes Insekt“ bezeichnen – und andersherum „viele Insekten, zumal die Bienen und Schmetterlinge, als frei bewegliche Blumen“. Die meisten Orchideen, von denen weltweit etwa 25.000 Arten bekannt sind, sehen wirklich wie „festgebannte Insekten“ aus – und wer weiß, vielleicht wird man sie irgendwann auch als solche neu bestimmen. Ganz sicher weiß man jetzt schon, dass diese „Königin der Blumen“ die komplizierteste Existenzform unter den „bedecktsamigen Blütenpflanzen“ entwickelt hat, obwohl oder weil sie angeblich in evolutionärer Hinsicht die jüngste „Familie“ bildet. Fangen wir unten an – im Boden oder (epiphytisch siedelnd) auf Bäumen: Dort braucht sie einen Pilz, damit der Keim überhaupt aufgeht. Man kann die Nährstoffe, die ihm der Symbiosepilz zuführt, künstlich herstellen, das machen die Orchideenzüchter auch, weswegen es bereits über 100.000 Neuzüchtungen (Hybride) gibt, sie werden bei der „Royal Horticultural Society“ registriert und dort gelegentlich auch in ihrem botanischen Namen als besonders ausgezeichnet – „geadelt“. Es gibt aber auch heute noch tropische Orchideen, wild lebend, für die reiche Liebhaber mehr zahlen, „als heute ein Luxusauto kostet“ wie es im Ratgeber „Orchideen“ des Züchters Jörn Pinske heißt. Dabei geht es „nur“ um ihre seltsame Schönheit und manchmal auch um ihren Duft. Einige Arten enthalten daneben noch „psychoaktive Inhaltsstoffe“, aber ansonsten ist sie keine „Nutzpflanze“, abgesehen wie erwähnt von der Vanille.
Die Mehrzahl der Orchideen-Liebhaber sind Männer. Der Pflanzenname leitet sich vom griechischen Wort „orchis“ her, was „Hoden“ heißt. Damit waren anfänglich die Knollen verschiedener Erdorchideen gemeint. Wegen dieser Speicherknollen, die bei Wildschweinen begehrt sind, gehört das „Männliche Knabenkraut“ zu einer besonders gefährdeten Art. Orchideen sind zweigeschlechtlich. In der Blüte hat sie (männliche) Staubblätter und eine (weibliche) Narbe, die zu einem „Säulchen“ (Gynosterium) verwachsen sind. Die Pflanze bestäubt sich nicht selbst damit, sondern braucht ein Insekt, dass ihren Pollen zu einer anderen bringt und ihr gleichzeitig fremden Pollen an die Narbe trägt.
„
Daß Hummeln, Bienen, Tagfalter, also Insekten, irgendetwas mit den Blumen haben, wußte man schon seit der Antike. Auch daß sie sich irgendwie von ihnen ernähren. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wußte man auch, daß Blumen ein Geschlecht haben. Linné baute sein ganzes System der Pflanzen darauf auf,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz. Aber im Sommer 1787 entdeckt der Direktor der Spandauer Realschule Christian Konrad Sprengel auf einer Blumenwiese zwischen dem Wunder ihres Aussehens und den um sie herumschwirrenden Insekten eine völlig neue Beziehung.“
Sprengel findet, daß jedes kleinste Detail jeder Blume es nur auf Das Eine abgesehen hat: Insekten anzulocken, sie hinzuführen, hinzuweisen auf die in ihr verborgenen Schätze – Saft oder Nektar – also den „in der Luft herumschwärmenden Insekten als Saftbehältnisse schon von weitem ins Auge zu fallen“. Und „indem die (so angelockten) Insekten in den Blumen ihrer Nahrung nachgehen“ tun sie etwas ganz anderes: „Zugleich,“ schreibt Sprengel, „ohne es wollen und zu wissen“ befruchten sie die Blumen. Es wird dabei getäuscht und getrickst: viele der spektakulärsten Orchideen haben gar keinen Nektar. Sprengel: „Ich muß gestehen, daß diese Entdeckung mir keineswegs angenehm war.“ Denn: stimmt dann noch die Grundthese?
Die Blüten der Sexualtäusch-Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern auch noch den weiblichen Sexuallockstoff. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung so weit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.
Peter Berz fragte sich darob: „Duft als Belohnung. Wie geht das? Nur als Droge, Rausch. Fast zu schön, um wahr zu sein. Die unmittelbare Reaktion der männlichen Bienen auf die Flüssigkeit kann man nur als Rausch bezeichnen. Sie verlieren in erheblichem Maße die Kontrolle über ihre Bewegungen und werden unbeholfen und träge und unaufmerksam. Offenbar genießen sie ihre Empfindungen, denn sie kommen über lange Zeit immer wieder zurück.“
Einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, bieten den Prachtbienenmännchen sogar einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Sie nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“
Besonders raffiniert ist die Duftproduktion bei der Germerblättrigen Stenderwurz, die im Jenaer Max-Planck-Institut für chemische Ökologie erforscht wurde: Um Schwebfliegen zur Bestäubung anzulocken, verströmt diese Orchidee einen Botenstoff, mit dem sich Blattläuse alarmieren, er lockt aber auch Schwebfliegenweibchen an, die ihre Eier bei Blattläusen ablegen, weil sich ihre Larven dann von ihnen ernähren. In der Orchideenblüte täuschen darüberhinaus „warzenartige Gebilde“ die Anwesenheit von Blattläusen vor. Es gibt dort aber gar keine, so dass die Larven der Schwebfliegen keine Nahrung finden und sterben. Der Biologe Johannes Stökl erwähnt zwei weitere Orchideenarten, die „stechende Insekten“ durch Vortäuschen von Schmetterlingsraupen in ihren Blüten zu deren Befruchtung verlocken.
Botaniker der Universität Wien erforschten auf Madagaskar Orchideenarten, die einen Geruch von faulem Fleisch verbreiten – um damit Aasfliegen anzulocken. Ihre Samen sind winzig klein und breiten sich wie eine Staubwolke aus, in jedem steckt ein Embryo. Es gibt daneben Orchideenarten, die bis zu zwölf Embryos in ein Samenkorn packen.
Über eine weitere auf Madagaskar vorkommende Art, die einen 30 Zentimeter langen Dorn in ihrer Blüte ausgebildet hat, an dessen Ende sich Nektar befindet, hat Darwin gemeint, man werde dort bestimmt auch einen Schmetterling finden, der einen genauso langen Saugrüssel hat. 1903 entdeckte man ihn tatsächlich.
Die Biogeochemiker der Universität Bayreuth haben bei einer Reihe südafrikanischer Orchideen herausgefunden: Wenn unterschiedliche Arten in enger Nachbarschaft leben und von den selben Insekten (Wespen z.B.) bestäubt werden, „platzieren sie ihre Pollen an unterschiedliche Stellen – z.B. auf verschiedenen Abschnitten ihrer Vorderbeine.“
Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren...Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie.
Nach Meinung einiger Orchideenforscher ist bei diesem Angleichungsprozeß die Pflanze die treibende Kraft. Sie wollen festgestellt haben, dass eine Orchidee, die außerhalb des Vorkommens „ihrer“ Insekten „Fuß gefaßt“ hat, sich in Form und Farbe an eine neue Art angleicht.
Im übrigen kennen die Orchideen auch eine vegetative Fortpflanzung (durch Ableger z.B.), weswegen G. W. F. Hegel in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ (1830) die geschlechtliche Fortpflanzung für einen reinen „Luxus“ hielt. Sie wird dafür mit umso mehr Liebe betrieben. Wenn z.B. die mikroskopischen Samen einer asiatischen Orchideenart durch den Wind an eine Baumrinde geweht wurden, entrollen sie „spiralige Ankerfäden“, um sich festzuklammern und in Kontakt mit einem Symbiosepilz zu kommen. Ist keiner da, muß der Keim sterben, schreiben die Mitarbeiter des Berliner Botanischen Museums in ihrem Band über „die skurrile Welt der Orchideensamen“.
Als ich unlängst im Orchideengewächshaus des Kassler „Bergparks Wilhelmhöhe“ war, konnte ich es nicht fassen: Es werden dort fast nur Orchideen gehalten, die der menschlichen Vagina in Form und oft auch in Farbe glichen. Ich erfuhr dort: Die Schamlippe heißt bei den Orchideen ebenfalls „Lippe“ (Labellum), es ist ein zur Lippe geformtes Blütenblatt, das den Insekten eine Landefläche bietet, und die Klitoris ist bei den Orchideen das vorstehende „Säulchen“. Hinzu kommt bei manchen Orchideenarten ein Sexualtäuschduft, der auch auf Menschen, mindestens Männer, wirkt, die Orchidee „Vanille“ kommt dem bereits nahe. Einige Orchideenblüten ähneln der Vagina auch deswegen, weil sie „Haare“ drumherum haben. Kurzum: „Die Sexualorgane der Orchideen sind einzigartig,“ wie die überwiegend männlichen Autoren der „Kosmos-Enzyklopädie Orchideen“ schwärmen. „Wir könnten eine Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte schreiben, indem wir eine Orchideenblüte schildern,“ meinte schon der Basler Biologe Adolf Portmann in seinem Radiovortrag „Insekten und Blumen“ (1942). Gleiches ließe sich auch wohl über die menschliche Vagina (vulgo: Vulva) sagen.
Soll man noch erwähnen, dass ein katholisches Forschungsteam der Botanikerin Marta Kolanowska von der Universität Danzig im Kolumbianischen Urwald eine winzige Orchideenart entdeckte, die statt einer Klitoris ein weinrotes Teufelsgesicht in ihrer Blüte ausgebildet hat? Sie wurde „Telipogon diabolicus“ genannt. Und dann gibt es auch noch die „Orchis italica“, deren Lippe zu einem weißen Männchen mit großem Penis geformt ist. Wer damit wohl angelockt werden soll?
Seit über dem Botanischen Garten nicht mehr das Damoklesschwert der Schließung hängt, erschließt er sich ständig neue Finanzhebel: Mit (schrecklichen) Exotischen Nächten im Dschungelgewächshaus, mit „Das Dschungelbuch“-Inszenierungen, Hochzeitsfeiern, Halloween, „Christmas Garden“, Kakteentage, eigenem Geschenke-Shop...and more. Aber auch mit der Einbeziehung von immer mehr Hobbygärtnern – z.B. als Anbieter von Stauden, Kakteen, und fleischfressenden Pflanzen mit eigenem Verkaufsstand. Schon befürchtet mancher Jahreskartenbesitzer, dass aus dem Garten ein Spektakel wird, ein lauter Verkaufsrummel zwischen den stillen Gewächsen – mit einigen Nebeneinnahmen drumherum.
Kürzlich zeigte man eine „Orchideen-Show“: „Wir lieben Orchideen. Sie auch? Dann sprechen Sie uns an“. Die Züchter und Sprecher der Deutschen sowie auch der Polnischen Orchideen Gesellschaft und der Fachgesellschaft Andere Sukkulanten in der Deutschen Kakteen Gesellschaft ließen sich viel Zeit, um mir das schwierige Geschäft mit diesen komplizierten Pflanzen zu erklären, inzwischen gäbe es ganze „Orchideen-Industrien“, die die Super- und Baumärkte beliefern. Mannimmt ein bestimmtes Teil eines Orchideenstengels und macht daraus Millionen Zellen, aus denen neue Pflanzen gezogen werden.
Hybridsorten züchtet man, indem die Pollen einer Art auf den Stempel einer anderen übertragen werden. Damit gerade das nicht passiert, haben die frei lebenden Orchideen sich so weit auf die Vorlieben eines von ihnen gewählten Bestäubungsinsekts angepaßt, dass dieses, oft auch ohne Nektar dafür zu bekommen, „blütentreu“ bleibt. Anscheinend kann man alle Orchideenarten miteinander kreuzen. Bis heute gibt es etwa 100.000 Hybride. Sie werden immer billiger, aber man hätte keine rechte Freude an ihnen.
Deutsche Orchideen gab es nicht zu sehen, außer Frauenschuh und einige andere nichteinheimische aber winterharte Freilandorchideen. Man machte mich auf winzige Orchideen aus Südamerika aufmerksam, sie hingen an einer Drahtwand und waren auf Korkstücke von der Größe einer Zigarettenschachtel festgebunden. Für die ständig neugezüchteten Hybriden wird offiziell keine wild wachsende Orchidee mehr genommen – „der Natur entnommen“. Das Biosphärenreservat Rhön beschäftigt zu ihrem Schutz sogar einen – sehr kenntnisreichen – Orchideenwart. Über die kleinen Orchideen in der kargen Rhön wurden seit den Zwanzigerjahren schon viele Bücher veröffentlicht.
Auch ein Züchter von fleischfressenden Pflanzen hatte einen Stand im Ausstellungs-Gewächshaus des Botanischen Gartens. Da ich in einem Moor voller Sonnentau groß geworden bin, interessierte mich diese Pflanze besonders. Seine Sonnentaupflanzen sahen jedoch ganz anders aus als „unsere“: Sie stammten aus Südamerika, Südostasien und Australien. Ihr Züchter aus Großbeeren hatte sie von Kollegen gekauft und weitergezüchtet. Die Venusfliegenfallen hatte ich mir größer vorgestellt, vor allem die Kannen der Kannenpflanzen. Füttern tat er sie alle nicht: „Sie müssen nicht unbedingt Fleisch haben“. Eine nährstoffreiche Erde tut es auch. Im Übrigen sei das mehr eine Liebhaberei als ein Geschäft für ihn. Ich vergaß ihn zu fragen, ob er Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen“ ist.
Über das sehr viel größere Geschäft mit Orchideen fand ich in dem Buch der Biologin Monika Offenberger „Symbiose“ (2014) einige Details: Orchideen-Früchte enthalten bis zu einer Million Samen, die jedoch kein Nährgewebe besitzen und deswegen zum Keimen auf einen Pilz angewiesen sind, „der das Pflanzenembryo ernährt, bis es Blätter und Wurzeln gebildet hat und sich selbst ernähren kann.“ Die Gärtner brauchten lange, bis sie das erkannten und noch länger, bis sie ein geeignetes Nährmedium fanden, „das alle nötigen Substanzen für das Auskeimen der Orchideensamen enthielt“, und zudem eine sterile Umgebung benötigt, damit sich keine Schimmelpilze ansiedeln. „Steriles Arbeiten ist auch heute noch oberstes Gebot beim Kultivieren von Orchideen. Gewandelt haben sich indes die Vermehrungs-Techniken. Nur ausnahmsweise – etwa beim Frauenschuh – werden noch Samen ausgesät; das Gros der Arten wächst dagegen in Gewebekulturen herans, die man aus speziellen Wachstumsknospen der Mutterpflanze, den sogenannten Augen, gewinnt. Auf diese Weise entstehen beliebig viele Nachkommen. Sie sind, ähnlich wie gewöhnliche Stecklinge oder Ableger, genetisch identisch, sprich: Klone. Aus einem Auge lassen sich Millionen von Jungpflanzen gewinnen. Einer der größten Orchideen-Vermehrungsbetriebe der Welt, das Familienunternehmen Hark aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen, produziert pro Jahr zigmillionen Klone für Abnehmer aus zahlreichen Ländern. Allein „Phalaenopsis“ (Nachtfalterorchidee) deckt mit ihren Varianten fast die gesamte Farbpalette ab. Zudem steht die edle Schöne mit Blühzeiten von mehreren Monaten außer Konkurrenz. Kein Wunder, dass sie auch auf finanziellem Gebiet alle Rekorde bricht: Sie gehört zu den Zimmerpflanzen mit dem weltweit höchsten Umsatz.“
Das Gegenteil gibt es aber auch: In der Rhön nahm ich an einer Orchideen-Exkursion eines Bauern und seines Sohnes teil. Im Auftrag der Verwaltung des Biosphärenreservat schützt er die wilden Orchideen, die auf den Trockenwiesen der Rhön wachsen, vor Überwucherung durch andere Pflanzen und vor dem Abgeflückt-Werden durch Touristen. Er arbeitet dabei mit Traktor und Mähbalken. An unzugänglicheren Flächen übernehmen dies kleine Schafherden, es gibt auch noch eine Ziegenherde für die steilen Hänge. Die Orchideen der Rhön sind zumeist ganz unscheinbar. Man muß schon genauer hinsehen, um sie anhand ihrer kleinen Blüten zu identifizieren.
Der Bauer bewirtschaftet nebenbei noch einige Felder. Er baut darauf Ackerunkräuter an. Die Samen sind für andere Bauern, die sie unter ihr Getreide-Saatgut mischen. Für den dadurch bewirkten geringeren Ernteertrag bekommen die Bauern eine staatliche Entschädigung. Es sind dies alles Experimente, seitdem man meint zu wissen, dass sich eine bestimmte Anzahl von Ackerunkräutern günstig für das Gedeihen der Getreidepflanzen auswirkt.
In der Rhön gedeihen gut 40 Orchideenarten. Der erste, der sie erforschte war Franz Kasper Lieblein, der 1784 eine „Flora Fuldensis“ veröffentlichte. Dann kam Goldschmidt (1863-1916). Die Orchideen wurden 1908 im Band VI seiner Rhönflora bearbeitet.
Derzeit werden die Pilze der Rhön systematisch erforscht – u.a. von dem Botaniker Andreas Bresinsky von der Universität Regensburg. Er schreibt: „Die Rhön hat hinsichtlich ihrer Pilze als schlecht erforscht zu gelten, obgleich die Kenntnis der Großpilze Mitteleuropas ursprünglich von dort aus ganz wesentlich gefördert wurde.“
Auf seiner Internetseite über die Rhön schreibt der aus der hessischen Rhön stammende Autor Marco Klüber: „Auf sonnig-warmen Kalkstandorten sind im Frühling Manns- und Helm-Knabenkraut gebietsweise häufig anzutreffen. Im Sommer dominiert die Mücken-Händelwurz den Aspekt ihrer Standorte. In halbschattigen Bereichen wachsen Bleiches und Rotes Waldvögelein, Braunrote und Müllers Stendelwurz, Großes Zweiblatt und Grünliche Waldhyazinthe. Die sehr seltene Honigorchis hat in den Enzian-Schillergrasrasen der thüringischen Rhön überregional bedeutende Vorkommen, die Grüne Hohlzunge ist eine Besonderheit der Halbtrockenrasen im Bergwinkel. Ragwurze, Pyramiden-Orchidee, Ohnsporn und Bocks-Riemenzunge sind in nacheiszeitlichen Wärmeperioden aus dem Süden eingewandert und bevorzugen die wärmsten Gegenden der Rhön.
Auf extensiven Wiesen können Großes Zweiblatt, Kleines, Manns- und Breitblättriges Knabenkraut ihre Blütenpracht entfalten, stellenweise wachsen hier auch Weiße Waldhyazinthe und Mücken-Händelwurz. Eine der merkwürdigsten und seltensten heimischen Orchideen ist an besonders magere Weiden gebunden: die Herbst-Wendelähre.
Die bunten Bergwiesen an den Hängen der Rhöner Kuppen werden typischerweise zweimal im Jahr gemäht, und ihre Artenzusammensetzung ist von diesem Bewirtschaftungsrhythmus wesentlich beeinflusst. An Orchideen wachsen hier nicht nur Großes Zweiblatt, Mücken-Händelwurz und die beiden Waldhyazinthen, sondern auch Manns-, Kleines, Breitblättriges und sogar das sehr seltene Brand-Knabenkraut.
Manche Orchideenarten erschließen sich auch Lebensräume, in denen man sie nicht unbedingt vermuten würde, nämlich unsere Siedlungs- und Infrastruktur. Sie wachsen in Hausgärten, Wochenendsiedlungen, Stadtparks und auf Friedhöfen; in stillgelegten Steinbrüchen, an Bahndämmen, an Waldwegen, auf Verkehrsinseln und entlang stark befahrener Straßen und Autobahnen. Es lohnt sich, auch an scheinbar unmöglichen Standorten Ausschau zu halten, denn Orchideen sind immer für eine Überraschung gut.“
.
Orchidee mit Teufelsgesicht
.
(***) Einen Monat nach der so genannten Tet-Offensive der südvietnamesischen Befreiungsbewegung fand in Westberlin im Februar 1968 der „internationale Vietnamkongreß“ statt. Dabei wurde insbesondere eine Parole des vier Monate zuvor ermordeten Partisanenführers Ché Guevara diskutiert: „Schafft zwei, drei, viele Vietnam!“. Die laut Oskar Negt bloß „abstrakte Gegenwart der Dritten Welt in den Metropolen“ geriet in einigen Redebeiträgen zu einer immer größeren Annäherung zwischen Saigon und Berlin: indem die Straßenkämpfe hier immer militanter wurden, indem man statt Geld für Medikamente nun „Waffen für Vietnam“ sammelte und indem sich mit den Worten von Rudi Dutschke bei den Aktivisten langsam das Gefühl verdichtete: „In Vietnam werden auch wir tagtäglich zerschlagen, und das ist nicht ein Bild und ist keine Phrase“.
In den Jahren davor litt man hier geradezu an der allzu „abstrakten Gegenwart“ des vietnamesischen Widerstands: 1968 veröffentlichte der Psychiater Erich Wulff das Buch „Vietnamesische Lehrjahre“, in dem er über seine Arbeit als Arzt in Hué von 1964 bis 1967 berichtete. Zwischendurch mußte er nach Deutschland zurück kehren und wieder in einer Freiburger Ambulanz arbeiten, wo ihn die Beschäftigung mit den psychischen Leiden der Mittelschicht jedoch bald anödete: „In Vietnam hatte ich Krankheit als gewaltsamen Einbruch ins Studium, ins Arbeits- und Privatleben kennengelernt; der Arzt reparierte sie, wenn er konnte...Die Lebensumstände, in die der Entlassene zurückkehrte, waren oft empörend; aber der Arzt konnte dennoch das Gefühl haben, etwas geschafft zu haben, etwas Wirkliches; auch hatte die Überlegung Sinn, wie die Verhältnisse, die ständig Krankheit verursachten, sich ändern ließen. Die Änderung war nicht bloß denkbar, sondern es wurde im Land um sie gekämpft. Ein vielfältiger Prozeß der Veränderung nahm einen auf, bot Möglichkeiten des Eingreifens. Auch in persönlichen Freundschaften war solche Wirklichkeit greifbar: was mich mit Tuan, Mien u.a. verbunden hatte, beruhte vorrangig auf gemeinsame Stellungnahme zu den Ereignissen, war in seinem Kern Politik, Engagement für die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Unsere Freundschaften waren niemals in der Fadheit des bloß Privaten eingeschlossen. Sie waren sozusagen in einem pathetischen Sinne republikanisch. In Vietnam hatte mich gesellschaftliche Wirklichkeit bis in die sogenannte Intimsphäre hinein betroffen und herausgefordert.“
Diese gesellschaftliche Veränderung bis in die Beziehungen hinein vermißte Wulff im allzu friedlichen Freiburg, so daß er bald wieder zurück nach Vietnam ging. Auf dem Vietnamkongreß in Westberlin resultierte daraus u.a. für den Schriftsteller Peter Weiß die Forderung: „Unsere Ansichten müssen praktisch werden, unser Handeln wirksam. Dieses Handeln muß zur Sabotage führen, wo immer sie möglich ist. Dies fordert persönliche Entscheidungen. Dies verändert unser privates, individuelles Leben.“ – Bis schließlich eine gemeinsame „Front“ entsteht.
Die internationale Studentenbewegung mußte dabei einen ähnlichen Weg wie die südvietnamesischen Partisanen vollziehen. So erzählte z.B. Quyet Thang, ein Bauer, der erst Partisanenführer in der Provinz Tay Ninh wurde und dann Regimentskommandeur der regulären Truppen der Befreiungsarmee: „Bis Ende 1959 wurde unsere ‚Linie‘ ausschließlich vom Gedanken eines legalen, politischen Kampfes ohne Gewalt bestimmt“. Aber die südvietnamesischen Truppen terrorisierten die Dörfler dermaßen, dass sie irgendwann vor der Entscheidung standen: „Aufstand oder Tod“. Anfang 1960 unternahmen sie ihre erste „Selbstverteidigungsaktion“: mit einem alten Gewehr, mehreren selbstgebastelten Minen aus Bambusrohren, die sie mit Karbid und Wasser füllten, und einigen Megaphonen überfielen sie nachts einen kleinen Militärstützpunkt der Regierung, nachdem die Frauen auf dem Markt das Gerücht verbreitet hatten, starke Vietkong-Einheiten seien mit schweren Waffen in der Nähe ihres Dorfes gesehen worden. Das gezielt ausgestreute Gerücht im Dienste des Befreiungskampfes kennt man auch aus Weissrussland: Wenn dort ein Partisan durchs Dorf kam, erzählten die Bäuerinnen den Deutschen, es seien tausende gewesen, und wenn es tausende waren, sagten sie, es wären nur zwei, drei gewesen. Im Stützpunkt Phu My Hung funktionierte das Gerücht so gut, dass die Soldaten dort völlig eingeschüchtert waren und beim Angriff keinen einzigen Schuß abgaben. Zur Warnung an die anderen erschossen die Partisanen einen besonders brutalen Distriktchef. Das hatte laut Quyet Tang eine durchschlagende Wirkung: „In allen umliegenden Dörfern stellten sie ihr Treiben ein, und der schlimmste Terror hatte beinahe über Nacht ein Ende gefunden.“ Damit war die Linie der Gewaltlosigkeit verlassen.
Als nächstes bereitete sich diese Partisanengruppe darauf vor, das Fort Tua Hai, in dem 2000 Soldaten stationiert waren, anzugreifen, vor allem um sich dort Waffen zu beschaffen. Für diese Aktion bekamen sie bereits 260 vor allem junge Kämpfer zusammen, die mit insgesamt 170 alten Gewehren und etlichen selbstgebauten Granaten ausgerüstet wurden. Zum Abtransport der Beute wurden 500 Bauern aus entfernt gelegenen Dörfern mobilisiert. Außerdem hatten sie Flugblätter vorbereitet, die mit „Die Selbstverteidigungskräfte des Volkes“ unterschrieben waren. Der Überfall gelang und die Partisanen erbeuteten 1000 z.T. automatische Waffen, außerdem schlossen sich ihnen etliche Soldaten an, die beim Wegtragen der Beute halfen. Zehn Kämpfer fanden bei dieser Aktion den Tod, zwölf wurden verwundet. Auf ähnliche Weise wurden in der Folgezeit dann viele Aktionen durchgeführt. Aber Ende 1961 griffen die USA, unter anderem mit Hubschraubern, in die Kämpfe ein – und es mußten andere Taktiken entwickelt werden.
Den Bericht von Quyet Thang habe ich dem Buch „Partisanen contra Generale“ von Wilfred G. Burchett entnommen, ein australischer Journalist, der ab 1964 Südvietnam bereiste, sein Buch erschien 1967 im Verlag Volk und Welt. Die DDR bildete mit der UDSSR und China eine immer stärkere „Anlehnungsmacht“ für die Nordvietnamesen und die südvietnamesische Befreiungsbewegung – und unternahm enorme Anstrengungen, um sie zu unterstützen. Dazu erschien kürzlich ein Buch von zwei ADN- und N.D.-Korrespondenten in Hanoi zwischen 1967 bis 1970: „Sieg in Saigon“. Die Autoren Irene und Gerhard Feldbauer reden dabei von einer geglückten sozialistischen Wiedervereinigung in Vietnam, die sie in gewisser Weise einer unglücklichen kapitalistischen in Deutschland gegenüberstellen. Dem sozialistischen Block als Anlehnungsmacht traten die USA und auch die BRD als Bündnispartner der südvietnamesischen Regierung entgegen. Zuletzt kämpften die Amerikaner jedoch fast alleine gegen den Norden und den Vietkong. Die Guerilla wurde währenddessen mit dem südvietnamesischen Volk fast identisch. Anfänglich war es noch laut Mao Tse Tung darum gegangen, dass der Revolutionär sich in den Volksmassen wie ein Fisch im Wasser bewegen müsse. Die amerikanischen Militärstrategen blieben in diesem Bild und versuchten, „den Teich auszutrocknen, um die Fische darin zu fangen“.
Dazu griffen sie u.a. auf die im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen in Russland erprobten Maßnahmen zurück: auf Wehrdörfer, Tote Zonen, Verbrannte Erde-Aktionen und auf die Rekrutierung z.B. von partisanengeschulten Kosaken, die nun als Partisanenbekämpfungs-Truppen eingesetzt wurden (u.a. die Green Berets). Bald war auch für sie jeder Vietnamese ein Vietkong, was in gewisser Weise sogar eine Erleichterung darstellte, weil es die quälende Unsicherheit der Soldaten im Einsatz beseitigte, wie der amerikanische Autor Jonathan Neale in seinem 2004 veröffentlichten Buch über „Den amerikanischen Krieg in Vietnam“ meint: Wen immer die Soldaten töteten – es war der richtige! Von der anderen Seite aus hat Erich Wulff diese Entwicklung beschrieben: Am Anfang war der „Vietkong“ fast ein Phantom, aber nach und nach nahmen immer mehr Leute aus seiner Umgebung in Hué Kontakt mit der Befreiungsfront auf, die irgendwo „da draußen“ auf dem Land bzw. im Dschungel war. Sie „beschafften Informationen oder transportierten Medikamente ins Maquis“. Die „befreite Zone“ war bald nur noch 10 Kilometer von Hué entfernt. „Das Maquis war nicht mehr, wie 1964, ein Kuriosum, wo man seine Neugierde befriedigte. Es wurde immer mehr zum geistigen, politischen und organisatorischen Zentrum für die Orientierung der Menschen in der Stadt“.
In Vietnam gibt es eine Reihe von kleinen Bergvölkern, die u.a. von der Jagd leben. Sie verließen als erste die ‚Linie‘ der Gewaltlosigkeit, woraufhin die Regierungstruppen sie mit Vernichtungsfeldzügen überzog. Die Dörfler wehrten sich mit alterprobten Mitteln: Bodenfallen, die mit Bambusspießen gespickt waren, Fallstricke, die Steinlawinen auslösten, an Seilen schwingende „Morgensterne“ und vergiftete oder brennende Pfeile, die von einer Armbrust abgeschossen wurden. Auch Bienen kamen zum Einsatz: Dazu wurden einige Stöcke am Wegrand aufgestellt und die Ausflugslöcher mit Papierstückchen zugeklebt, von denen Fäden über den Weg führten. Wurden diese von Soldaten zerrisen, kamen die Bienen frei und stürzten sich wütend auf sie. Daneben lernten die Kämpfer, die Pflanzen, Insekten und Großtiere des Waldes zu Heilzwecken zu nutzen.
Zu den aufständischen Bergvölkern gesellten sich die Buddhisten, die ebenfalls von der Regierung verfolgt wurden sowie die Reste einiger Sekten, die untergetaucht waren und sich zu kriminellen Banden gewandelt hatten. Zusammen mit den Partisaneneinheiten bildeten sie bald eine „Nationale Front“, aus den bewaffneten Sekten entstand die Keimform einer „regulären Armee“, die Führung blieb jedoch bei den Bauern, die sich zu wahren Herren auf dem Land aufschwangen – immer mehr Dörfer schlossen sich zu „befreiten Gebieten“ zusammen. Selbst Stützpunkte der Regierung zur Kontrolle bestimmter Abschnitte waren in Wirklichkeit umzingelt vom Vietkong, der darüber entschied, welche Versorgungsgüter zu den Soldaten gelangen durften und welche nicht. Bei den Soldaten handelte es sich zumeist um zum Wehrdienst gezwungene junge Bauern, die die Partisanen auf diese Weise langsam für sich gewinnen wollten, mindestens wollten sie Informationen über bevorstehende Angriffe, Truppenverlegungen usw. von ihnen bekommen. Dies nannte man eine Politik des „Zukorkens“ feindlicher Posten.
Ähnlich war es bei den „strategischen Dörfern“, in die man die Bauern reinzwang, vorher wurden ihre alten Dörfer zerstört bzw. zerbombt, ihre Gärten und Reisfelder vergiftet. 16.000 solcher „Wehrdörfer“ wollte die Diem-Regierung errichten, es wurden aber nur einige tausend – und selbst unter diesen befanden sich bald viele in Wahrheit ganz oder zumindestens nachts in den Händen des Vietkong. In den Städten, wo nicht demonstriert werden durfte, benutzten die Propagandatrupps der Nationalen Front Affen, denen sie Hemden überzogen, auf denen Parolen standen. Die so ausstaffierten Tiere, manchmal kamen auch Hunde zum Einsatz, wurden dann auf den Marktplätzen freigelassen.
Immer wieder waren Partisanengruppen gezwungen, buchstäblich in den Untergrund auszuweichen oder sich mindestens darauf vorzubereiten: Das war im hussitischen Tabor der Fall, aber auch im Zweiten Weltkrieg in Odessa sowie bei den Aufständen in Warschau und Paris. In Vietnam gruben sich die Bauern weitverzweigte „Tunnelsysteme“, mit denen Dörfer und ganze Bezirke verbunden wurden und die teilweise sogar bis unter die Stützpunkte der Regierungstruppen führten. Wie ein Sprecher der Nationalen Befreiungsfront meinte, „war das Land gleich einem an Masern Erkrankten mit Militärstützpunkten und Forts übersät, aber das Regime hatte keinen Stützpunkt im Herzen des Volkes – ganz im Gegensatz zur Befreiungsfront“. Es gibt dafür fast ein Partisanengesetz: „Der Unterschied in der Feuerkraft wird durch den Unterschied in der Moral aufgehoben“.
Die großenteils gepressten Soldaten reagierten darauf, auch in anderen, ähnlichen Volksaufständen war das so, mit „Kriegsneurosen“, d.h. mit so schwerwiegenden Krankheitssymptomen, dass sie von weiteren Fronteinsätzen verschont blieben. Henry Kissinger schreibt in seinen Memoiren, die Antikriegsdemonstrationen und die internationale Solidarität mit den Vietnamesen führten dazu, dass Washington mehr und mehr „den Charakter einer belagerten Stadt“ annahm...“das gesamte Regierungsgefüge fiel auseinander. Die Exekutive litt unter einer Kriegsneurose.“ Ähnliches kann man im übrigen auch von der deutschen Sozialdemokratie sagen: Während der Kanzler Willy Brandt sich weigerte, irgendetwas auch nur Nachdenkliches über Vietnam zu Protokoll zu geben, demonstrierte Gerhard Schröder als Juso „Ho Ho Ho Chi Minh“-rufend auf der Göttinger Roten Straßer rauf und runter, wie einer der vietnamesischen „Boat-People“ noch 2001 in Westberlin auf einer Veranstaltung bitter bemerkte.
Bereits Ende 1964 übte die Befreiungsfront faktisch die Regierungsgewalt in Südvietnam aus: Es gab Ausschüsse für das Gesundheitswesen, Volksbildung, Post- und Fernmeldewesen, für Wirtschafts- und für Auswärtige Angelegenheiten – mit Vertretungen in Havanna, Kairo, Algier, Prag und Ostberlin, und eine eigene Nachrichtenagentur. Dazu kamen bald noch hunderte von Filmteams, die bei fast allen Aktionen dabei waren. Am Ende des Krieges hinterließen sie hunderte von Dokumentarfilme und mehrere Millionen Meter ungeschnittenes Material, das von dem zum vietnamesischen Militär gehörenden Film-Institut verwaltet wird. Neuerdings kooperiert es bei der Auswertung mit der deutschen DEFA-Stiftung.
Ende 1965 befand sich der Psychiater Erich Wulff in Saigon: „Die amerikanischen Beamten, die deutschen Soldaten, die meisten Journalisten, die ich kannte, schwammen während dieser Zeit auf einer Woge von rosigem Optimismus. Sie sahen täglich neue Hubschrauber und neue Soldaten ins Land strömen und waren vom schieren Gewicht und von der augenscheinlichen Perfektion der amerikanischen Militärmaschinerie geradezu hingerissen.“ Sogar die Distrikt- und Provinzchef waren bald Amerikaner. Auch einer der Kommandeure der Befreiungsfront, Truong Ky, bemerkte um diese Zeit: „Jetzt geht die Tendenz dahin, dass die Operationen eine rein amerikanische Angelegenheit werden.“ Er war jedoch ebenfalls optimistisch: „Auch das wird nicht klappen, denn die Amerikaner sind in dem Widerspruch zwischen ihren ‚Vernichtungs-‚ und ‚Befriedigungs‘-Projekten verstrickt, die die beiden Hauptlinien ihrer militärpolitischen Strategie ausmachen“.
Hinzu käme noch, laut Truong Ky, dass sie sich sowohl in der Planung als auch im Kampf einem „Subjektivismus“ hingäben, der sie dazu verleite, ihre eigene Stärke ständig zu überschätzen und die der Befreiungsfront zu unterschätzen. Das führte zu immer unwirklicheren Statistiken bzw. Zahlenspielen, „Body-Count“ oder „Kill-Rate“ genannt, und zu absurden Verlautbarungen: So erklärte z.B der diensthabende Offizier eines Einsatzes gegen Ben Tre im Mekongdelta der internationalen Presse: „Um die Stadt zu retten, mussten wir sie zerstören!“
Dann kam im Januar die Tet-Offensive – und es wurde allen klar, dass der amerikanische Krieg in Vietnam nicht mehr zu gewinnen war. Jonathan Neale schreibt: „Dennoch erlitten die Guerillos eine vernichtende Niederlage. Sie hatten erwartet, dass Saigon und Hue sich erhöben. Dazu kam es nicht.“ Der für den kommunistischen Untergrund in Saigon verantwortliche Tran Bach Dong erklärte später, warum: Ihre Mitgliedergewinnung war „wunderbar erfolgreich“ – bei den Intellektuellen, Studenten, Buddhisten, bei allen – nur bei den Arbeitern nicht, wo der Organisationsgrad „schlechter als schlecht“ war. Das lag nicht nur an der Konzentration der Partei auf die Organisierung der Bauern, die die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung bildeten, sondern auch an der amerikanischen Militärstrategie, die mit ihren Bombardements und Entlaubungsaktionen eine wachsende Zahl von Flüchtlingen produzierte, die in die Städte drängten und dort bei den Amerikanern oder in ihren Vergnügungsbezirken Arbeit fanden.
Das war auch von den Amerikanern gewollt: Man sprach in diesem Zusammenhang offziell von einem in Vietnam längst überfälligen „Urbanisierungs-Prozeß“ und hoffte, die Bauern auf diese Weise wenn schon nicht an sich zu binden, dann wenigstens „lumpenproletarisch“ zu neutralisieren. Laut Jonathan Neale gelang dies aber auch deswegen z.T., weil die Befreiungsbewegung die städtischen Arbeiter nur halbherzig gegen ihre Chefs mobilisieren konnten, um nicht die „Unterstützung der Geschäftsleute und Manager dort zu verlieren“.
Nichtsdestotrotz: „Während die Guerilleros nach Tet ausbluteten, wurde in Amerika die Entscheidung getroffen, den Krieg zu beenden.“ Insofern war die Tet-Offensive Höhepunkt und damit der Anfang vom Ende des vietnamesischen Befreiungskampfes, der offiziell jedoch erst 1975 mit der Einnahme von Saigon endete. Kurz zuvor hatten die Nordvietnamesen zwei kleinere Offensiven bei Hué eingeleitet, woraufhin den Regierungstruppen befohlen wurde, sich zurückzuziehen. Auf diesem Rückzug brach die südvietnamesische Wehrpflichtigenarmee auseinander – „sie war moralisch am Ende“.
Nach dem Sieg konnten die Kommunisten daran gehen, das Land wieder aufzubauen und vor allem zu industrialisieren. Dies ging jedoch nur auf dem Rücken der Bauern sozusagen, die mit ihren Agrarprodukten eine „ursprüngliche sozialistische Akkumulation“ ermöglichen sollten. Wenn man sie jedoch dafür höher besteuern wollte, reduzierten sie die Anbauflächen. Also versuchte man sie in Kooperativen bzw. Kolchosen zusammen zu fassen, aber sie weigerten sich. Im Dorf Binh My, schreibt Jonathan Neale, „übten die Parteikader unablässig Druck aus. Einige suchten sie 20 mal auf, erzählte ein Kader, so häufig, dass der Haushund sie inzwischen kannte und nicht mehr bellte.“ Im Mekongdelta bei Ben Tre errichteten die Kommunisten eine Vorzeigekooperative, aber die Bauern brannten sie nieder. Im Jahr 1987 gab die Regierung ihre Niederlage zu, es war ihr nicht einmal gelungen, die Kontrolle über den Reishandel zu erlangen.
Aufgrund ihres langen Befreiungskampfes, erst gegen die Franzosen, dann gegen die Japaner und schließlich gegen die Amerikaner, waren die vietnamesischen Bauern außerordentlich selbstbewußt geworden. Als dann noch China seine Wirtschaftshilfe einstellte, sowie 1989 auch noch die Sowjetunion, führte die Regierung offiziell den „Neuen Wandel“ – Doi Moi – ein, d.h. die Martkwirtschaft unter ihrer Führung. Vietnam entwickelte sich dabei zum drittgrößten Reisexporteur der Welt. Dies hatte jedoch zur Folge, dass sich immer mehr Bauern verschuldeten, dass die ärmsten ihr Land verkauften. Aus ehemaligen Kooperativvorsitzenden wurden reiche Bauern, die anfingen, Landarbeiter zu beschäftigen. Es begann mithin das, was man in Mitteleuropa bis heute „Bauernlegen“ nennt, also ein Konzentrationsprozeß in der Landwirtschaft, der nun erneut mit einer „Urbanisierung“ einhergeht.
Die Linke hatte sich schon lange vorher, spätestens nach dem Sieg der Befreiungsbewegung in Saigon 1975 von den vietnamesischen Partisanen abgewendet – und diese waren danach ja auch – wenn sie nicht wieder Bauern wurden – Regierungsbeamte bzw. Funktionäre geworden. In Norwegen, wo ebenfalls ein erfolgreicher Partisanenkrieg (gegen die Deutschen) geführt wurde und die Solidarität mit Vietnam sehr verbreitet war, veröffentlichte der Schriftsteller Johan Harstadt 2004 eine Erzählung, die „Vietnam. Donnerstag“ betitelt ist. Darin heißt es an einer Stelle: „Er“ verbindet mit dem Wort Vietnam „Reisfelder, Dschungel, Hubschrauber“. Sie dagegen sagt: „Vietnam steht für alles, was schief gegangen ist“.
1967 wollte Thomas Brasch in der Ostberliner Volksbühne einen „Vietnamkongreß“ veranstalten: „Seht auf dieses Land“, titelte er dafür. Der Kongreß wurde aber nicht erlaubt. 30 Jahre nach Beendigung des Krieges, hat die Volksbühne jedoch seine Idee wieder aufgegriffen – und veranstaltete am 16. Oktober 2005 einen „Vietnam Tag“, wobei sie sich u.a. für die vietnamesischen Opfer des militärischen Einsatzes von Entlaubungsgiften einsetzen wollte. In den letzten Jahren gab es mehrere Initiativen von Vietnamesen, die durch den Einsatz von Agent Orange bei der Bombardierung ihres Landes gesundheitlich geschädigt wurden.
Im Februar 2004 z.B. eine Sammelklage von 100 „Agent Orange“-Opfern gegen 37 US-Firmen, die der Armee das Dioxin geliefert hatten, darunter „Monsanto“ und die US-Tochter von Bayer „Mobay“. Zuvor hatte bereits der US-Anwalt Ed Fagon eine Klage gegen Bayer im Namen einiger südafrikanischer Dioxin-Opfer angestrengt, wobei es zu einem Vergleich gekommen war. Und der US-Anwalt Kenneth Feinberg hatte mehrere Klagen von US-Soldaten betreut, die dem Einsatz von Dioxin im Vietnamkrieg ausgesetzt gewesen waren. Im März 2005 verklagte der Bauingenieur Ngoc einige Dioxin-Hersteller vor dem US-Bundesgericht in Brooklyn: Seine Schwester war verkrüppelt zur Welt gekommen, nachdem ihr Vater mit Agent Orange in Kontakt gekommen war. In der Schweiz unterstützten 49 Parlamentarier diese Klagen, sie verlangten vom Bundesrat, auf die US-Regierung einzuwirken, damit die vietnamesischen Agent-Orange-Opfer endlich entschädigt würden. Wenig später gab es eine weitere flankierende Maßnahme dazu – im Internet und aus Vietnam selbst. Sie nennt sich „Justice for Victims of Agent Orange“. Verfaßt wurde sie von Len Aldis – im Namen der „Englisch-Vietnamesischen Freundschaftsgesellschaft“, aber unterschrieben haben bisher vor allem Vietnamesen – bis jetzt 690933. Dahinter steht die Anfang 2004 gegründete Hilfsorganisation VAVA: „Viet Nam’s Association for Victims of Agent Orange“ – und ihr Vorsitzender Dang Vu Hiep. Die VAVA arbeitet mit den US-Veterans for Peace, dem amerikanischen Roten Kreuz und dem „Fund for Reconciliation and Development“ zusammen, um die Lebensbedingungen für Dioxin-Opfer in Vietnam zu verbessern. Die vietnamesische Botschaft in den USA erklärt dazu, dass etwa 3 Millionen Vietnamesen an den Spätfolgen des Agent-Orange-Einsatzes leiden. Zwischen 1961 und 1971 versprühten die Amerikaner 80 Millionen Liter giftige Chemikalien über Vietnam. Noch 1985 hatte der US-Wissenschaftler Alwin Young dazu auf einem „Dioxin-Kongreß“ in Bayreuth erklärt: „Der Dioxin-Einsatz hat niemandem geschadet!“
Nach dem Besuch des „Vietnam-Kongresses“ in der Volksbühne nahmen sich einige Freunde von mir vor: „Nächstes Jahr machen wir in Vietnam Urlaub.“ So hatte man sich die mobilisierende Wirkung dieser Veranstaltung eigentlich nicht vorgestellt! Aber solche Privatinteressen haben jetzt Vorrang. Auf dem 1. Vietnam-Kongreß, der 1968, wenige Wochen nach der Tet-Offensive in Westberlin stattfand, war es noch darum gegangen, zwischen Saigon und Berlin eine Front zu bilden – durch In- und Extensivierung der Kämpfe hier. Dort siegten 1975 zwar die Kommunisten, hier übernahm jedoch 1990 die westdeutsche Treuhandanstalt das Regime, politisch flankiert ausgerechnet von West-„68ern“, die sich dazu allerdings zu Menschenrechtlern, Pluralismusverfechtern und geharnischten Antistalinisten gewendet hatten, und nun von „asymetrischen Kriegen“, „Terror auf beiden Seiten“ und dem „Stalinisten Ho Chi Minh“ sprachen: Auch auf dem Vietnam-Kongreß der Volksbühne. Dieser fand erstmalig unter großer Beteiligung der Vietnamesen selbst statt.
Man hätte also gut und gerne das Problem, dass jetzt statt harter Strategien und Klassenkämpfe eher weiche Diskurse und Kompromisse bevorzugt werden, auch miteinander besprechen können – mindestens im Hinblick darauf, was dies für die Einschätzung des vietnamesischen Befreiungskampfes und seiner Resultate bis heute bedeutet. Und das um so mehr, da es bereits im Vorfeld der Volksbühnenveranstaltung diesbezüglich zu Konflikten gekommen war.
Zuerst störten sich einige teilnehmende vietnamesische Initiativen am Blumenarrangement im Foyer, das die nord- und die südvietnamesische Fahne zeigen sollte. Die in West und Ost-Berlin lebenden Vietnamesen sind wahrscheinlich die einzige ausländische Minderheit, die sich 1989 nicht wiedervereinigte: im Westen lebten kurz gesagt die Boat-People (Flüchtlinge) und im Osten der Vietkong (Vertragsarbeiter). Diesen Umstand wollte die Volksbühne „thematisieren“ – natürlich von vietnamesischen Blumenkünstlern gestaltet. Die Gründerin des vietnamesischen Selbsthilfevereins „Reistrommel“ in Marzahn, Tamara Hentschel, zog daraufhin ihre Teilnahme zurück: Das Arrangement sei so geschmacklos, als würde man neben eine BRD-Fahne eine Nazi-Flagge hängen. Die Tanzgruppe ihres Vereins wollte trotzdem mitmachen. Hier waren es dann aber zwei Eltern, die ihren Kindern das verwehrten – vor allem, weil die Volksbühne dann nicht nur die Menschenrechtlerin Kim Phuc einlud (sie war einmal von der Illustrierten stern „gerettet“ worden, nach einem Napalm-Angriff der Amis auf ihr Dorf, bei dem sie schwer verwundet worden war – und ihr Schicksal hatte damals Millionen gerührt, wie man so sagt, nun war sie jedoch, in Kanada lebend, zu einer engagierten Antikommunistin geworden). Daneben wollte man auch noch mit Bui Tin diskutieren, den in Paris lebenden und heute bekanntesten vietnamesischen Regimegegner. Damit machte die Volksbühne der vietnamesischen Botschaft in Berlin keine Freude – und auch vielen in Ostberlin lebenden Vietnamesen nicht, die sogar von Radio Multikulti nichts hören wollen: „Das ist doch der Sender, der Ho Chi Minh so schlecht gemacht hat!“
Nach Bui Tins Auftritt kam es zu Beschimpfungen – zwischen seinen Fans und seinen Gegnern. Ähnliches geschah auch nach Jürgen Kuttners Rederunde, in der die prokommunistischen Ostler sich anschließend mit den antikommunistischen Westlern stritten. So war das auch von Kuttner „angedacht“ worden, der den Dissenz suchte. Den eher nach Harmonie strebenden Vietnamesen stößt eine Inszenierung derselben jedoch eher ab. Vielleicht sollte man beim nächsten Vietnam-Kongreß darauf dringen, dass sie die Formen der Auseinandersetzung planen.
Viele der jungen, hier aufgewachsenen Vietnamesen schienen mir jedoch großen Gefallen gerade an dieser „Culture of Clash“ gefunden zu haben – und ihre eigenen Beiträge, z.B. ein Film von und mit einigen Schülerinnen, gehörten dann auch mit zu den besten Programmpunkten der 13stündigen Veranstaltung. Man kommt sich also doch von Mal zu Mal näher – aber nur gleichsam zwangsläufig – über die Generationenfolge. Wie nahe man sich jedoch damals im Kleinkrieg gekommen war, blieb unerörtert.
.
Vietnamesische Zimtsandalen – „Military Flip Flops“ genannt
.
(****) Jahr für Jahr geben die Vereinigten Staaten Millionen US-Dollar für einen Regime-Change in Kuba aus. Wie der US-Journalist Tracey Eaton nun enthüllte, soll der Geldsegen für Gruppierungen, die einen »Wandel« auf der Insel vorantreiben wollen, unter dem neuen Präsidenten Joseph Biden sogar erhöht werden. Bis zum Jahr 2023 seien dafür mehr als 67 Millionen US-Dollar (55 Millionen Euro) vorgesehen, berichtete Eaton vergangene Woche in seinem Blog »Cuba Money Project«.
»Ein weitverzweigtes Netzwerk von Gruppen, die von der US-Regierung finanziert werden, schickt jedes Jahr Geld an Tausende von kubanischen Demokratieaktivisten, Journalisten und Dissidenten«, schrieb der mehrfach ausgezeichnete Autor Eaton, der von 1994 bis 2005 die Büros der Tageszeitung Dallas Morning News in Mexiko und Kuba geleitet hatte. Nach Rückkehr in die USA gründete er, mittlerweile Leiter des Fachbereichs Kommunikation am angesehenen Flagler College in St. Augustine (Florida), das »Cuba Money Project«, das in Kuba ausgegebene US-Steuergelder untersucht.
Dass US-Behörden versuchen, die eigenen Ausgaben zu verschleiern, erschwert die Recherchen. So hätten das US-Außenministerium und die dieser Behörde unterstehende »Agentur für Internationale Entwicklung« (USAID) ihm auf Anfragen schriftlich mitgeteilt, dass ihre »Strategien zum Aufbau von Demokratiebewegungen als Geschäftsgeheimnisse betrachtet werden und von der Offenlegung unter dem Freedom of Information Act (FOIA) ausgenommen sind«. Auch die große Anzahl von Organisationen, die in Kuba tätig sind, machte es extrem schwierig, die Finanzierung von systemfeindlichen Aktivitäten, Veranstaltungen und Dissidentengruppen auf der Insel durch Washington im Einzelfall nachzuweisen, betont der US-Journalist.
Trotzdem ist es Eaton gelungen, einige der vom Weißen Haus und dem State Department gehüteten Geheimnisse zu lüften. So fand er heraus, dass seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2017 mindestens 54 Gruppen Geld von USAID und der staatlich geförderten Stiftung »National Endowment for Democracy« (NED) für »Kuba-Programme« erhalten haben, die in der Regel für einen Zeitraum zwischen einem und drei Jahren angelegt sind. Eaton listete die Organisatoren der meist subversiven Programme namentlich auf und veröffentlichte eine Grafik, nach der eine Auswahl dieser Gruppen seit 2017 mehr als 16,5 Millionen US-Dollar allein von USAID an »Zuschüssen« für ihre Aktivitäten erhalten habe. Im zeitlichen Zusammenhang mit den aktuellen Protestaktionen der »San Isidro-Gruppe« in Havanna habe das US-Außenministerium am 24. November eine weitere Million Dollar für Programme zur Verfügung gestellt, die in Kuba »bürgerliche, politische, künstlerische und Arbeitsrechte« stärken sollen.
Für die Zeit nach Trump wollen die US-Dienste den Recherchen zufolge die Finanzierung von Systemgegnern und deren Aktionen auf der Insel stark erhöhen. So hat USAID bis zum Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von mehr als 67 Millionen US-Dollar eingeplant. Zwar könnte dieser Betrag, der noch vom Kongress bewilligt werden muss, am Ende etwas geringer ausfallen, doch weist Eaton darauf hin, dass in der von ihm recherchierten Summe für die 54 Organisationen noch nicht die Gruppen enthalten sind, die eine geheime Finanzierung erhalten. Das US-Außenministerium, USAID und NED hätten eingeräumt, dass sie »undisclosed« (nicht bekanntgegebene) und »miscellaneous« (sonstige) Vertragspartner haben, deren »Namen nicht veröffentlicht werden«. (aus: Junge Welt v. 17.12.2020)
.
.
(*****)
In der
Berliner Akademie der Künste der Welt fand 2018 eine größere Ausstellung mit dem Titel „Floraphilia – Plants as Archives“ statt, die von Aneta Rostkowska kuratiert wurde. In der Ankündigung hieß es:
„Bei genauer Betrachtung der Geschichte der Menschheit stellen wir fest, dass verschiedene Pflanzen das menschliche Leben in großem Maße beeinflusst haben. Opium, Baumwolle, Kaffee, Zuckerrohr, Cinchona, Kautschuk und viele andere Pflanzen formen, jede auf ihre eigene Art, einzigartige organische Archive sozialer, wirtschaftlicher und politischer Prozesse.
Besonders in der Geschichte des europäischen Kolonialismus haben Pflanzen eine entscheidende Rolle gespielt. Ihr Transport aus den und in die Kolonien war Quell von großem finanziellem Profit. Die Kolonien dienten als perfekte Orte, um tropische Pflanzen heranzuziehen, die in einem europäischen Klima nicht wachsen konnten. Sie halfen, Märkte zu etablieren, während die Kolonisatoren von der Monopolisierung des Handels, der Einführung von Importsteuern und der Lizenzierung von Exporten profitierten.
Die Botanik als Wissenschaft und botanische Gärten als Orte, an denen dieselbe blühte, waren essentiell für die koloniale Ausübung militärischer Macht. Botanische Gärten ermöglichten das Sammeln von Pflanzen und ihre Erforschung, Vermehrung und Transformation und machten sie zu wichtigen Werkzeugen der kolonialen Aneignung. Botaniker untersuchten die Notizen von Händlern, von denen sie später Samen und Exemplare erhielten. Sie schickten ihre Schüler in weite Teile der Welt, um Pflanzen zu sammeln. Carl Linnaeus, ein im achtzehnten Jahrhundert lebender Schwede, schickte etwa zwanzig. Unterstützt wurden sie dabei von den europäischen Monarchen – zwischen 1760 und 1808 entsandte der spanische König 57 Expeditionen zur Erforschung der Flora der spanischen Kolonien.
Und obwohl der Kolonialismus offiziell vor Jahrzehnten beendet wurde, fußt der gegenwärtige Reichtum der westlichen Gesellschaften zu einem großen Teil auf der fortgesetzten Ausbeutung ehemaliger Kolonien, nun im Namen der Ideologie des „freien Marktes“.
Die Ausstellung
Floraphilia. Plants as Archives
soll die sozialen und politischen Aspekte der Geschichte der Pflanzen, der Botanik und des botanischen Gartens beleuchten. Die künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung thematisieren in unterschiedlicher Weise die Vereinnahmung von Pflanzen in der Kolonialgeschichte und in der Geschichte im Allgemeinen sowie ihre ökonomischen, feministischen und Migrationskontexte. Sie ermutigen uns, die gemeingültige Vorstellung von der Pflanze als mechanistisches Ding, das nur auf einfache Reize reagiert, abzulehnen und führen uns zu einer Perspektive, die die signifikante Kontinuität zwischen Menschen und Pflanzen hervorhebt; Pflanzen, die – dynamisch, atmend und wachsend – Intentionalität und sogar Erinnerung besitzen.“
Die Ausstellung „Floraphilia. Über die Verflechtungen von Pflanzenwelt, Botanik und Kolonialismus“ wurde von der Kulturstiftung des Bundes gefördert.
.
.
Erwähnt sei noch eine weitere Ausstellung – in Hamburg: „
Amani
. Auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation“:
Ende des 18. Jahrhunderts wurden „exotische“ Pflanzen in Europa Mode. Zunächst konnten sich nur Reiche, vor allem die Kolonien besitzenden Engländer, diesen Spaß leisten. Sie hatten jedoch – wenigstens in den Städten – wenig Glück mit ihren Zimmer- und Gartenpflanzen, denn alles war voller „schädlicher Staub- und Rußablagerungen“. Die sündhaft teuren Pflanzen siechten dahin.
1829 sann der Arzt und Pflanzenliebhaber Nathaniel Ward auf Abhilfe: Er baute ein gläsernes „Zimmergewächshaus“: den „Wardian Case“, wie die Kulturwissenschaftlerin Mareike Vennen in ihrem Buch „Aquarium“ schreibt; sie geht davon aus, dass das abgedichtete Pflanzenglas Vorläufer des gläsernen Fischbeckens ist. Andere Aquarienhistoriker gehen davon aus, dass sie sich aus den chinesischen Goldfischbecken einige Jahrhunderte v. Chr. Entwickelt haben.
Zur Kolonialzeit wurden die Pflanzen per Schiff nach Europa gebracht, was wochenlang dauerte und was die meisten Pflanzen nicht überlebten. „Matrosen sind keine Gärtner“, so beschreibt der Zürcher Landschaftsarchitekt Hansjörg Gadient das Problem. Erst als man auch an Bord kleine Glashäuser errichtete und z. T. Gärtner mit auf Transport schickte, sanken langsam die Preise für exotische Pflanzen.
Eine der ersten Pflanzen, die Deutschland aus seinen Kolonien „heim ins Reich“ brachte, war das Usambaraveilchen. Angeblich brachte der Afrikareisende Graf von Pückler das erste nach Berlin. Das Usambaraveilchen ist nicht mit den Veilchen verwandt, es heißt nur so, weil seine Blüten veilchenfarbig sind. Man zählt es zu den Lippenblüterartigen, von denen etliche Zierpflanzen wurden.
Das Usambaraveilchen lässt sich leicht züchten, wild gibt es sie noch immer in den Usambarabergen des heutigen Tansania, das einst Deutsch-Ostafrika hieß, wo die Deutschen 1902 in den Usambarabergen das biologische Institut Amani gründeten, das bald auch Anlaufstelle für deutsche Missionare war. Von dort gelangte die Blume immer wieder mal als Souvenir der Wissenschaftler nach Deutschland.
Das Institut war ab 1902
das wichtigste Institut der Kolonien, das explizit Malaria und Landwirtschaft erforschte.
Petra Schellen von der taz Hamburg schrieb Anfang des Jahres über eine
Amani-
Ausstellung im Hamburger ethnographischen Museum MARKK:
Grund
für die Einrichtung des Instituts
i
n den Usambarabergen „
war das für Europäer angenehm kühle Klima in der einstigen Missionars-Erholungsstation. Gegründet als Konkurrenz zum niederländischen Institut auf Java, sollte
Amani
eruieren, wie man die Kolonie stärker ausbeuten und Tropenkrankheiten bekämpfen könne. Letzteres ausschließlich zum Wohl der Europäer, die plötzlich mit Sumpffieber und Schlafkrankheit konfrontiert waren. Auch wollte man in
Amani d
ie Botanik aller Kolonien zeigen, getrieben vom Sammlerstolz des Herrschenden.“
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mußte Deutschland seine Kolonien an England abtreten. „1970 erst, neun Jahre nach Tansanias Unabhängigkeit, wurde mit Phillip Wegessa ein Afrikaner Chef des Instituts. Zusammengebrochen ist die Forschungsstätte Ende der 1970er-Jahre, als die East African Community im Tansania-Uganda-Krieg zerfiel und Großbritannien kaum noch Geld schickte. Heute stehen die Gebäude leer, geforscht wird anderswo. Aber einige ehemalige Assistenten erhalten Amani als quasi-musealen Ort. Diese Ambivalenz hat den Sozialanthropologen Wenzel Geissler von der Universität Oslo interessiert, als er zwischen 2013 und 2016 mit einem internationalen Team aufbrach, um mehr über den Umgang der Einheimischen mit materiellen Resten des Kolonialismus zu erfahren. Ehemalige Chefs und ehemalige Assistenten hat er nach Erinnerungen und Gefühlen gefragt und zu „Veteranentreffen“ eingeladen.
Herausgekommen sind Tonaufnahmen, Fotos und Videos. Sie bilden den Kern der Amani-Schau im Hamburger Museum. Chefin Barbara Plankensteiner will so auch jene Museumsexponate beleuchten, die aus Amani stammen. Für eine harte Kolonialismus-Debatte ist Amani allerdings nur bedingt geeignet, denn es war kein Ort extremer Gewalt oder von Versklavung, wie die Plantagen. Es hat dort keine Revolten wie den ‚Araber-Aufstand‘ von 1936 gegeben, an dessen Niederschlagung sich der Afrikaforscher Franz Stuhlmann beteiligte, der spätere Amani-Leiter.
Aber natürlich herrschte in Amani strukturelle Ungleichheit, denn bis zur Unabhängigkeit waren die Chefs weiß und die Assistenten schwarz. Dass die Afrikaner bis 1961 keine Wissenschaftler werden konnten, habe daran gelegen, dass das koloniale Bildungssystem nicht auf solche qualifizierten Abschlüsse ausgerichtet gewesen sei, sagt Geissler. Auch hätten weiße Chefs die Assistenten vor der Unabhängigkeit gelegentlich angeschrien oder gar geohrfeigt.
Niemand spricht heute mehr von den Abrissplänen der 1970er-Jahre. Vielmehr wollen die Einheimischen diesen Ort bewahren, der viele Forscher prägte und für Afrikaner der 1960er-Jahre trotz allem eine Jobchance bot. Heute hat Amani noch rund 30 bezahlte Angestellte – Gärtner, Reinigungskräfte und Wärter, die aufpassen, dass niemand etwas demoliert oder stiehlt. Tatsächlich stehen da noch die hölzernen Labortische von einst, und den Schrank mit den Tsetsefliegen-Kästen sichert ein Vorhängeschloss.“
Zu den deutschen Wissenschaftlern, die einst im Amani-Institut arbeiteten, gehörte auch
der
Mediziner Robert Koch.
Er
erforschte dort Mittel gegen das „Tropenfieber“, das von der Malariamücke übertragen wird. Um sie zu bekämpfen, ließ Koch Bäume und Büsche an den Flussufern fällen und sogar die einheimische Bevölkerung
umsiedeln, um sie
in Lagern zu konzentrieren.
Diese erfanden dagegen das „Maji-Maji“, ein magisches Wasser, das die antikolonialen Kämpfer im „Maji-Maji-Aufstand“ benutzten. Dem Erfinder dieser „Medizin“, die gegen die Kugeln der Weißen schützen sollte, indem sie den Krieger unsichtbar machte, hat Tansania heute ein Denkmal gesetzt. Man nennt ihn den „Propheten Kinjiketile“, er verfügte damals über viele „Boten“, die die „Kriegsmedizin“ über alle Stämme verteilten – und so im Kampf gegen die Deutschen erstmalig vereinigten.
Die Niederschlagung ihres antikolonialen Aufstands oblag dem „Reichskommissar für das Kilimandscharogebiet“, Dr. Carl Peters, einem Massenmörder, den man in Deutschland nicht umsonst „Hängepeters“ nannte. Auch er beehrte wiederholt das Amani-Institut.
Im Berliner „Afrikanischen Viertel“ benannte man eine Allee nach ihm. Als sich 1983 der tansanische TU-Student Mnyaka Sururu Mboro über den „Kolonialpolitiker“ Carl Peters kundig machte und gegen die Straßenbenennung protestierte, änderte man gnädig den Hinweis unter dem Straßenschild: Die Petersallee war fortan dem Weddinger „CDU-Politiker Hans Peters“ gewidmet. Nun heißt sie aber demnächst „Maji-Maji-Allee“.
Rechtzeitig zu Beginn der Impfmaßnahmen gegen Corona, die von Impfpflicht-Sprüchen und Maßnahmenandrohungen gegen Impfverweigerer von den Politikern und dem Robert-Koch-Institut (RKI) begleitet wurde, sendete er Deutschlandfunk ein mutiges Feature von Julia Amberger über „Robert Koch und die Verbrechen von Ärzten in Afrika“.
Zusammengefaßt heißt es gleich am Anfang: „Zu Kolonialzeiten war es üblich, dass Forscher skrupellos mit Afrikanern experimentierten, allen voran die Deutschen. Auch Robert Koch zwang kranke Menschen in Konzentrationslager und testete an ihnen neue Gegenmittel. Die Gräueltaten der kolonialen Tropenmedizin wirken bis heute.“
In vielen afrikanischen Ländern besteht deswegen eine starke Abneigung gegen das Impfen mit Serum von den Weißen: „Die Wurzeln des Misstrauens liegen in der Kolonialzeit, als europäische Ärzte Menschen in Afrika zu Forschungszwecken missbrauchten“ – aus Karrieregründen.
„‘
Am meisten hat mich bei diesen Forschungen überrascht, dass es vielen dieser jungen Ärzte gar nicht so sehr um die Verbesserung der Lebensbedingungen an der kolonialen Peripherie ging, sondern dass sie ehrgeizigere Pläne hatten, nämlich in die Forschung einzusteigen und Medikamente an der kolonialen Peripherie auszuprobieren. Das heißt also, afrikanische Forschung an der Peripherie für Präparate, die im Mutterland eingesetzt werden sollten,‘ sagt Professor Wolfgang Eckart, ehemaliger Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Er war der erste deutsche Wissenschaftler, der die Gräueltaten deutscher Ärzte in den ehemaligen afrikanischen Kolonien rekonstruierte und 1997 publizierte, in dem Buch ‚Medizin und Kolonialimperialismus – Deutschland 1884 bis 1945‘.“
„
Die Medizin
spielte bei der Kolonialisierung Afrikas also eine Schlüsselrolle. Ohne ihren Fortschritt hätte Afrika nie erkundet und ausgebeutet werden können. Die renommiertesten Tropenmediziner kamen damals aus Deutschland, allen voran der Nobelpreisträger Robert Koch.“
1906 zog er im Auftrag der deutschen Reichsregierung für zwei Jahre auf die Sese-Inseln im Viktoriasee. Dort fand er einen Seuchenherd für die Schlafkrankheit, die in nur wenigen Jahren eine Viertelmillion Menschen im heutigen Uganda dahingerafft hatte.“
Edna Bonhomme vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin hat sich mit Robert Kochs Forschungsprojekten in den ehemaligen Kolonien befasst.
Die Schlafkrankheit, die von der Tsetse-Fliege übertragen wird, „kann auch tödlich enden, vor allem, wenn sie nicht behandelt wird. Deshalb war sie für einige Kolonialherren ein Thema, weil sie fürchteten, weniger Arbeiter zur Verfügung zu haben.“
„
Als Medikament testete
Robert Koch
das arsenhaltige Mittel Atoxyl. Dass es in hoher Dosierung giftig ist, war bekannt. Trotzdem erhöhte er die Dosis schrittweise auf ein Gramm Atoxyl, spritzte in Intervallen von sieben bis zehn Tagen und nahm Schmerzen, Erblindung und den Tod tausender Menschen billigend in Kauf.“
Statt mit Meerschweinchen experimentierte Koch mit Afrikanern.
Diese Experimente wurden laut Edna Bonhomme „in Deutschland an Tieren durchgeführt. An Menschen waren sie verboten.“
„
Um pro Tag rund 1000 Patienten zu untersuchen, isolierte Koch vermeintlich Kranke in sogenannten Konzentrationslagern: Einer Ansammlung von Strohhütten und rudimentären Zelten, die bei Sturm umgeweht wurden. Es fehlte an allem: Decken, sauberem Wasser, zu essen gab es oft nur Mehl und Salz. Wie viele Menschen allein wegen dieser Zustände starben, weiß niemand. Konzentrationslager gab es nicht nur auf den Sese-Inseln [im Viktoria-See], sondern überall, wo europäische Ärzte antraten, um Seuchen zu besiegen.“
„
Die Bevölkerung war misstrauisch und sie hatte auch Gründe, misstrauisch zu sein. Besonders bei der Schlafkrankheit war das so, in Westafrika vor allen Dingen, wo man afrikanische Menschen in großer Zahl, die man für mit Schlafkrankheit infiziert hielt, zusammenbrachte in solchen Lagern. Die man auch Konzentrationslager nannte, um an ihnen dort in einer Situation, die die Flucht unmöglich machte, Humanexperimente, sogenannte therapeutische Experimente durchzuführen. Die Kolonialmedizin sollte nicht Menschen in Not helfen. Sie diente dem ökonomischen Aufschwung der Kolonie – und neuen Erkenntnissen für die deutsche Wissenschaft und die Pharmaindustrie. Deshalb haben die Kolonialärzte auch den Menschen ohne Grund extrem schmerzhafte Öl- und Salzlösungen gespritzt oder sie in der Wüste ausgesetzt, um zu sehen, wie lange sie dort überleben. Jahrzehntelang verbargen sich diese Horrorgeschichten hinter den Verbrechen des Naziregimes in den KZs. Derweil haben die deutschen Ärzte an Afrikanern erprobt, was sie später an Juden, Homosexuellen und politischen Gegnern perfektionierten.“
Es gab eine personelle Kontinuität von den Kolonialärzten zu den KZ-Ärzten und, so sie nicht in Nürnberg gehängt wurden, zu einigen Ärztefunktionären in der BRD. Julia Amberger nennt in ihrem Deutschlandfunk-Feature einige Namen:
„
Zum Beispiel Claus Schilling: Bis 1905 betrieb er in Togo eine Praxis für Einheimische und führte an ihnen fragwürdige Experimente durch. Später hat er Geisteskranke in Italien und über 1000 Häftlinge im KZ Dachau mit Malaria infiziert, um ein Medikament gegen die Tropenkrankheit zu finden.
Oder der Rassenhygieniker Eugen Fischer, Gründer des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Er war beim Anblick der Kinder weißer Kolonialherren und schwarzer Frauen in Nigeria so geschockt, dass er sie zwangssterilisieren ließ. 1937 hat er dann im Rheinland 500 bis 800 Kinder von deutschen Frauen und französischen Soldaten gegen ihren Willen auf brutale Art und Weise unfruchtbar gemacht.
Von 1909 bis 1913 hat er in der damaligen deutschen Kolonie Togo Pockenmassenimpfungen schlampig durchgeführt. Hunderte von Menschen, rund fünf bis zehn Prozent aller Geimpften, starben 1911 beim nächsten Ausbruch, da der Erreger im Lebendimpfstoff oft nicht wirksam war.“
Wolfgang Eckart über Eugen Fischer: „Das hat ihm einen relativ schlechten Ruf in der kolonialen Peripherie eingebracht und eine Impfmüdigkeit, ja für eine Impffeindlichkeit in der afrikanischen Bevölkerung gesorgt, die schon beispiellos war. Das passte sehr gut hinein in die große Skepsis gegenüber der westlichen Medizin, die man eher als feindliche Medizin und nicht als hilfreiche Medizin betrachtete. Und hatte vielfach den Eindruck zu Recht, dass an den Körpern der Afrikanerinnen und Afrikanern erprobt werden sollte, was ganz anderen Zwecken diente.“
W
eil die deutschen Ärzte die Afrikaner gegen Pocken mit schlechtem Impfstoff behandelten, gab es viele Todesopfer.
Als Grund gaben
die Ärzte
laut Eckart
vor, „es handle sich um eine besonders hartnäckige biologische Varietät des Erregers. Das Vertrauen der Einheimischen hatten sie zu diesem Zeitpunkt längst verspielt. Während die anfangs vor den rudimentären Impfstationen Schlange standen, haben die Kolonialärzte sie später zum Impfen gezwungen.“
„
Selbst beim letzten Ebola-Ausbruch im Kongo [2018 – 2020] gab es eine Situation, in der sich Menschen beschwerten, sie seien zu einer Behandlung gezwungen worden,“ berichtete Chernoh Bah, ein Soziologe auf Sierra Leone, der sich wissenschaftlich
mit solchen Skandalen beschäftigt. U.a. auch mit dem Ebola-Ausbruch 2014 – 2015, „als Forscher, Ärzte und Freiwillige aus dem Westen nach Sierra Leone strömten. Das Behandlungszentrum Lakka wurde von der italienischen NGO ‚Emergency‘ betrieben. Die Pfleger waren Freiwillige aus Großbritannien. Sie brachten die Versuche ans Licht, weil die Injektion hoher Dosen bei einigen Patienten zu Atemwegserkrankungen und Entzündungen führten – und zu einer Sterberate von 67%. In anderen Behandlungszentren starben im Durchschnitt 50 bis 60% der Ebola-Infizierten.
Emergency stoppte daraufhin die Tests, das war es. Keine Ermittlung, kein Gerichtsverfahren, keine Entschädigung. Deshalb hätten die Leute den Eindruck, sie würden missbraucht, sagt Bah – wie damals von den Kolonialärzten. Die Betroffenen werden in Zeiten von Co
rona
sehr misstrauisch sein, wenn sie erfahren, dass Ärzte aus dem Westen...“
Anhand alter Akten aus den Jahren 1914 bis 1964 fand Chernoh Bah heraus: „Die Forscher haben Versuche an Individuen durchgeführt und dann an Kaninchen, Ratten und Hühnern wiederholt. Sie machten auch eine Studie mit Hühnern, um herauszufinden, welche Art von Training für Gefangene, die keine Arbeit haben, besser ist. Es ging um die Beziehung zwischen Ernährung und sportlicher Aktivität im Gefängnis, das sie studierten, indem sie Menschen mit Hühnern verglichen.“
Die Medizinhistorikerin Edna Bonhomme nennt ein Beispiel aus Simbabwe aus den 70er Jahren: „Damals wurde das Verhütungsmittel Depo-Provera klinisch an Frauen getestet. Nach der Zulassung wurde es von der Kolonialregierung verteilt. Allerdings nicht auf freiwilliger Basis.“
Julia Amberger:
„Die einzigen Nachkommen afrikanischer Volksgruppen, die während der Kolonialzeit Opfer von Menschenexperimenten wurden und jemals vor Gericht zogen, sind die traditionellen Führer der Herero und Nama aus Namibia. 2017 verklagten sie Deutschland in den USA für den Völkermord, den deutsche Truppen Anfang des 20. Jahrhunderts an ihnen begingen. In der Klageschrift steht auch, dass deutsche Ärzte an lebenden Herero-Gefangenen medizinische Experimente in Konzentrationslagern durchgeführt hätten. Dafür fordern sie bis heute Entschädigung. Die Völkermord-Klage lehnte das US-Gericht 2019 ab.“
Das Mißtrauen gegen Impfexperimente herrscht aber nicht nur in Afrika, sondern auch unter den Afroamerikanern in den USA, wo sich „
nur 32 Prozent aller Afroamerikaner gegen Covid-19 impfen lassen – im Vergleich zu 52 Prozent der Weißen. Obwohl
sie
besonders häufig am Coronavirus erkranken. Als Grund gaben sie systematischen Rassismus an und Missbrauch von Schwarzen während der Tuskegee-Syphilis-Studie. 399 afroamerikanische Landpächter wurden zwischen 1932 bis 1972 Opfer eines Experiments des US-Public Health Service. Ohne informierte Einwilligung, ohne Behandlung, auch als bereits eine Heilmethode zur Verfügung stand.
“
.
Robert Koch in Afrika
.
Hier soll noch vom Lorbeergewächs Avocado die Rede sein, das eine andere Geschichte als der Zucker und das Usambaraveilchen hat: eine paläobotanische. Es ist ein mittelamerikanischer Baum, der birnenförmige Beerenfrüchte trägt, die einen ungewöhnlich großen Kern haben. Es gibt inzwischen 400 Kultursorten in fast allen warmen Ländern und große Anbaugebiete, auf Plantagen, die bereits ein großes Wasserproblem verursachen,
da wir so gerne Avocado-Früchte essen.
Für die Produktion einer einzige Avocado-Frucht werden z.B. in Petorca (Chile) ca. 320 Liter Wasser benötigt. Aufgrund des Anbaus von Avocados sind die Flüsse und Kanäle ausgetrocknet, die Region leidet unter Wasserknappheit. Wassertankwagen versorgen die dortige Bevölkerung mit Trinkwasser. Sie leidet, weil hier die Avocados so begehrt sind.
„
Um diese Früchte zu bekommen, würde man männliche und weibliche Avocadobäume benötigen, deren Blüten sich jeweils gegengleich öffnen. Aber auch das einzelne immergrüne Bäumchen aus dem Avocadokern ist ein hübscher Anblick als Zimmerpflanze,“ heißt es auf utopia.de. „Nimm den Avocadokern und bohre drei Zahnstocher auf halber Höhe seitlich in den Kern. Hänge ihn danach mit der spitzen Seite nach oben so in ein Glasgefäß mit Wasser, dass das untere Ende des Avocadokerns ins Wasser ragt.“ Mit Glück keimt er dann und man kann ein Bäumchen daraus ziehen.
Früchte haben einen ähnlichen Zweck wie der Nektar bei den Blüten: „Sie dienen als Verlockung und zugleich als Belohnung für all jene Tiere, die sich von ihnen ernähren und die Samen auf diese Weise von der Mutterpflanze forttragen“, heißt es in dem Buch des italienischen Biologen Stefano Mancuso, „Die unglaubliche Reise der Pflanzen“ (2020).
Über den Avocabaum (Persea americana) schreibt er, dass zu Urzeiten in Amerika riesige Säugetiere lebten, die vor etwa 13.000 Jahren alle von Menschen ausgerottet wurden, darunter auch das Mastodon. Dieses elefantenähnliche Tier war in der Lage, die Avocadofrucht zu fressen, wobei der Kern den Verdauungstrakt unbeschädigt passierte.
Als die Mastodonten ausgestorben waren, sah es auch für die Avocados schlecht aus, aber dann kam laut Mancuso der Jaguar, dem das fette Fruchtfleisch ebenfalls zusagte, das er mit seinen Zähnen vom Samen löste, ohne diesen zu beschädigen.
„
Der Jaguar konnte natürlich nur eine Übergangslösung darstellen. Als Transportpartner für die Avocadobäume war er nicht ideal, aber gut genug, damit sie überleben konnten. Dennoch schrumpfte das Verbreitungsgebiet der Avocado unaufhaltsam und es schien bereits, als solle sie am Ende doch noch das Schicksal der Mastodonten teilen, als unversehens der Mensch auf der Bildfläche erschien und die Pflanze für sich entdeckte.“
Nun verbreitete sich der Baum wieder, aber „sich mit dem Menschen einzulassen bedeutet, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen, den man früher oder später mit seiner Seele bezahlt.“ Und die Seele der Frucht, das ist der Samen, ihr Kern, den man ihr nun wegzüchtet, er stört beim Zubereiten.
„
Beraubt man eine Pflanze jedoch der Möglichkeit, ihre eigenen Samen zu produzieren, degradiert man sie vom Lebewesen zum bloßen Produktionsmittel in den Händen einer Lebensmittelindustrie.“ Und zur Aufzucht einer neuen Zimmerpflanze kann man ihre Frucht auch nicht mehr verwenden.
.
Ein Exponat aus der Forschungsstation Amani